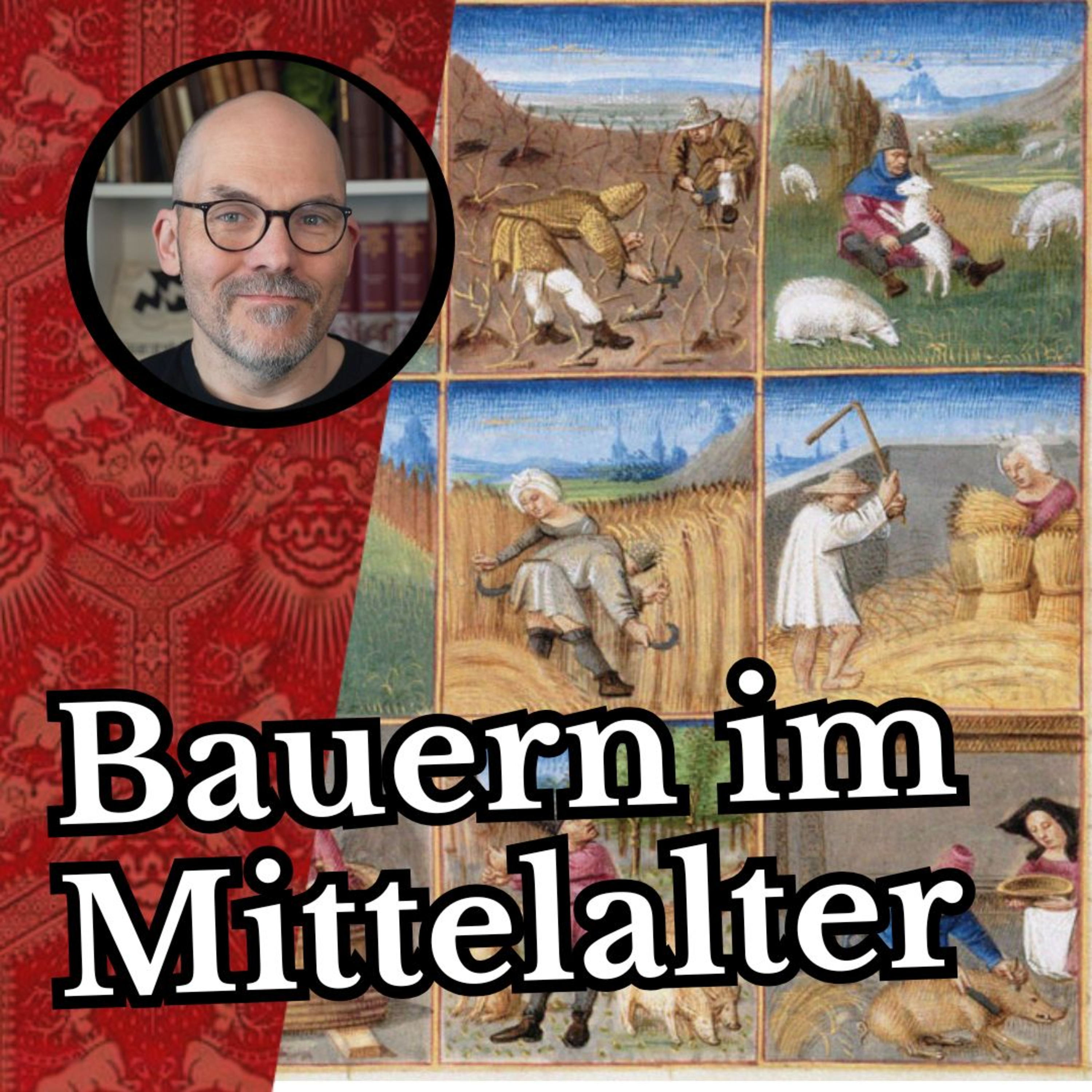
Shownotes Transcript
Herzlich willkommen bei Geschichtsfenster. Mein Name ist André und heute geht es um Bauern im Mittelalter. Ist so ein Thema, Mittelalter, man denkt an Ritter, an Burgen, wir reden über Städte. Bauern sind immer so auch dabei. Vor allem wenn wir in die Populärkultur schauen, auch Kinderbücher und ähnliches oder Filme, denkt an Ritter der Kokosnuss, Bauern im Schlamm. Das hat sich leider sehr festgesetzt. Auch in Kinderbüchern, Bauern sind immer so abgerissene Gestalten, die irgendwie nichts haben.
Ob das wirklich so ist, darüber geht's heute.
Das werden wir uns anschauen. Bevor es losgeht, eine kleine Werbung in eigener Sache. Denn jetzt am kommenden Wochenende, es ist keine sehr langlebige Werbung, sondern jetzt wirklich am 24. und 25. Mai findet in Lich wieder der historische Markt statt. Und da bin ich mit anderen historischen Darstellern auf dem Kirchenplatz und zeige Geschichte. Die anderen sind genauso drauf wie ich. Man sieht es hier sehr schön. Die stehen in ihren Ständen. Die Besucher können dazukommen. Wir verkaufen nichts. Wir erklären nur. Wir führen nur Dinge vor. Und
Ich kann jedem empfehlen, hinzukommen. Von 12 bis 18 Uhr an beiden Tagen ist das Ganze geöffnet. Drumherum ist noch so ein Stadtfest, auch sehr schön, kann man sich auch anschauen. Aber wer mal wirklich Mittelalter zum Anfassen haben möchte, Spätmittelalter, der kann immer ins Vorbeikommen. Kann ich nur empfehlen.
gibt es nicht so oft im deutschsprachigen Raum, also abnachlich. Im gesamten Mittelalter ist der Anteil an Menschen, die auf dem Land leben, die in der Landwirtschaft leben, etwa bei 90% anzusiedeln. Mehr im Frühmittelalter, weniger im Spätmittelalter. Und das ist so eine Zahl, die ist ganz wichtig, denn diese 90% plus minus werden dazu gebraucht, um die 100% zu ernähren. Muss man sich vorstellen. 10% zu haben, die nicht auf dem Feld arbeiten müssen, müssen 90% ernähren.
Heute ist das Ganze ein bisschen anders. Heute haben wir 2%, die wirklich noch in der Landwirtschaft arbeiten und etwa 12% in der gesamten Lebensmittelbranche. Das sind Zahlen, die sind schwierig, weil wie ist Transportwesen, gehört es dazu oder nicht? Aber tatsächlich 2% ist das, was wir heute wirklich noch in der Landwirtschaft haben. Also es hat sich sehr, sehr viel getan. Und es ist auch so ein Fortschrittsfaktor, denn wenn wir 90% haben und durch Landwirtschaft
bessere Anbaumethoden durch Fortschritt und so irgendwann nur noch 88 Prozent in der Landwirtschaft tätig sind, haben wir zwei Prozent frei, die andere Dinge tun können. Und das haben wir zum Beispiel im Hochmittelalter. Wir haben einen Fortschritt in der Landwirtschaft, die Ernährungslage wird besser und dann können überhaupt Leute anfangen, Kathedralen zu bauen, in den Klerus zu gehen, gebildet zu werden und so weiter. Die sind vorher nicht da. Die braucht es. Auch das römische Reich kann so expandieren und kann das, was es kann, weil es
Getreidequellen hat, weil das Nahrungsmittelquellen hat. Ägypten war da zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt. Große Kornkammer. Und diese Zahl, diese Kennzahl, die ist immer sehr, sehr wichtig und zeigt eben, wie wichtig die Bauern für das Mittelalter wirklich sind. Diese 90% der Bevölkerung, die schaffen es, das Mittelalter zu ernähren und entscheiden letztlich darum, ob es Fortschritt gibt oder nicht. Und diese 90% hauen wir alle zu Bauern zusammen, was natürlich nicht stimmt. Da gibt es eine ganze Menge Binnendifferenzierung. Es gibt
Hofbauern, es gibt Knechte, es gibt Tagelöhner, es gibt Leute, die eben als Häusler leben, die kein Land haben, sondern nur ihr Haus und ihren Garten. Das ist wirklich ein ganz, ganz
großes Themenfeld. Von daher ist es Zeit, sich mal mit diesen Bauern zu beschäftigen. Was sind die eigentlich? Wie entstehen die? Wie leben die? Das ist ein Hauptteil des Ganzen hier. Wie sieht der Alltag aus? Was ist deren Lebenswirklichkeit? Und als Idee eines Standes von Bauern, das formiert sich im Hochmittelalter. Da haben wir diese ersten Ideen, da haben wir Gerhard von Camprai oder Adalbero von Lauern, die ein Ständesystem entwerfen und da haben wir eben schon im frühen Hochmittelalter die Oratores, die Betenen,
Die Pugatoris, die Kämpfenden, und die Laboratoris. Das ist eben der Bauernstand. Hier ist das Ganze dann deutlich später nochmal zu sehen. Unten eben die, die arbeiten. Und hier haben wir auch schon ein Bild davon. Also da sind auch schon modische Eigenheiten dran. Also es gibt damals auch schon das Klischee des Bauern. Das ist nichts Modernes. Das haben wir damals schon. Und...
Der Begriff Bauer, der taucht auch ungefähr in der Zeit auf, also gerade ist natürlich volkssprachig Deutsch, der heißt damals noch Gebure, das ist der Begriff dazu und das Ganze kommt von Bur, Haus, findet man heute noch in Nachbar. Das nächste Haus, Nachbar, ist diese Bur und diese Nachbarschaften werden auch als Burschaft bezeichnet, was dann irgendwann im Begriffswandel erfährt und dann eben zur Bauernschaft wird.
Bevor dieser Volkssprachbegriff aufkommt, gibt es den Begriff der Liberi, der Freien, die Liti, die Halbfreien, die Serbi, die Unfreien. Und da sind wir im Frühmittelalter zum Beispiel. Hier haben wir ein Bild aus dem Stuttgarter Psalter, hatte ich letztens schon mal im Video über die Franken. Da haben wir einen Bauern mit dem Mantel, könnte ein freier Bauer sein, kann man nicht sagen. Am Pflug, das ist eine Darstellung aus dem Frühmittelalter eines solchen Bauern. Und spätere lateinische Begriffe, die auch im Hochmittelalter und im Spätmittelalter noch üblich sind, sind zum Beispiel Aggregatoren.
Acricolae oder Rustiki. Das sind Begriffe, die haben wir da immer wieder. Und im Frühmittelalter, wir haben verschiedene Quellen. Wir haben einmal so...
Stämme, Franken, Sachsen und so weiter, da haben wir viele freie Bauern, die auch teilweise noch als Bauernkrieger agieren, die noch wehrfähig sind, die Waffen tragen. Aus der römischen Tradition haben wir vor allen Dingen Sklaven. Die römische Agrarwirtschaft war ganz, ganz stark auf Sklaven ausgerichtet. Diese Sklavenwirtschaft, die werden wir noch weiter sehen, auch aus Vizibilisationssystemen, diese freien
Und Bauernkrieger, die schaffen es entweder selber Grundherren zu werden, in den späteren Reiterkriegerstand aufzusteigen, denn das ist wirklich so das Problem mit den Rittern, mit den Reiterkriegern werden die Werte wieder obsolet oder sie sinken herab zu halb freien, teilweise später auch unfreien, also aus diesen beiden großen Gruppen vermischt sich ein neuer Bauernstand.
Und dieser Bauernstand hat ein paar Eigenschaften. Er ist erstmal abhängig von einem Grundherren. Die besitzen den Grund üblicherweise nicht, das wird sich später nochmal ändern, aber die Herren, aus denen später der Adel entwickeln wird, können übrigens auch Klöster sein, auch Klöster sind Grundherren, die besitzen das Land und die Bauern besitzen es nicht, arbeiten darauf, dürfen es bewirtschaften, aber es gehört nicht ihnen.
Typisch für den Bauern ist auch die selbstständige Bewirtschaftung von Hofflächen. Darin unterscheiden sich von Teilen des frühmittelalterlichen Bauernstandes, die noch auf Villikationen, auf Gutshöfen arbeiten, eben im Haushalt ihres Herren. Der klassische Bauer des Mittelalters tut das nicht. Die Schollenbindung, man ist mehr oder weniger an seine Scholle, an sein Land gebunden.
Sesshaftigkeit, das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn gerade in der Spätantike haben wir ja große Bewegungen, da ist eben Sesshaftigkeit nicht so richtig gegeben und die werden ja auch, die ganzen germanischen Stämme werden jetzt sesshaft und die grundsätzliche Kriegsuntüchtigkeit. Im Mittelalter wird der Bauer letztlich kriegsuntüchtiger, er ist kein Krieger mehr. Bei Freibauern gibt es da Ausnahmen, da gibt es auch Aufgebote und sowas, aber so als grundsätzliche Einstellung ist er nicht mehr kämpfend.
Im Frühmittelalter, gerade da, wo wir nicht römische Besiedlungen haben, haben wir noch sehr, sehr viel Weidewirtschaft. Und die Siedlungen, die wir da finden, sind auch noch keine Dörfer. Ich habe vor einiger Zeit was über Dörfer gemacht. Das ist tatsächlich überraschend, dass Dörfer, wie wir sie kennen, sich vor allem im Hochmittelalter erst formieren. Entweder haben wir die Wiesenwiese,
Die Villikationen der Römer, das sind Huthöfe oder wir haben eben Dörfer, die nicht dauerhaft sind, die ungefähr so 40 Jahre im Schnitt bewohnt werden. Dann müssen sie aufgegeben werden, denn wir haben noch keine Dreifelderwirtschaft. Ist zwar grundsätzlich bekannt, wird aber erst seit dem 9. Jahrhundert wirklich durchgesetzt. Es gibt wenige Möglichkeiten zur Düngung und die Böden erschöpfen sich relativ schnell und dann muss die Siedlung dem Boden folgen. Also wenn der Boden ausgelaugt ist, dann muss die Siedlung notfalls verlegt werden.
Lustigerweise sind Friedhöfe oft dauerhaft. Die sind dann außerhalb des Siedlungskerns. Die liegen nicht in der Siedlung, sondern abseits davon. Und tatsächlich so durchgehende Dörfer, die auch wie ein Dorf organisiert sind, die gibt es noch gar nicht. Das ist etwas, was tatsächlich nicht vorkommt. Das Gerät im Frühmittelalter ist vor allem der Hakenpflug. Erzähle ich gleich nochmal was dazu. Und es gibt noch das große Problem, dass die Niederungen in unserer Region oft nicht gut zu bewirtschaften sind. Die sind auch zu sumpfig. Die sind auch nicht trockengelegt. Das ist dann so eine
Die Erschließungsarbeit ist früh und hochmittelalters, diese Flächen landwirtschaftlich zu erschließen. Problem ist dazu auch der Hakenflug, den wir hatten, der ist dafür gar nicht geeignet und die Arbeitstiere haben selten Hufeisen und das gibt dann ein Problem in den feuchten Niederungen und auch wirklich so Sumpftrockenlegung ist was, was erst nochmal passieren muss.
Und das Frömmenseil ist da auch eine Phase des Landausbaus. Es wird durch Rodung, es wird durch Trockenlegung erstmal in vielen Regionen Land geschaffen. Da, wo römische Besiedlung war, da gibt es schon Infrastruktur, also auch Wege, Straßen und so weiter. Die kann übernommen werden. Überall außerhalb muss erstmal diese Infrastruktur hergestellt werden.
erschaffen werden. Rodung ist natürlich ein ganz großes Ding, bedeutet auch erstmal fruchtbare Böden, durch die Asche, durch das Verbrennen ist der erstmal quasi vorgedüngt, was aber eben auch nicht sehr lange hält und so haben wir eben wieder das Problem mit diesen Dörfern.
Die Grundherren in der Zeit sind Könige, Herren, also Adel existiert im Frühmittelalter in der Form noch nicht, Klöster eben. Da haben wir nochmal so ein Beispiel aus dem Frühmittelalter, ein Königshof und gerade so ein König, Reisekönig, habt ihr schon ein paar Mal gehört, der hat kein...
festes Gebiet, kein umschlossenes Gebiet des Seins ist, sondern er hat Königshöfe, er hat verschiedene zersplitterte Gebiete, die ihm gehören. Das ist im frühen Mittelalter sogar noch relativ verbreitet. Auch durch Erbschaften, Hochzeiten und sowas verstärkt sich das immer mehr. Also Adel hat grundsätzlich einen großen Streubesitz und dementsprechend gibt es dann viele Dörfer, die ihm gehören, die aber gar nicht unbedingt auf demselben Gebiet liegen müssen. Und die Art der Bewirtschaftung ist die sogenannte Villikationsverfassung. Also
Grund her ist es noch selbst Teil dieser Bewirtschaftung.
Nicht nur seinen eigenen, er hat mehrere Höfe, die von seinen Untergebenen bewirtschaftet werden. Das ist so eine Rekonstruktion, da hat sich seit der Antike gar nicht viel verändert. Es gibt tatsächlich immer noch dieselbe Struktur und der normale Bauer in Anführungszeichen ist hier eben ein Servi, ein Knecht, der auf diesem Hof lebt, unter Aufsicht das Ganze bewirtschaftet. Der ist noch nicht in der Form selbstständig, dass er irgendwie seinen eigenen Lebensunterhalt produziert, sondern der arbeitet tatsächlich im Gesamtgefüge mit.
Der Begriff Saalhof, den ich eben schon hatte, der kommt eben von dieser Terra Salica, diesem Eigenland des Grundherrn. Das ist das Land, das von seinen Unfreien direkt bearbeitet wird. Dazu gibt es dann auch Hufen, weiteres Land, das von Bauern selbstständig bewirtschaftet wird. Also auch dieses Willikationssystem, also die Grundverfassung des Frühmittelalters, es gibt trotzdem schon unabhängigere Höfe, die sind nicht ganz unabhängig, es gibt immer noch Leistungen dafür. Und da haben wir dann eben Bauernfamilien, Bauernhaushalte, die das Ganze bewirtschaften.
bearbeiten. Dafür schulden sie Dienste und Abgaben. Teilweise auch nur Militärdienst, also gerade diese Hofstellen sind auch noch halbfrei Bauern. Der Vorteil ist im Gegensatz zu dem antiken Sklavensystem auf diesen Villen der größere Anteil an Selbstversorgung. Ich muss mich als Grundherr nicht um die Leute kümmern, das machen die schon selbst und sie geben mir dann Abgaben.
Die Fixkosten sind dadurch gering, gleichzeitig gibt es eben so wertvolles Gerät wie Pflugwagen und ähnliches, die sind zentral verfügbar an diesem Saalhof und können von einem größeren Anteil von Leuten genutzt werden. Diese Bauernstellen, da hatte ich eben den Begriff Hufe genommen oder Huf, das ist so die Grundeinheit, das ist das Land, das ein Bauer als Ausstattung benötigt.
Unterschiedlich, wie groß das ist. Also Huf ist kein festgelegtes Maß. Es wird dann gerne umgerechnet in Morgenland. Ist genauso wenig ein festgelegtes Maß. Ein Morgen sagt im Grunde genommen, wie viel ein Ochsengespann an einem Tag flügen kann. Das ist so die Grundeinheit. Je nach Region ganz unterschiedlich. Im Süden und Norden unterscheidet sich das. Je nach Anbaugebiet ist es wirklich etwas, was überhaupt nicht festlegbar ist.
Und diese Hufen, übrigens da kommt so was im Namen wie Huber her, das werden wir gleich nochmal haben, das wird im Mittelalter die ganze Zeit über ein wichtiger Begriff bleiben. Diese Hufen und der Saalhof bilden zusammen ein Netzwerk, auch ein wirtschaftliches Netzwerk und in der Gesamtheit die Familia des Grundherrn. Nicht Familie, das ist ein anderer Begriff, aber Familie ist wirklich so alles, was einem Grundherrn untersteht. Und so ein Netzwerk, so
Die Grundherrschaft einer Person ist im Frühmittelalter mehr oder weniger autark. Es gibt eigentlich fast nichts, was die zukaufen müssen. Es gibt natürlich immer Besonderheiten, aber im Großen und Ganzen können die sich selbst versorgen. Auch Handwerker oder sowas, Städte gibt es ja so gut wie gar nicht. Handwerker sind dann eher am Saalhof angesiedelt und versorgen eben dieses Netzwerk. Es gibt auch noch gar keinen Markt. Also weder als Absatzmarkt, es gibt keine Städte, in die du...
dein Zeug bringen kannst, noch gibt es einen großen Zukaufmarkt. Es gibt zwar ein bisschen Fernhandel und natürlich werden so Sachen wie Metalle oder sowas gehandelt, aber einen ganz großen Teil dieser Wirtschaft ist einfach komplett autark. Was dann über den Saarlauf und die Höfe hinaus noch existiert, so Sachen wie Mühlen, Schenken, auch wenn die noch selten sind, Weinpressen, Backöfen, also die ganze große Infrastruktur ist sehr, sehr oft grundherrschaftlicher Besitz und bleibt es auch. Auch selbst im späten Alter haben wir ganz viele solcher Sachen immer noch im grundherrschaftlichen Besitz. Da
Ist so ein Überbleibsel des Ganzen. Dazu kommt natürlich auch noch die Gerichtsherrschaft. Mit der Zeit schaffen es die Grundherren auch Gerichtsherren zu werden. Das ist im frühen Mittelalter noch anders, da gibt es noch Grafen, eingesetzte Beamte, die das machen, aber das geht mehr oder minder komplett auf die Grundherren über.
Und damit verfestigt sich eben diese komplette Abhängigkeit vom eigenen Grundherrn und ob es ausgesprochen ist oder nicht, es entsteht eine Art Halbfreiheit. Teilweise ist es auch erstrebenswert, unfrei zu werden, weil man damit sich in den Schutz eines mächtigen Herrn begibt und von diesem Schutz profitieren kann.
Im Hochmittelalter kommt es dann zu einer Bevölkerungsexplosion. Der Adel zieht sich so langsam aus dem Billigationssystem zurück. Teils wird das ganze Land an die Bauern komplett abgegeben, teilweise als Meier oder Dinghöfe gehalten, wo dann eben ein Meier, ein Großbauer das Ganze im direkten Auftrag des Grundherrn bewirtschaftet. Die
Die Bauern agieren jetzt autarker, die sind mehr oder weniger jetzt selbstständige Unternehmer, sind aber verpflichtet noch Abgaben zu leisten und es bilden sich Dörfer und Dorfgemeinschaften, wie wir das heute kennen, also wirklich so auch mit genossenschaftlicher Verwaltung. Dafür schulden die
dem Herrn Frohendienste. Hand- und Spannendienste wird es auch oft genannt, bis in die Neuzeit hinein. Und hier haben wir ein schönes Bild aus dem frühen 16. Jahrhundert, da sieht man eben ganz viele Variante, teilweise Jagd gehört dazu, gerade auch solche Vögel. Man sieht hier unten jemanden, der mit
mit einem Gong Vögel vertreiben muss. Das ist auch im Bauernkriegen so ein Reizthema, was alles dazugehört. Aber eben auch, wie gesagt, diese Hand- und Spanndienste. Spanndienste ist vor allem wichtig, wenn ich selber ein Gespann habe. Pferde, Ochsen, dann muss ich die auch zur Verfügung stellen. Und eben hier wird auch ein Graben ausgehoben. Also solche Aufgaben sind alles Dinge, die als Frohendienst geleistet werden müssen. Und es ist sehr individuell, wie viel Frohendienst geleistet werden muss. Also es kommt auch darauf an, was für eine Art von Großteil
Gutmann von seinem Herrn bekommen hat. Teilweise ist es auch so, dass die mit wenig Land mehr Hand- und Spannendienste leisten müssen als die mit, weil die eben keine Abgaben zahlen. Das ist ein sehr komplexes Thema. Aber diese Frohendienste sind immer ein ganz
wichtiger Punkt. Und diese Bevölkerungsexplosion, die kommt nicht von ungefähr. Zum einen hat sich die Dreifelderwirtschaft durchgesetzt. Die Felder werden jetzt im Dreijahresrhythmus abwechselnd bewirtschaftet. In einem Jahr Sommergetreide, im anderen Wintergetreide. In einem Jahr bleibt es brach liegen oder es wird als Weide benutzt und so weiter. Aber das steigert den Ertrag. Düngung wird etwas effektiver. Die Arbeitsgeräte
ändern sich sehr der Beatflug kommt auf er ist zwar schon in der Antike beschrieben worden aber hier haben wir ebenso ein Beatflug der schafft es durch ein Wendeprett später auch ein Wendeplech nicht nur den Boden aufzureißen sondern einmal komplett zu wenden, zähl ich gleich nochmal nachher was dazu und der ist besonders gut für die schweren Böden der Niederung die sind zwar zum Teil trockengelegt inzwischen aber genau diese Böden die im frühen Mittelalter noch kaum zu bewirtschaften sind dafür ist der sehr sehr gut
Dazu kommen Anspannmöglichkeiten wie das Kummit, damit kann ich auch Pferde besser nutzen, die Wasserkraft wird effektiver genutzt, es kommen mehr eiserne Werkzeuge auf und der Ertrag pro ausgesät im Korn steigert sich. Und diese Nahrungsmöglichkeiten, die sorgen eben dafür, dass die Bevölkerung sich vom 11. bis zum 13. Jahrhundert etwa vertreibt. Also richtig, richtig starkes Wachstum.
Dadurch breiten sich auch Siedlungen aus, und zwar sowohl nach außen als auch im Inneren. Es gibt zum einen im Inneren neue Gebiete werden gerodet, werden besiedelt. Das kennt ihr auch so, dass Dörfer sich teilen, ober, nieder, unter, ober. Das sind oft solche Siedlungen. Und dann gibt es natürlich die Ostsiedlung, dass so der Raum östlich der Elbe besiedelt wird, durchaus im Konflikt mit den dort lebenden Slaben. Aber das sind natürlich auch alles Siedlungsbewegungen.
Die Städte wachsen stark und vor allen Dingen in der Zeit werden jede Menge Städte neu gegründet. Also da ändert sich das Gesicht Europas schon ganz deutlich. Und ihr kennt alle den Begriff Stadtluft macht frei, aber es gibt auch den Begriff Rodung macht frei. Hier haben wir zum Beispiel aus dem Sachsenspiegel eine Abbildung, wie eben so eine Gründung von Städten geht. Also es ist eine Urkunde, die Bauern roden das Land, bauen Häuser und oft ist damit auch eine Freiheit verbunden. Also
Solche Siedlungsbauern sind oft Freibauern, die haben andere Absprachen mit den Grundherren, haben dann immer noch Abgaben zu leisten, auch immer noch Fronien zu leisten, sind aber viel, viel freier als die normalhörigen Bauern. Dafür müssen sie, weil es oft auch in Gegenden sind, die noch umkämpft sind, Waffen tragen als Wehrbauern. Durch diese Siedlungsvergrößerung und auch die neue Anzahl der Städte oder die höhere Anzahl der Städte gibt es auch eine stärkere Arbeitsteilung. Dieser Punkt, dass diese Willikationen
Autark sind und letztlich nichts von außen brauchen, die ändern sich sehr, sehr stark. Es kommt zu einer Marktanbindung. Die Städte brauchen Nahrungsmittel, die nehmen es gerne ab. Es entstehen eben Märkte, Marktrechte werden vergeben. Die Bauern können diese Märkte beliefern. Gleichzeitig können sie sich auch selber spezialisieren, Dinge zukaufen.
Oder auch Materialien kaufen, die sie vorher gar nicht hatten. Also bis ins Hochmittelalter ist zum Beispiel Holz ein ganz, ganz wichtiger Werkstoff. Metall, Keramik, all so Sachen sind deutlich weniger wichtig. Und es ändert sich halt jetzt in dieser Zeit stark, weil ich einfach die Möglichkeit habe, solche Sachen zuzukaufen. Mit dieser Marktanbindung kommt auch die Geldwirtschaft immer mehr auf. Es wird sich auch ein Abgabesystem zeigen. Also auch da wird eine Marktanbindung erzeugt. Es gibt eine deutlich soziale Binnendifferenzierung. Also die
Die sozialen Schichten innerhalb des Bauernstandes werden deutlich stärker, werde ich gleich auch was dazu sagen. Die sind längst nicht alle auf einem Level und nicht alle gleich Bauern. Und da die Abgaben an die Grundherren immer noch als Naturalabgaben gezahlt werden, sprich als Anteil am Erfolg, ist ja wirklich so, ich gebe ein Fünftel meines Ertragens nur als Beispiel, das Fünftel ist jetzt frei aus der Luft gegriffen, dann...
ist, je mehr ich erwirtschafte, ist auch der Anteil größer, aber mein Restanteil ist ja auch größer. Und auf diese Art und Weise können die Bauern durchaus an diesem Aufschwung teilhaben. Um 1300 ist Europa dann eine echt dicht besiedelte Kulturlandschaft. Auch die Anzahl der Siedlungen ist höher als heute. Die Siedlungen sind natürlich heute größer, die Infrastruktur ist eine andere. Aber man darf nicht denken, dass Europa in der Zeit irgendwie eine halbe Wildnis ist oder da dichte Urwälder herrschen oder sonst etwas. Das ist im Grunde genommen komplett falsch.
kultiviert, die Felder sind durch Mauern, Hecken, Sträucher und ähnliches abgegrenzt. Es gibt Gatter, die das Ganze einteilen. Wege, Zäune, Wasserwege, Mühlteiche sind angelegt. Die Wälder sind längst keine Wälder im eigentlichen Sinne mehr, sondern Forste, werden auch als Weideforst genutzt. Es gibt spezielle Waldwirtschafts, habe ich auch schon mal ein Video drüber gemacht, das ist alles
Keine Wildnis ist alles ein Gebiet, das bewirtschaftet wird. Und wie gesagt, wir haben jetzt in diesen zwei Jahrhunderten etwa eine Vertreifachung der Bevölkerung. Aber dadurch haben wir auch Probleme, nämlich überbeanspruchte Böden. Wir haben immer noch Probleme mit der Düngung. Das Mittelalter ist immer eine Zeit, in der Dünger fehlt, Düngermangelgesellschaft. Und durch die Landwirtschaft und die Rodung kommt es auch zur Erosion. Was dann unter anderem einer der Gründe ist für die Magdalenenflut 1342, also wirklich eine große Erosion.
Flutkatastrophe in weiten Teilen Europas, überall wo Flüsse zu finden sind, haben wir auch diese Höchststände und die reißen sehr viel Land weg, das einfach nicht mehr gehalten werden kann. Und wir haben jetzt ungefähr das 3- bis 4-fache der Aussaat als Ertrag. Das ist schon viel, wir hatten so im Frühjahr eher so das Doppelte, vielleicht das 3-fache. Es zeigt aber auch, dass wir immer noch eine Wirtschaft haben, die schwer mit Missernten umgehen kann.
Leider hat dieses Bevölkerungswachstum die Nachfrage nach Getreide als Brot- oder Preigetreide sehr, sehr stark gesteigert. Die Viehwirtschaft wurde verdrängt und Viehwirtschaft ist im Grunde genommen gegenüber einer Hungersnot stabiler, denn eine Missernte bringt nicht das ganze Vieh um. Klar, es gibt Seuchen und sowas, aber tatsächlich wäre Viehwirtschaft eine Möglichkeit gewesen, einige Probleme zu vermeiden. Der Ackerbau war aber lukrativer.
Es kommt auch zu einer Ausweitung des Ackerbaus auf schlechte Flächen. Also die guten Flächen sind irgendwann erschöpft, also nämlich minderwertige Flächen, die natürlich auch weniger stabil sind. Der Getreideertrag stagniert in der Zeit sogar. Wenn ich den Getreideertrag pro Hektar errechnen würde, dann würde der in der Zeit tatsächlich stagnieren, teilweise sogar zurückgehen. Und die Gefahr von Hungersnöten durch Missernten ist nicht nur groß, sie kommt dann auch im 14. Jahrhundert. Da haben wir solche Hungersnöte sogar ganz gewaltig.
Gleichzeitig geht der Naturalzins langsam in den Geldzins über. Der Adel hat sich zurückgezogen aus dem Medikationssystem, baut seine Burgen, macht seine höfische Lebensart und würde gerne Geld kriegen.
Bauern werden letztlich zu Pächtern, auch wenn die Freiheitsrechte immer noch kompliziert sind. Das ist erstmal ein sehr gutes Geschäft für die Bauern, denn die Adeligen haben den Wertverfall des Geldes nicht eingerechnet. Also tatsächlich gibt es so eine Krise des Adels, weil die Einnahmen verfallen, denn es ist abgemacht, du gibst mir so und so viel Geld, aber 100 Jahre später ist es halt nicht mehr derselbe Wert, auch im Mittelalter nicht. Und das ist erstmal sehr gut für die Bauern, wird sich auch später drehen.
Im späten Mittelalter kommt es dann eben auch in Folge, erst kommt die große Hungersnot, dann kommt die Pest, es gibt einen Bevölkerungsrückgang und der löst eine Agrarkrise aus. Die Bevölkerung geht zurück.
Der Getreidepreis wird ebenfalls verfällt, weil die Nachfrage geringer wird. Gleichzeitig werden Böden aufgegeben, aber dadurch, dass die schlechtesten Böden zuerst aufgegeben werden. Es gibt auch einen Siedlungsstern, also diesen Effekt der Wüstung, das ist auch etwas, was in dieser Zeit stattfindet. Wie gesagt, die schlechten Böden werden zuerst aufgegeben, dadurch steigt der Getreideertrag wieder.
gleicht für die Bauern erstmal diesen Wertverfall oder diesen Verfall der Getreidepreise aus. Für die Adeligen ist das nicht ganz so einfach. Und dadurch gibt es auch eine neue landwirtschaftliche Diversifikation. Also man kann wirklich sagen, so im 30. Jahrhundert ganz, ganz großer Anteil Getreideanbau. Jetzt haben wir wieder mehr Viehwirtschaft, jetzt haben wir Gartenwirtschaft, Gemüseanbau und solche Dinge. Je nach Region ist es sehr, sehr stark. Und das Interessante ist jetzt durch den Bevölkerungsrückgang, zum einen die Lebensmittelpreise sind relativ niedrig,
Aber es fehlen Arbeitskräfte. Die Bevölkerung ist geringer geworden, und zwar relativ stark in relativ kurzer Zeit. Und die normalen Bauern, die ansonsten sozial eher schwachen, können jetzt in einen Aushandlungsprozess treten und können Rechte abrotzen. Gerade im 14. und 15. Jahrhundert ist das sehr, sehr stark. Die Adeligen müssen da teilweise nachgeben, weil man kann jederzeit anderswo ein Auskommen finden. Wenn ein großer Arbeitskräftemangel da ist, dann kann man überall hingehen. Und dementsprechend werden ganz viele der Arbeitnehmer
Grundherrschaftlichen Rechte eingeschränkt, abgeschafft und man kann sogar sagen, dass in der Zeit die Leibeigenschaft faktisch in weiten Teilen des deutschsprachigen Raums aufhört zu existieren. Die kommt wieder, das wird sich alles nochmal ändern, die Bauernkriege sind ein ganz wichtiger Punkt dran, aber so die Agrarkrise ist so der Kernpunkt des 15. Jahrhunderts.
Es war jetzt so ein kurzer Abriss, wie die bäuerliche Lebenswelt sich entwickelt übers Mittelalter. Jetzt gehen wir mal in die Lebenswirklichkeit. Da gehe ich so ein bisschen von innen nach außen vom Haus.
Dann gehe ich weiter und hier haben wir eben schon ein Bild aus einem Stundenbuch, da sehen wir eine fast schon idyllische Bauernstätte, ein Haus, eine Frau, die Butter darin macht, es gibt Viehwirtschaft, eine Kuh wird gemolken, die Schafe werden auf die Weide getrieben und das sieht jetzt sehr, sehr idyllisch aus, aber das ist gar nicht so weit von der Realität tatsächlich entfernt.
Wir haben bei Bauernhäusern verschiedene Bauweisen. Gibt es auch schon ein Video darüber, wie sind so Bauernhäuser gebaut und da haben wir am Anfang des Mittelalters vor allem Pfostenhäuser. Wie gesagt, die halten nicht sehr lange, die sind noch nicht darauf ausgelegt. Im Verlauf des Mittelalters gibt es dann eben neue Varianten. Es gibt
Ständerbauweisen, teilweise auch Blockbauweisen, auch kombiniert wie hier zum Beispiel. Man sieht hier im vorderen Bereich eine Blockstube, die da zugebaut ist. Oder das berühmte Niederdeutsche Haus, so ein Hallenbau, in dem auch die Ställe integriert sind. Da gibt es wirklich ganz, ganz viele verschiedene Varianten, je nach Region. Aber man sieht eine deutliche Entwicklung im Hausbau.
Und ob es jetzt ein Haus mit integriert im Stall ist oder nicht, das ist wirklich eine regionale Frage. Was so ein Klischee ist immer wieder, dass die Bauern irgendwie in einer kleinen fensterlosen Karte hausen würden. Das stimmt tatsächlich nicht. Da haben wir ganz viele Abbildungen, die das Gegenteil zeigen. So ein Haus ist ein Gewerbebetrieb. Da darf man nicht denken, das sei unterkomplex. Die würden da irgendwie nur hausen und dann irgendwie aus Feld schlurfen. Das ist eine ganz schlimme Vorstellung. Und wie gesagt, auch Stuben werden dann eingebaut. Es gibt auch ein bisschen Luxus in den
Und das hier ist zum Beispiel eine mittelalterliche Stube in einem Bauernhaus in Südtirol, in der Nähe von Klausen. Klar, da sind spätere Teile dazugekommen, aber zum Beispiel diese Wandverkleidung, diese Wandverteflung, das ist mittelalterlich. Und sowas findet man eben in Bauernhäusern. Natürlich auch vom sozialen Status des jeweiligen Bauern abhängig, aber man darf eben nicht denken, das sind alles bis ins späte Mittelalter hinein irgendwelche halb improvisierten Bauten. Nein, nein, das sind schon ordentliche Häuser, die dauerhaft da stehen.
Und die Ausstattung ist erst recht ein Spektrum. Wie müssen wir uns das vorstellen? Das ist von rauchgeschwärzter Raum mit wenig Ausstattung bis hin zu Blumen an den Fenstern und Kachelofen ein riesiges Spektrum, in dem wir uns bewegen und alles davon ist real, alles davon werden wir finden, denn auch Bauern können wohlhabend sein, Bauern können aber auch bettelarm sein.
Und die bäuerliche Familie, die sich so mit diesen Dörfern entwickelt, so raus aus dem Billigationssystem, man ist zwar noch abhängig, aber jetzt haben wir eben auf diesen Höfen, die entstehen, die bäuerliche Familie als Gesamtheit, da ist natürlich auch Gesinde, Knechte, Mägde und sowas dabei. Und da gibt es einen schönen Begriff, die ist patrilokal. Das bedeutet, der Mann bestimmt, wo sie wohnt, denn die ist sesshaft, die gehört, ist an ihre Scholle gebunden, auch weil
Ist zur Agrarkrise, ist schwer was anderes zu kriegen. Und die Frau zieht zum Mann, zum Erben. Wer nicht erbt, hat teilweise Pech gehabt, muss sich anders aussuchen. Aber das ist wirklich so eine, über den männlichen Erben, eine Tradierung dieser Familie an einem Ort. Der Sohn übernimmt dann den Hof, alle anderen müssen sehen, wo sie bleiben. Außer wir haben einen Realteil und dann gibt es mehrere Söhne.
Diese Ehe wird auch lange ohne Priester geschlossen, gerade auf dem Dorf, das ist so eine Entwicklung, dass die Priester da Teil davon sind, letztlich ist es eine Absprache zwischen Familien, bei Leibeigenen, bei wirklich Unfreien ist auch der Grund hier oft noch hinzuzuziehen, wen darf so ein Leibeigener heiraten und
Es gibt auch in uns sehr wenig Mobilität in der Wahl des Wohnortes. Also sowohl innerhalb des Dorfes, weil man eben Hof übernimmt, aber auch ansonsten. Man geht selten in die Ferne. Also man heiratet zwar gerne mal außerhalb des Dorfes, aber irgendwie jetzt außerhalb einer Siedlungsbewegung irgendwie ganz weit in die Ferne zu gehen, eher unüblich. Das, was wir heute normal haben, irgendwie ich ziehe jetzt in die Stadt oder sowas, das ist damals noch völlig unbekannt. Und zu dieser Familie gehören eben auch Nicht-Familienmitglieder.
Ich habe erstmal natürlich das Familienoberhaupt, den Bauern im eigentlichen Sinn, dann gibt es oft noch Eltern, einen alten Teil, ein ganz wichtiger Teil zu einer bäuerlichen Familie und eben Knechte, Mägde, sonstiges Gesinde. Das können auch Verwandte sein, die eben kein Erbe haben oder sowas, müssen es aber nicht und die zusammen bilden eben den Haushalt.
Und es ist vor allem eine lohnlose Art der Bewirtschaftung. Keiner von denen bekommt üblicherweise Geld. Das ändert sich auch in der Agrarkrise. Da gibt es eben Auslandungsprozesse, da muss man auch mal Geld zahlen. Aber im Grunde genommen ist das nicht Ziel des Ganzen, sondern man lebt in der Familie, man wird versorgt, man bekommt eigentlich alles, was man braucht, je nachdem wie gut er her ist oder schlecht. Aber die bäuerliche Kultur des Mittelalters ist erstmal eine lohnlose Gesellschaft. Das Haus- oder Hofrecht gibt dem Land,
Bauern, dem Herrn dieses Haus oder Hofes auch weitreichende Rechte, sowohl über seine Familie, Frau und Kinder als auch über sein Gesinde, also irgendwie Strafen darf der aussprechen, das ist völlig normal, erst außerhalb des Hauses, außerhalb der Familie beginnt dann Dorfrecht und ähnliches Recht, klar es gibt dann noch Strafrechte oder sowas da rein gehen könnten, aber tatsächlich so ein Familienvorstand hat wirklich weitreichende Rechte.
Bewegen wir uns aus dem Haus hinaus, sind wir auf dem Hof oder im Garten. Je nachdem, wie die soziale Stellung ist, ist das eine ganz wichtige Unterscheidung. Und Garten kommt vom indogermanischen Gato, Kato und bedeutet Schutz. Ein Garten ist ein eingehegter Bereich, mit einer Hecke oder einem Zaun umgeben und auch der hat eine besondere rechtliche Stellung. Das ist ähnlich wie das Haus.
Ein abgetrennter rechtlicher Bereich. Und hier auf diesem Bild sieht man eine Rekonstruktion eines Dorfes, das benutze ich häufiger mal, und da sieht man tatsächlich, wie wichtig dieser Gartenteil daran ist. Also da hatten wir so kleine Höfe mit Häusern, Nebengebäude und dahinter beginnt dann der eigentliche Garten als Wirtschaftsteil, werde ich gleich auch nochmal über die Bedeutung des Ganzen kommen. Und in diesem Garten wird alles mögliche angepflanzt. Hier gilt noch als Garten.
wird nicht groß auf Feldern angeboten, Rüben gehören dazu, Hanf und Flax, also typische Textilpflanzen, Erbsen, Bohnen, Linsen, Kohl gilt als Gartenpflanze, Kräuter, Färbepflanzen, all das sind Sachen, die im Garten zu finden sind und der Garten ist auch so auf dem Land das Minimum. Wenn ich das nicht habe, dann bin ich wirklich unter so sozialer Schicht. Neben den Vollbauern, die einen Hof haben,
Mit Haupthaus, wenn es nicht integriert ist, auch Stall, Scheune, Werkstatt, Nebengebäude, Altenteil. Gibt es eben auch Landbewohner, die nur das Haus oder die Karte haben, wenn ich gleich bei den sozialen Dingen nochmal drauf komme und eben ihren Garten. Der Garten ist, abgesehen von den Feldern, auch das, wo man einen guten Teil seiner Nahrung herholt. Vor allem den geschmacklichen, wichtigen Teil der Nahrung.
Es ist dann ein ganz großer Irrtum zu glauben, dass ein Hof irgendwie wenig Geräte hätte, dass so ein Bauer nicht viel besitzt. Ich erzähle immer wieder gerne, ich hatte mal ein Kinderbuch, da wurde ein Umzug einer Bauernfamilie gezeigt und die hatte so einen Handkarren. Ein Mittelalter hier
Hofbetrieb ist wirklich, wirklich komplex. Moderne Landwirtschaft ist oft sehr spezialisiert und auch nicht wirklich auf Selbstversorgung ausgelegt. Gibt natürlich auch da ein breites Spektrum, aber im Extremfall ein moderner Landwirt holt seine Nahrung genauso aus dem Supermarkt wie du und ich und sein Produkt verkauft er, dass es das wovon erlebt.
Im Mittelalter ist ein Hof vor allen Dingen selbstversorgend. Nicht unbedingt ausschließlich, das habe ich ja gerade mal gehabt, dass es immer weniger wird, aber vor allen Dingen in Bezug auf Handwerk, auf Produktion, auf Werkzeuge ist er mehr oder weniger selbstversorgend. Holz ist dann ein ganz wichtiger Punkt. Viele Arbeitsgeräte sind anfangs aus Holz, selbst der Pflug mit der Pflugscheiße am Anfang aus Holz zu finden und so ab dem 12. Jahrhundert haben wir immer mehr Eisen. Sicheln, Messer,
Rebmesser, Sense, Pflug ist vielleicht der wichtigste Eisennutzer auf dem Land. Spaten, Teile von Zuggeschirren, Werkzeuge, zum Beispiel für Leinenverarbeitung, da wird Metall immer wichtiger. Und eben der Pflug ist da ein ganz herausstechender Punkt. Hier haben wir noch den alten Hakenpflug. Das ist der Pflug, wie wir ihn am Anfang des Mittelalters kennen. Der ritzt die Oberfläche mehr oder minder auf. Und es ist zum Beispiel nötig, auch nochmal quer zu pflügen, um die Erde ordentlich zu lockern. Das ist jetzt ein Bild noch aus dem 13. Jahrhundert in England. Da ist der noch in Gebrauch.
kann auch nicht sehr tief pflügen, im Mittelmeerraum ist er ein bisschen in Neuzeit verbreitet. Die Böden da sind anders aufgebaut, vor allem da ist ein Problem die Verdunstung, da ist dieses eher oberflächige Arbeiten sogar vorteilhaft, diese nicht komplette Wänden, damit eben weniger Feuchtigkeit verloren geht. Bei beiden Pflugarten gibt es als Innovation im Mittelalter den Räderpflug, der die Zugtiere etwas entlastet, die Kraft in die richtige Richtung führt und bei uns wird dann der
Betpflug oder Schwerepflug ganz wichtig. Der ist seit der Antike bekannt, aber erst seit dem zehnten Jahrhundert verbreitet er sich wirklich. Er hat als Besonderheit ein Streichbrett oder ein Streichblech, das eben den Boden einmal komplett umwirft. Aufgeschnitten und einmal komplett gewendet. Das ist zum einen sehr gut gegen Unkraut, hat sonst noch ein paar Vorteile und ist eben in der Lage diese schweren Niederungsböden im Tiefland zu bearbeiten. Das ist also die Böden, die wir hier bei uns in der Region haben.
Dazu ist eine bessere Anspannart notwendig. Hier sieht man noch Ochsen, ist immer noch beliebt, aber auch Pferde werden immer wichtiger. Durch das Komet kann deren Kraft besser übertragen werden. So ein Pferd hat am Ende ungefähr dieselbe Zugkraft wie ein Ochse, aber das Pferd ist dabei schneller und ausdauernder. Also das Pferd ist tatsächlich im späten Alter das beliebtere Zugtier. Finden wir auch ganz viele Quellen. Hier haben wir zufällig gerade mal Ochsen, aber nachher werden wir noch mehrere Bilder mit Pferden sehen.
Und erst im 15. Jahrhundert wirklich setzt sich das umsetzbare Streichblech durch. Dadurch kann ich dann in beide Richtungen flügen. Hier bei diesem Pflug habe ich das Problem, dass der nur in eine Richtung die Krumm quasi auswirft und dann muss ich auf meinem Acker eine Leerfahrt zurück machen, um die nächste Pfirsche ziehen zu können. Ich kann das nicht kreuz und quer machen, sonst würde ich mir meine Pfirsche einfach wieder zuschütten. Wäre ja Quatsch. Ähm...
Tatsächlich ist es so, dass im Mittelalter lange Zeit nur in eine Richtung gepflügt wird. 1500 ändert sich das, dann kann ich es eben umsetzen, bis heute quasi und kann zurückpflügen. Das klingt wirklich schräg, ist aber tatsächlich so. Aber auch sonst haben wir Großgeräte, also Ecken werden verwendet. Hier noch eine rein hölzerne Ecke,
vor der Aussaat nochmal den Boden auflockert. Wagen ist ein ganz wichtiger Punkt. Hier sieht man auf der anderen Seite des Flusses so einen Wagen mit der Getreideernte beladen. Also wirklich große Wagen, die massiv Material transportieren könnten, oft auch im Dorfbesitz und so. Ist ganz, ganz wichtig für die Landwirtschaft. Also ohne solche Wegen eine ordentliche Landwirtschaft zu machen, wäre ja fast unmöglich. Wer will die ganze Ernte zum Dorf zurücktragen? Aber auch eben so Sachen wie Weinkälter, äh,
und ähnliches, was lange eben auch im grundherrschaftlichen Besitz war, ist oft im bäuerlichen Besitz. Und wenn man sich so eine Weidenkälte anguckt, also so eine Spindelpresse, dazu muss man auch erstmal die Infrastruktur haben. Das sind Sachen, die auf dem Dorf absolut zu finden sind. Zur Dorfverfassung habe ich schon ein Video gemacht, also jetzt gerade vor gar nicht langer Zeit. Da will ich jetzt gar nicht groß drauf eingehen, wie da die Herrschaftsformen und sowas sind. Das ist alles schon...
erklärt worden. Hier geht es tatsächlich um die Lebenswirklichkeit des Bauern. Aber wenn wir uns das Dorf dann angucken, der nächste Schritt, nachdem wir Hof und Garten verlassen haben. Hier habe ich ein Bild aus dem 16. Jahrhundert und da kann man fast schon die idealtypische Dorfaufbau sehen. Wir haben eine Kirche in der Mitte mit Friedhof. Jetzt durch den Dorf, ein Dörfer ist der Friedhof ins Dorf hineingezogen und darum sind die einzelnen Gebäude immer noch, wie man eben auch gut sehen kann, mit dem eigenen Garten eine eigene Umzäunung.
Und je nach Bauform ist hier so ein Haufen Dorf relativ zufällig entstanden. Da sind die Gärten und Höfe direkt beim Gebäude, manchmal sind sie auch eher als Ring darum aufgebaut. Dazu zu diesem Dorf gehört dann eben auch die Almende, das wirkliche Gemeingut, so der Anger in der Dorfmitte, die Kirche, Friedhof, Brunnen.
Und wenn es vorhanden oder wenn es sie gibt, auch Gemeinschaftsgebäude wie Speicher, große Scheune und ähnliches. Um das Dorf herum ist dann das Ackerland. Oft gemeinschaftliches Ackerland ist, also die Bauern haben zwar Anspruch auf ihr eigenes Land, die haben ihre Hufnummeranzahl, ihre Morgenanzahl, aber all diese Gebiete werden zusammengefasst und gemeinschaftlich bewirtschaftet. Da werden Zelgen gebildet, sieht man hier auf dem Bild auch ganz gut.
Oberer, unterer und äußerer Zelg. Die Dreifelderwirtschaft wird auf diese Zelgen umgesetzt. Jeder Bauer hat jetzt auf diesen Zelgen schmale Streifen, um sie zu bearbeiten. Die schmalen Streifen ergeben Sinn wegen der Probleme mit dem Pflug und Wenden. Das heißt, ich kann lange Bahnen ziehen und kann besser pflügen. Das Ganze hat natürlich mehrere Probleme. Das sind keine Wege dazwischen. Ich komme nur an eine Zelge zum Bearbeiten, wenn ich über die meiner Nachbarn fahre.
Dann brauche ich Termine, wann darf ich arbeiten, wann muss ich arbeiten, wann muss ich ernten, wann muss der Stoppelacker fürs Vieh bereit sein und so etwas. Einzäunungen dieser Zelgen sind notwendig, damit eben der Saatgut geschützt wird zum Beispiel. Die Ernte findet auch gemeinschaftlich statt. Das alles führt dazu, dass es sogenannten Flurzwang gibt, also Flurzweige.
Das Dorf schreibt mir vor, wann ich wo was anzupflanzen habe. Letztlich bin ich Teil einer Kommune beinahe, die gemeinschaftlich arbeitet. Das ist auch der Grund, warum die Bauern immer wieder gerne auch ideologisch verwendet werden. Entweder als harte Wehrbauern gegen Angreifer von außen oder als frühkommunistische Idylle. Nichts davon ist letztlich richtig. Also das ist alles geregelt. Als Bauer in so einer Zellgenwirtschaft bin ich ein Rad im Getriebe, wenn ich Bauer bin.
Darunter gibt es eine Menge, die das nicht haben. Besiedlungsdörfer sehen oft ein wenig anders aus. Hier haben wir diese Zelgen nicht, sondern wir sehen hier in der Mitte dieses Straßendorf. Straßendorf ist sehr, sehr beliebt als Siedlungsdorf, weil vorhandene Straßen eben besiedelt werden. Und hier hat jeder sein eigenes Stück Land, das aber als langer, teilweise kilometerlanger Streifen hinter dem Haus direkt liegt. Das ist aber wirklich Haus, dann hat man Garten und dann kommt dieser eigene Landstreifen. Das ist eben da auch...
im ostdeutschen Raum relativ verpreist, weil da eben diese Ostbesiedlung stattgefunden hat. Das ist so eine Alternative dazu. Und außerhalb des Dorfes und abseits dieses gemeinschaftlich bewirtschafteten Ackerlandes
haben wir dann die eigentliche Almende. Almende ist der Gemeinbesitz mit der Entwicklung der Dörfer, übernehmen die auch Teile des Landes drumherum. Der wird ebenfalls genossenschaftlich genutzt, wo man da unterscheiden muss. Zur Almende gehören vor allen Dingen Wege, teilweise Gatter und Zäune, Obstgärten, Wald teilweise, der auch als Hutewald verwendet werden kann. Also hier haben wir entweder ein
Obsthain oder eben so ein Hutewald, der auch als Weidegebiet verwendet wird. Wir haben Gewässer, die bearbeitet werden und die genutzt werden, eben das auch oft genossenschaftlich. Wiesen und Weideflächen gehören dazu. Übrigens hier ein sehr schönes Detail auf der rechten Seite, diese Bäuerin mit dem Krug auf dem Kopf, die gerade über den Zaun steigt, da ist extra so eine leichte Erhöhung, das ist ganz häufig, also diese Weideflächtsäune müssen in Europa sehr verbreitet gewesen sein und da gibt es dann kleine Leiterchen, da gibt es solche Tritte, da gibt es Drehkreuzdurchgänge, alles um das Vieh unter Kontrolle zu halten.
Im Alpenraum, zumindest der Teil, der schon besiedelt war, auch sowas wie Almen sind ebenfalls oft Almendegebiete. Oder im Nordengebiet, auf dem Torf gestochen wird, das sind oft so genossenschaftlich bewirtschaftete Almendeteile. Dazu gehören auch zeitlich begrenzte Betriebe, denn wie gesagt, solange diese Dörfer auf Selbstversorgung ausgerichtet sind, gibt es ja auch Betriebe, die ich immer wieder brauche. Zum Beispiel Metallherstellung. Ich habe damals ein Video gemacht mit Armin Torkler über Bergbau im Mittelalter, da hat er ganz klar gesagt,
Im Business-Hochblatt hinein ist das eine Sache des Bedarfs. Wenn ich jetzt Stahl brauche, dann fange ich an, Raseneisenerz zu suchen und einen primitiven Ofen, ein Rennfeuer anmachen und dann wird das Ganze angefacht. Dazu gibt es aber auch Sachen wie Kalkbrennereien, Steinbrüche und sowas, die es im Umfeld von Dörfern gibt, die aber eben nicht durchgehend benutzt werden, weil eben die Nachfrage wichtig ist. Es gibt keinen Markt, an dem ich Überschüsse abführen könnte, also werden solche Betriebe oft nur zeitweise verwendet.
Teile dieser Almende sind aber nur für Inhaber von Hofstellen nutzbar. Wenn wir gleich bei der sozialen Diversifikation nochmal haben, nicht jeder Bauer oder nicht jeder Dorfbewohner hat eine eigene Hofstelle, hat einen eigenen Hufen, gilt als Vollbauer. Die, die das nicht haben, die Häusler, Karten und ähnliches, die haben auch nicht vollen Anteil an der Nutzung der Almende. Es gibt Teile, die kann jeder verwenden, es gibt Teile, die kann nicht jeder verwenden.
Die Almende führt dann in der frühen Neuzeit auch zu großen Problemen, gerade Bauernkriege. Wer da letztes Mal zugehört hat, diese Forderungen der Bauern, da geht es ganz viel um den sogenannten Almenderaub, denn die Adeligen versuchen die Almende an sich zu bringen. Verschiedene Arten und Weisen, da werden Jagdverbote für alle Wälder ausgesprochen, da wird Almendeland in Weideland für die herrschaftlichen Viehherden umgearbeitet.
Es wird am Ende eingezogen in allen möglichen Varianten. Das ist tatsächlich auch eine ganz, ganz wichtige Motivation hinter den Bauernkriegen.
Und die Dorfgemeinschaft, die eben auch über die Allmende verfügt, die übernimmt nach und nach auch grundherrschaftliche Aufgaben. Die Durchsetzung eben dieses Flurzwangs, der Flurordnung, Abgaben werden eingetrieben, teilweise durch Meier oder Dorfschuld vom Grundherrn eingesetzt. Mit der Zeit sind es aber immer mehr Leute, die aus der Dorfgemeinschaft gewählt oder ernannt werden. Also das ist tatsächlich so, dass die sich selbst organisieren.
Und anstelle der Beziehung zum Grundherrn für die einzelnen Bauer, tritt die Beziehung vom Dorf zu dessen Vertretern. Also es gibt dann den Ansprechpartner, der normale Bauer, der seine Abgaben erfüllt hat, eigentlich damit gar nichts mehr zu tun. Das ist alles eine Sache der dörflichen Organisation. Und auch Teile der Gerichtsbarkeit gehen aufs Dorf über. Hier haben wir so eine Dorflinde, die haben wir relativ häufig mit dem Dorfgericht, ein
Ein Dorfvorsteher, ein Dorfrichter, es gibt Oberschicht im Dorf, die als Schöffen in Frage kommen, die sogenannten Schöffenbaren. Also solche Dorfgerichte haben wir im Spätmeld auch relativ häufig, die dann eben, klar, die sind nicht für Strafrecht oder ähnliches zuständig, aber die normalen Streitereien, die werden von denen geregelt. Auch das bricht dann in der frühen Neuzeit mehr und mehr ab, weil es durch Beamte ersetzt wird, durch Strafrecht.
Die Stärkung der Landesherren, der Territorialadlinge, die ihre eigenen Beamten einsetzen, fällt auch das nach und nach weg, was auch in den Bauernkriegen massiv kritisiert wird.
Und abseits, wir sind jetzt eben vom Haus über den Hof und Garten zum Dorf und die Umgebung gegangen, was in dem Ganzen noch so ein bisschen als Fremdkörper ist, zum einen der herrschaftliche Besitz, die Herren haben immer noch Dinge darin, ganz wichtig, eben eigene Weideflächen, Wald, sogenannte Herrenwald oder Bannwald, auch für Jagd genutzt, da muss man wirklich unterscheiden, Wald, der vom Dorf genutzt werden darf, Wald, der vom Herrn genutzt wird, Mühlen ganz wichtig, die Mühlen bleiben eigentlich immer im herrschaftlichen Besitz,
Es gibt Wege, gerade die besser ausgebauten Wege, die herrschaftlicher Besitz sind, Brücken, Meierhöfe, Zehnscheunen, in die eben die Abgaben zusammengetragen werden, die sind immer noch da, aber es gibt auch Klerikalenbesitz auf dem Dorf. Die Kirche fällt einem als erstes ein, eventuell als Wehrkirche ausgebaut, also auch als leichte Befestigung.
Ein Friedhof dazu, eventuell sogar ein Klosterhof, der zwar nicht von Mönchen direkt bewirtschaftet wird, wo aber eben auch die Abgaben des Klosters eingezogen werden und sowas. Bilderstöcke findet man immer wieder oder Kapellen, also kleinere Andachtsorte drumherum und eben der Pfarrhof, da wo wirklich der Pfarrer lebt und eben das auch bewirtschaftet, der eben auch den Zehnt einzieht. Der Zehnt ist ja die Abgabe an den Klerus ursprünglich, das steht dem Ganzen zu, also auch klerikalen Besitz gibt es im Dorf außerhalb dieser dörflichen Organisationen.
Und weil wir jetzt schon mehrfach auf diese sozialen Schichten eingegangen sind, will ich die gerne ein bisschen auseinanderklabüstern. Wir haben schon im Willikationssystem Unterschiede. Da gibt es im Grunde genommen alles entweder Unfreie am Hof oder eben die Inhaber der Bauernstellen, aber da gibt es schon verschiedene Vor- und Nachteile.
Die Hofstelleninhaber, die können unabhängiger agieren, die sind in der Lage eigene Rücklagen zu bilden und agieren schon ein bisschen wie die Bauern später. Die Servi auf dem Hof dagegen sind nah am Herrn. Die können auch aufsteigen, also auch gerade so die Ministeriale rekrutieren sich teilweise aus diesen Servi, weil sie eben direkt mit ihrem Herrn zusammenarbeiten und mit der Dorfverfassung zusammenarbeiten.
weiten sich die sozialen Unterschiede dann aus. Hier haben wir ein berühmtes Bild von Albrecht Dürer, da sieht man eben Bauern und das erste was auffällt, der eine hat ein Schwert vor sich, der andere hat ein dickes Messer am Gürtel, das ist schon so eine gewisse Krabbitasse, die die mitbringen, die sind schon wer und dementsprechend, wir haben auf dem Dorf große soziale Unterschiede. Es gibt Dorfvorsteher, entweder die, die früher ernannt wurden, teilweise ist es dann erblich geworden,
werden eben aus den Reihen der Bauern gewählt. Dazu eben die Meier, die direkt für die Grundherren arbeiten auf größeren Höfen, die Schöffen waren, Teil des Dorfgerichts sind. Das sind alles Vollbauern. Die haben eine Hufe oder mehr, teilweise auch mehrere Höfe. Da sind auch die sozialen Grenzen teilweise sehr, sehr dünn. So die Tochter eines Meier kann auch durchaus die
einen Ritterbürtigen heiraten oder so etwas. Es gibt auch einen ganz berühmten Roman über den Meier Hellenbrecht, der eben Sohn eines solchen Meier ist und in den Ritterstand gerne aufsteigen würde, wird am Ende Raubritter und hat ein übles Schicksal, aber diese Grenzen sind nicht so stark, wenn man es denken sollte. Ob diese Vollbauern das auf Dauer bleiben oder nicht, ist eine ganz wichtige Frage des regionalen Rechts. Wir haben da zwei große Rechtsfamilien, germanisches Recht, auch wenn man da nicht irgendwie denken sollte, es sei uraltes Stammesrecht, aber
Die Rechtsfamilien sind da das sächsische und das fränkische Recht. Und das fränkische Recht sieht die Realteilung vor. Das heißt, wenn ein Inhaber eines Bauernhofes stirbt, dann erben alle Söhne gleichmäßig. Der Hof wird aufgeteilt. Im sächsischen Recht gibt es die geschlossene Hoffolge. Das heißt, das Land bleibt zusammen. Für Meierhöfe zum Beispiel gilt das immer. Das ist so ähnlich, wie wir es bei den Kurfürsten kennen. Da ist das auch unteilbar. Meierhöfe bleiben auch zusammen. Das ist so eine Besonderheit. Aber je nachdem, wo man lebt, ob jetzt fränkisches oder sächsisches Recht gilt,
ist es ein massiver Unterschied. Und da, wo das fränkische Recht gilt, da haben wir auch im Verlauf des Mittelalters und auch in der Neuzeit winzig kleine Bauernstellen. Also überhaupt nicht mehr genug, um eine Familie durchzubringen. Die müssen dann Nebentätigkeiten machen. Und durch diese Teilung nimmt natürlich die Anzahl von Hofstellen immer mehr zu.
Unterhalb dieser Vollbauern haben wir dann ganz viele Begriffe. Das können Halb-, Viertel-, Achtelhufner sein, werden Häusler oder auch Kartner genannt, teilweise auch Kötter, Hintersassen, Kleinbauern. Es gibt da alle möglichen Begriffe zu. Auf dem Bild sieht man auch dörfliche Handwerker. Da sieht man einen Wagner, der ein Wagenrad herstellt. Ein Bootsbauer, ein Schäfer oder ein Viehhirt in dem Fall ist auch ein Beruf auf dem Dorf. Vorne sieht man eine Drechselei, also Alarmstelle.
alles Berufe und in den Städten sind Handwerker ja relativ hoch angesehen, in den Dörfern ist es umgekehrt. Das sind eigentlich eher Kleinbauern, die nebenher ein Handwerk betreiben. Die können erfolgreich sein, die können sich unentbehrlich machen, aber grundsätzlich sind sie nicht Teil der dörflichen Oberschicht. Und darunter kommen dann auch Tagelöhner, Knechte und Märkte. Und da kann man ein bisschen gucken, wie leben die? Also es gibt eben die Hofbauern, ob es jetzt eine Vollstelle ist oder eine Teilstelle, die wirklich einen Hof haben, den sie bewirtschaften, eventuell auch mit Gesinnem.
Die Häusler haben kein großes Gesinde, die haben vielleicht ein bisschen Land, die haben einen Garten, aber die haben keinen eigenen Hof. Darunter kommen dann die Kartner, die haben überhaupt nur noch eine Karte, ein kleineres Haus und einen Garten. Tagelöhner teilweise wirklich nochmal ohne Garten dazu und Knechte und Nägde haben gar keinen eigenen Besitz, die leben auf dem Besitz eines anderen, die sind Teil eines Haushalts eines anderen und haben dann tatsächlich überhaupt keinen eigenen Haus.
Das Land oder so und die sind auch nicht Teil der Dorfgemeinschaft schlechthin. Also die werden vertreten durch ihren jeweiligen Herrn, aber die haben in den ganzen kleineren, natürlich regional wieder extrem unterschiedlich, wie das ausgeteilt ist, aber man kann sagen, im Grunde genommen die Vollbauern und vielleicht noch die Halbhufler oder sowas, die haben wirklich was zu sagen im Dorf. Alle anderen sind nicht Teil der Dorfgemeinschaft und haben oft auch nur einen begrenzten Zugriff auf die Almende.
Ein anderes soziales Kriterium kann die Anzahl von Vieh sein, vor allem Ochsen und Pferde. Da gibt es dann teilweise Gespanne als Angabe, also wie viel Gespanne hat ein Bauer oder hat er überhaupt einen Gespann, dann hat er gewisse Rechte und Pflichten. Kleinbauern haben auch oft Land, das dann gar nicht Teil der Zelgen ist, also es gibt Regionen, wo sie sogar daraus ausgeschlossen sind, dann haben wir zu diesem Gespann.
Dorf, Ackerland, noch kleinere Ackerstücke, die eben den Kleinbauern gehören, aber nicht in der Zelgenwirtschaft bearbeitet werden. Und dadurch ist sowohl bei der Nutzung der Almende als auch bei der Teilhabe an der Macht im Dorf der Stand sehr, sehr wichtig. Also auch innerhalb des Dorfes haben wir starke Standesunterschiede.
Die Bauern an sich sind aber auch nochmal ein Stand, der dritte Stand, der als niedriger Stand gilt und das ist ein ganz spannendes Thema, wenn wir zur Kleidung kommen. Kleidung hatten wir eben schon mal, da sehen wir auch so ein paar Besonderheiten, eher robuste Kleidung, man sieht hier auch so eine weite Gugel, die weit herabhängt und die Kleidung ist nicht sehr modisch, es gibt keine Ausschnitte und so etwas.
Zum großen Teil in der bäuerlichen Welt des Mittelalters wird Kleidung selbst hergestellt. Das findet sich auch schon auf Darstellungen von Adam und Eva. Adam bearbeitet den Boden, Eva spinnt. Die Kleidung ist in der Regel aus Leinen oder Wolle. Das sind die wichtigen Fasern des Mittelalters. Später gibt es auch zusätzliche Stoffe. Es gibt so Sachen wie Haken, Nestl, Spitzen und ähnliches, die durch Hausierer in die Dörfer kommen. Das ist ein ganz lustiges Bild aus Italien. Da wird gerade ein solcher
fahrende Händler von Affen ausgeraubt, da sieht man was der alles dabei hat, also alles mögliche, aber da haben wir eben dann auch eine Anbindung der Dörfer an Märkte und so Sachen der Mode kommen auch in den Ort, auch Gürtel werden wir gleich mal eine schöne Quelle zu haben. Im Kern kann man sagen, ein Bauer trägt das, was in seinem Haushalt, in seinem Haus hergestellt wird. In einem Buch, das ich herangezogen habe für diesen Film, habe ich folgenden wunderschönen Satz gefunden:
Der größte Teil der bäuerlichen Kleidung wurde in den Bauernfamilien selbst angefertigt. Die auf diese Weise in Heimarbeit hergestellten Kleider waren durchweg von grober Qualität und wurden sehr lange getragen, sodass sie dem Außenstehenden einen sehr abgenutzten Eindruck vermittelten. Das ist keine Quelle, das ist Meinung. Meinung dieses Historikers. Warum ist diese Kleidung von grober Qualität? Und warum wird sie sehr lange getragen und hat einen abgenutzten Eindruck? Das ist so ein Ding, das kann man so schreiben, aber die machen das seit Generationen.
Das ist ein grundsätzliches Irrtum im Gedanken, denn die meisten Stoffe werden erstmal so hergestellt, auch später, wenn Stoffe im Verlagssystem in ganz Europa hergestellt werden, sind es immer noch bäuerliche Handwerker, die das zum großen Teil machen. Und warum soll das eine schlechte Qualität haben? Die wissen doch, was sie tun. Im Gegenteil, nach allem, was wir wissen, sind die mittelalterlichen Stoffqualitäten sogar ziemlich gut und...
Gerade so Wolle abgenutzt aussehen zu lassen, das ist gar nicht mal so einfach. Also spreche ich aus Erfahrung als historischer Darsteller, mit guten Wollstoffen kommt man sehr sehr weit und dieser Umstand, dass die das selbst herstellen, den kann man auch genau andersrum deuten. Den kann man auch eben so deuten, dass sie wussten, was sie taten und diese bäuerliche Kleidung im Gegenteil eine vergleichsweise gute Qualität hatte.
Was ja bekannt ist, sind Kleiderverordnungen. Man hat versucht, diesen Stand der Bauern abzugrenzen. Also die Städte haben das getan, der Adel hat das getan. Und schon in der Kaiserkronik vom Pfaffen Konrad Mitte des 12. Jahrhunderts, die angeblich auf Erlass von Karl dem Großen fußt, was sie nicht tut, wird schon gesagt, dass Bauern vor allen Dingen schwarze, in dem Fall also naturschwarze Stoffe von schwarzen Schafen und graue Kleidung tragen sollen, nicht mehr als sieben Ellen Tuch für Hemd und Hose und Schuhe aus Ränseln.
Und in einem Bayerischen Landfrieden von 1244 wird gesagt, keine kostbaren oder bunten Stoffe, nur billige Stoffe und graue Farben. Den Bäuerinnen wurde verboten, Seidenbesatz zu tragen. Seidenbesatz, okay. Auch kostbare Kopftücher durften sie nicht tragen. Die Haare der Männer durften nur bis zu den Ohren gehen. Das hört man immer wieder, dass die Bauern irgendwie kurzgeschoren werden sollten. Aber solche Quellen sind zwar nicht unzuverlässig, aber es sind immer nur eine Momentaufnahme. Da muss man schon sehr viel breiter gehen.
Gleichzeitig bemängelt Neidhard von Reuental, hier ist ein Bild aus der großen Heidelberger Liederhandschrift, dass die Bauern modische Sokos tragen würden, am Halsausschnitt mit glänzenden Knöpfen besetzt, teure Gürtel, die Frauen würden kostbare Spangen im Haar tragen, Seidenschleier tragen und Gürtel mit Perlen besetzt sein. Das ist natürlich auch zum Teil Satire, aber ganz falsch dürfte es nicht sein, denn tatsächlich die bäuerliche Oberschicht, die ist wohlhaar.
Die kann sich das durchaus leisten. Auch im 15. Jahrhundert heißt es noch ständig, dass die Bauern über ihre Verhältnisse leben würden, dass sie nicht mehr wie früher züchtig und bescheiden auftreten würden, sondern beim Prunk mit dem Adel in Konkurrenz treten würden. Also es ist so ein Dauerthema. Es ist so ein bisschen...
Kulturpessimismus, die Bauern tun nicht mehr, was sie eigentlich sollten. Warum sollten sie von Anfang an? Und man sieht eben auch hier auf diesem Bild aus dem 16. Jahrhundert, die tragen durchaus modische Dinge. Also Bauer zu sein heißt eben nicht abgerissen herumzulaufen oder in einfachen Kitteln, auch wenn einige in der Gesellschaft sich das gerne so wünschen würden. Ein ganz wichtiger Punkt, der natürlich auch immer wieder gefragt wird, was essen Bauern so? Und da muss man jetzt sagen, die Quellen sind eher dürftig.
Wenn man auf einzelne Rezepte geht, wir wissen aber eher viel darüber, wie sie gegessen haben und das habe ich schon ganz, ganz oft gesagt, man muss sich das Essen im Mittelalter eher so vorstellen wie heute noch auf weiten Teilen der Welt. Es gibt ein Nährmittel, das kann Brei oder Brot sein, das ist ein sehr weites Feld und es gibt dazu Geschmacksstoffe.
Das habt ihr überall. Ob ihr in den Fernosten geht mit Reis als Nährmittel und irgendwelchen Soßen, Fleisch und sonstigen Gerichten dazu. Oder in Indien hat man Fladenbrot oder eben auch Reis. Im arabischen Raum hat man Sachen wie Hummus, Couscous, Bulgur.
Gibt's ganz viele verschiedene Varianten, aber es ist immer so, dieses Grundmaterial wird mit Geschmack versehen. Auch das haben die Menschen im Mittelalter genau so gemacht. Und wir haben erstmal verschiedene Breigetreide. Gibt's sowas wie Hirse, sieht man eben hier, vor allem eine Gartenfrucht, sehr, sehr beliebt.
Gerste wird ganz ähnlich verwendet, auch vor allen Dingen für Brei verwendet. Kann alles auch anders verwendet werden, aber es sind die hauptsächlichen Dinge. Und sowas wie Hafer und Gerste sind typische Sommergetreide. Werden wir gleich im Jahresablauf nochmal drauf kommen. Das wird eben im Sommer ausgesät und dann im selben Jahr auch noch geerntet.
Hier sieht man auch genau so eine Mus-Zubereitung, so eine Brei-Zubereitung. Das ist hier ausgerechnet Weizenmus, ein bisschen unglücklich, weil Weizen ist eigentlich eher ein Brotgetreide. Und unter diesem Mus muss man sich eine Menge vorstellen. Es kann ein schnittfester Ding sein. Heute können wir sowas wie Polenta, heute aus Mais, früher aus Weizen, kann schnittfest sein. Es kann auch ein
wirklicher Prei, wie wir uns das heute vorstellen, teilweise auch mit Geschmack versehen. Klöße sind nichts anderes als ein gekochter Prei. Also diese Bandbreite an Prei ist unendlich groß. Und wenn wir Prei im Mittelalter hören, denkt bitte nicht an einen dünnen Haferschleim oder sowas. Das kann alles Mögliche sein.
Die typischen Wintergetreide sind dann eben Weizen und Roggen. Roggen ist vor allen Dingen beliebt, weil Roggen deutlich resistenter gegen Feuchtigkeit und so ist. Also gerade bei uns in der Region war es ein sehr, sehr beliebtes Getreide. Beides Wintergetreide. Ist bis heute so geblieben. Bis heute ...
So ein Beispiel, Sommerweizen macht heute in der Ernte 0,8% der Weizenernte bei uns in Deutschland aus. Also Roggen und Weizen immer noch mit großem Abstand Wintergetreide, wird eben im Winter ausgesät, werden wir wie gesagt gleich im Jahresablauf sehen und dann im nächsten Sommer sprießt das Ganze erst, hat Vorteile, vor allem auf dem Ertrag. Winterweizen hat einen viel, viel höheren Ertrag auch schon auf dem Feld als Sommerweizen. Das sind eben die typischen Brotgetreide.
Brot ist nicht ganz so trivial, wie man gerne denkt. Dazu brauche ich zum Beispiel eine Sauerteigkultur, ich brauche ein Triebmittel, ich brauche ein Backhaus. Im normalen Haus habe ich eine Feuerstelle, aber üblicherweise keinen Ofen zu der Zeit. Also es gibt tatsächlich immer noch Regionen oder auch Dörfer, wo Brot einfach kaum vorhanden ist oder eben nur zeitweise hergestellt wird. Brei ist im Mittelalter immer noch ein sehr, sehr, sehr beliebtes Nahrungsmittel.
Nahrungsmittel. Und der Trick an dieser ganzen Küche ist jetzt, jetzt brauche ich Geschmack dazu. Ich brauche irgendetwas dazu, was diesen Frey, was dieses Brot lecker macht. Brot übrigens noch nicht geschnitten, Brot wird gebrochen. Auch wenn gleich eine Quelle kommt, die anders aussieht, aber im Grunde genommen im Mittelalter wird Brot gestippt, eben in etwas, was lecker ist. Und da gibt es ganz, ganz viele Varianten. Hier haben wir eben typisch aus dem Gartenbau, da haben wir gelbe Rüben, also Karotten. Hier haben wir Weißkohl, der sieht noch gar nicht so kohlmäßig aus, aber auch schon
Sehr, sehr beliebt und Gemüse, da ist übrigens das Wort Muus drin, heißt im Mittelalter auch gerne Zugemus, also dazugegessen als Geschmacksträger. Schwer unterschätzt ist Fleisch aller Art. Also Schweinefleisch ohnehin, das ist Teil des bäuerlichen Ertrags. Rind genauso, das denkt man sofort dran. Sowas wie Schafe oder Ziegen werden gerne mal vergessen. Hier haben wir eben so einen Schäfer, der als Angestellter des Dorfes quasi die Herde betreut.
Hühner ist ein ganz wichtiger Fleischlieferant und auch oft, wenn die Leute sagen, ja im Mittelalter Eier und Hühner hatten die Leute nicht, mussten sie abgeben, die Abgaben sind ja ein Anteil, man gibt nicht alles ab, man hat immer noch etwas da, sprich Eier sind vorhanden, Hühner sind vorhanden und ich habe das auch schon ganz oft erzählt, Hähnchen nach etwa 40 Tagen, also wenn ich Hühner züchte, ich habe ungefähr gleich viel Hähnchen und Hühner und Hühner.
Von Hähnen kann ich nicht so wahnsinnig viel gebrauchen. Einen pro Herde quasi. Und alle anderen sind überflüssig. Und nach 40 Tagen sind sie schlachtreif.
gerade was die Leute gemacht haben. Also es gibt Zeiten auf dem Dorf, da waren Hühner in grauen Mengen zu bekommen, nicht das ganze Jahr über, die konnten nicht in den Supermarkt gehen, aber Hühner sind gar kein großes Problem und Eier genauso. Eier mussten zwar abgegeben werden als Teil der Naturalabgaben, aber eben nicht alle. Warum auch? Dann haben wir Obstanbau, vor allem auf der Almende, Obstwiesen, je nach Region sogar ein Hauptteil der Wirtschaftsform. Das ist immer da und ist auch immer Teil der Ernährung.
Wir haben eine umfangreiche Milchwirtschaft. Hier zum Beispiel sieht man gerade Butter als Produkt. Eine gute Möglichkeit, um Milch haltbar zu machen. Buttermilch fällt da gerade noch nebenbei ab. Wir haben aber auch sowas wie hier Käseherstellung. Auch das ist eine wunderbare Art, Dinge haltbar zu machen. Und wo Käse ist, ist es natürlich auch als Geschmacksträger für viele Gerichte gut zu verwenden. Hühnereier hatte ich eben schon. Hier sieht man eben im Haus oder am Haus noch einen Hühnerstall dazu. Das Ganze wird dann auch ergänzt durch
Kleintierjagd, hier sieht man die Jagd auf Tauben mit einer solchen Falle, das ist Niederwildjagd, das ist auch oft erlaubt. Teilweise gibt es auch diese Art der bäuerlichen Jagd, auch größere Vögel dürfen oft geschossen werden, da haben wir dann tatsächlich den Bauern mit der Armbrust, der einen Vogel jagt. Auch Sammeln gehört immer noch dazu, vielleicht nicht durch die Landwirte selbst, aber Kinder zum Beispiel können da eingesetzt werden, hier sieht man gerade, wie Rebhuneier gesammelt werden, auch das ist eine willkommene Ergänzung für den Speiseplan.
Schließlich gehört in den Dörfern auch Honig dazu. In verschiedenen Varianten, entweder im Korb als Imker oder im Wald als Zeitler. Honig ist immer Mangel in Europa, wird gerne importiert, aber es ist auch etwas, was auf den Dörfern vorhanden ist.
kann ich dann eben einen Speiseplan machen, der auch eine Abwechslung mit sich bietet. Wir wissen nicht genau, was die Bauern gegessen haben, weil die die Rezepte selten erhalten haben. Das kommt später. Aber es gibt unfassbar viele Lebensmittel. Die Leute haben oft die Idee, dass die Bauern irgendwie nur eine sehr begrenzte Anzahl an Lebensmitteln kannten und hatten. Es sind unfassbar viele. Also auch im Frühmittelalter, schon so in Verordnung von Karl dem Großen, werden wahnsinnig viele Küchenkräuter genannt, die wir heute auch noch verwenden. Die sind da. Also die...
Auch wenn es heißt, exotische Gewürze, die hatten die natürlich nicht auf dem Dorf. Oder zumindest außer den sehr wohlhabenden hatten die es nicht. Aber das heißt ja nichts.
Wir haben immer noch Kräuter, mit denen man Geschmack in etwas einbringen kann. Also die Idee, dass die Leute Pfadesessen hatten, das ist eine sehr merkwürdige Vorstellung, weil auf der ganzen Welt, wo gibt's denn auf der Welt heutzutage in alten Küchentraditionen Pfadesessen? Warum soll es ausgerechnet des Mittelalters gehabt haben? Find ich immer schwer zu glauben. Was natürlich den Bauern komplett abgesprochen wird, ist irgendetwas wie Tafelkultur-Tischsitten. Bei Burgführungen hört man gerne mal, dass die irgendwie dann 'ne Kuhle im Tisch hatten, da wurde ja Brei reingekippt und die haben alle dann den Brei gelöffelt oder sowas.
Das ist ein ganz interessantes Bild. Das ist aus dem 16. Jahrhundert, die Bauernhochzeit von Peter Preugel, dem Älteren. Und wenn wir da mal genauer reinschauen. Erstmal, was sie hier gerade machen, sie imitieren höfische Kultur. Da ist eine Tür ausgehangen worden, damit zwei Leute das Essen herumtragen können. Das haben wir in der höfischen Tafel teilweise ganz ähnlich.
Und wenn wir genau hingucken, dann sehen wir tatsächlich Leute, wir sehen Keramik, wir sehen Krüge, gut, die Bauern trinken hier direkt aus dem Krupp, das dürfte Teil der Komik sein. Aber wir sehen zum einen Messer auf dem Tisch liegen, wir sehen aber auch Löffel, die genutzt werden. Also das ist im bäuerlichen Bereich durchaus auch üblich, so einen Löffel kann man auch schnitzen, das ist etwas, was auf dem Dorf genauso hergestellt werden kann, dürfte niemanden wundern.
Und auch ein sehr schönes Bild sind hier die Bauern, die offensichtlich bei der Arbeit verköstigt werden. Hier ist genau, was ich gesagt habe, die Frau scheint das Brot zu schneiden, aber hier sieht man auch eine Frau eben aus einer Schale trinken. Da haben wir gleich noch eine Quelle dazu oder zumindest eine Angabe dazu. Also auch das ist natürlich im bäuerlichen Leben, gerade wenn man auf dem Feld arbeitet, wichtig, dass man da
vor Ort essen kann. Und es gibt eine Verordnung des Mainzer Erzbischofs für seine Güter im Rheingau von 1497, die für Tagelöhner, Hofgesinde und Frohnbauern, genau die wir eben gesehen haben quasi, folgende Nahrungsmittel nennt. Morgens eine Suppe und Brot. Die Suppe ist hier vor allem wieder Geschmack. Ich kann das Brot rein stippen. Sie sind nebenbei kräftig. Ich kann sie trinken. Ich brauche dafür...
eben aus der Schale trinke, ich brauche dafür kein großes Besteck. Mittags eine starke Suppe, dazu reichlich Fleisch und Gemüse und einen halben Krug gemeinen Weins.
und abends dann für alle Fleisch und Brot. Und es ist in so Sachen auch häufiger davon die Rede, dass das durchaus viel sein soll. So ein Bauer, der braucht ein paar Kilokalorien am Tag, also nicht wie wir bei Büroarbeit irgendwie 2000 Kilokalorien, der kann leicht das Doppelte, in manchen Zeiten auch das Dreifache verbrauchen, das muss irgendwie in den Körper kommen. Mit dünnem Haferbrei wird das nix und auch mit dünner Suppe wird das nix. Im normalen
Die Rezepte haben keinen so unfassbaren Anteil. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass es hier auch darum geht, dass sie gut zur Arbeit transportiert werden kann und ausgegeben werden kann. Aber das ist reine Spekulation von mir. Dann kommt das Thema Freizeit. Und man kann eigentlich sagen, so etwas wie Freizeit im eigenen Sinne ist dem Menschen im Mittelalter ohnehin und dem im Dorf sowieso eher unbekannt. Das gibt es nicht. Man ist nie ganz untätig.
Alles, was man tut, ist, oder nichts, was man tut, ist reiner Selbstzweck. Entweder hat es etwas mit der dörflichen Gemeinschaft zu tun, hat mit Sozialisieren zu tun, oder man tut dabei etwas wie kleine Reparaturen, Frauen, die spinnen, weben oder ähnliches gehört dazu. Also wirklich gar nichts tun ist sehr selten. Außer man spielt. Es gibt Spiele. Wir haben Nachweise für Würfelspiele, später auch Kartenspiele. Es gibt auch angenehmere Tätigkeiten als zu arbeiten, zum Beispiel eben Spielen.
Kleintierjagd oder auch Sammeln, das ist ja durchaus ganz nett. Der Kirchgang ist natürlich immer eine wichtige gesellschaftliche und soziale Sache und wir haben auf dem Dorf auch durchaus so etwas wie Prozessionen, sieht man hier eben auf einer Dorfkirche, ist auch eine festige kleine Dorfkirche, das haben wir durchaus schon. Kleine Pilgerfahrten gehören auch durchaus zum Alltagsleben, jetzt nicht die großen, die kann sich ein Dorfwohner selten leisten, aber es gibt auch lokale
die man ansteuern kann. Auch das ist letztlich eine Art von Freizeit. Im Verlauf des Mittelalters haben wir immer mehr Gasthäuser. Hier aus einem Stundenbuch aus dem frühen 16. Jahrhundert sieht man eben wieder so eine Schäferidylle. Im Hintergrund sieht man einen Gartenhof.
Gastraum oder eine Gastwirtschaft, sogar mit Bänken davor. Da gibt es mehrere Abbildungen, sehen wir gleich auch nochmal eine. Wir wissen, dass es in den Dörfern Badestuben gab und selbst wenn es sie nicht gab, hier wird offenbar gerade in einem Mühlteich gebadet. Das ist auch etwas, was man machen kann. Wir haben Abbildungen von sportlichen Wettbewerben. Hier sieht man Wettrennen, Weitspringen, Steine werfen, Ringen.
Man sieht allerdings auch im Hintergrund eine Zielscheibe, werden wir gleich auch noch eine schöne Quelle zu haben. Es gibt Bauernfeste, hier sind wir wieder im 16. Jahrhundert, auch da, es wird gekegelt im Hintergrund, hinten hauen sich sogar ein paar, es wird getanzt miteinander. Warum sollen Dörfer keine Feste gefeiert haben? Allein schon bei Hochzeiten und ähnlichem, das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil so einer sozialen Struktur. Und ein Bild, das ich sehr, sehr spannend finde, auch wieder Bruegel, wieder 16. Jahrhundert, das ist
Das ist ein Dorffest und da hab ich mal ein paar Ausschnitte rausgesucht. Zum einen sieht man hier wieder ein Gasthaus. Was ich daran wirklich interessant finde, ist diese Sebastiansfahne davor.
Das ist bäuerlich. Also was wir aus Städten kennen, so Genossenschaften entstehen, die auch eigene Fahnen und ähnliches besitzen, das scheint es auf Dörfern ganz genauso gegeben zu haben. Auch eben bei der Prozession war eine sehr, sehr festliche Fahne. Das ist etwas, was wir Dörfern immer wieder gar nicht zutrauen, dass auch da ein gewisser Prunk stattfindet, auch in Konkurrenz zu den Nachbardörfern durchaus.
Im Hintergrund ist natürlich auch noch das, oder hinter der Fahne ist auch das Gasthaus zu sehen, eben auch mit einem Gasthauszeichen in diesem Fall. Auch ganz spannend, diese Gitterformfenster, auch interessant. Auf dem Ausschnitt sehen wir ein Fastnachtspiel auf einer Bühne. Auch das haben wir offensichtlich zu der Zeit bereits in Dörfern. Übrigens auch zum Thema Karten ohne Fenster. Genau.
Ist hier hier Glas auf dem Dorf? Ein Schwerttanz, der ist natürlich wieder eine ganz wichtige Sache, denn wer darf ein Schwert tragen, wenn dann die bäuerliche Oberschicht, die Freibauern, die dürfen sowas werden überhaupt und zu so einem Schwerttanz dabei zu sein, zeigt schon, ich bin Oberschicht, zeigt, ich bin die Elite dieses Dorfes, weil ich das tun kann. Dass im Hintergrund gerade ein gerüsteter Ritter gegen einen fahrbaren Drachen antritt, das ist dann schon sehr spannend und
Ganz hier im Hintergrund an dieser Windmühle sehen wir dann auch noch eine Schützengesellschaft. Und natürlich, wenn wir städtische Schützengesellschaften haben, überall da, wo wir dörfliche Schützen haben, haben wir wahrscheinlich etwas Ähnliches. Und dass die bei der Mühle steht, liegt wahrscheinlich daran, dass sie auf eine Zielscheibe an der Mühle schießen. Schön nach oben, das wurde oft geübt. Also da haben wir wirklich ein ganz breites Feld an mittelalterlichen Schützen,
auch auf dem Dorf. Man darf nicht denken, dass sie es nicht hatten. Und selbst wenn das fehlt, wir haben da Familien, da gibt es immer noch eine ganze Menge Möglichkeiten, also sich zu unterhalten zum Beispiel. Aber auch natürlich so etwas wie Sex ist auch eine Art von Unterhaltung, die ich in einer Gesellschaft ohne elektrischen Strom im Dunkeln perfekt machen kann. Also ich glaube, die Leute hatten ihre Zerstreuung. Auch da die Vorstellungen sind ja alle traurig, kaputt vom Tag an ihrem Leben.
Brei gemümmelt haben, die ist auch zumindest nur Teil eines Spektrums. Irgendwo zwischen dem ausgelaugten armen Bauern und dem, der es sich gut gehen lässt, ist die Realität. Wahrscheinlich werden beide Extreme auch erreicht.
Und zum Abschluss ist dann noch dieser Jahreslauf ein ganz wichtiger Punkt. Der ist auch schon top aus dem Mittelalter. Dazu die Vorstellung, dass es einen Jahresablauf gibt, den man in Bilder fassen kann. Ich habe hier eine Frühwässerung von 818 nach Christus, also 9. Jahrhundert. Da sieht man noch so spätantike Anleihen und da ist schon nach Monaten aufgeteilt, was der Bauer so macht. Noch schöner so ein Falkkalender. Den fand ich so großartig, dass ich mir das nachmachen lassen habe. Da sieht man immer
Oben das Tierkreiszeichen, die Sonnen- und Nachtstunden am Tag und dann kommt darunter die jeweilige Tätigkeit. Auch da haben wir eben zwölf Monate jeweils mit der dazu passenden Tätigkeit.
Oder hier eine Variante, die wirklich auch die ganzen bäuerlichen Tätigkeiten nebeneinander aufzeigt. Und diese Bilder finden wir auch ganz viel in Stundenbüchern und sowas. Aus diesem Kalender, das ist ganz bekannt, die bäuerlichen Darstellungen aus dem Stundenbuch zu Luc de Berry, dem Tricheur, da werden wir gleich ein paar sehen und werden mal schauen, was in den Monaten nach dieser Vorstellung so passiert.
Januar, da haben wir oft so eine häusliche Darstellung, interessant übrigens, dass da ein Tichtuch auf dem Tisch in diesem Bauernhaus zu sehen ist. Die Leute ziehen sich zurück ins Warme, Holz wird allerdings weiterhin geschlagen, wird gebraucht, auch der Handel mit Holz in die Städte rein, wenn da ein Markt ist, ist ganz wichtig. Instandsetzungsarbeiten werden in dieser Zeit geplant.
durchgeführt, Textilverarbeitung gehört dazu und im Februar ist es ganz ähnlich, auch da haben wir noch häusliche Bilder, da sieht man, um die Tiere muss man sich im Winter natürlich genauso kümmern, die sind nicht plötzlich weg, auch Bienenkörbe sieht man im Hintergrund und oben eben den Abtransport von Holz zur Stadt, das sind die typischen Dinge, die im Januar und Februar gesehen werden.
Im März, da gibt es oft Abbildungen, wie die Leute anfangen, Zäune auszubessern, wie Felder von Ästen und Wurzeln befreit werden. Hier im Vordergrund der Bauer, der schon pflügt, im März, wenn der Bauer die Rösslein anspannt, das passt schon ganz gut, da wird eben der Boden für das Sommergetreide schon vorbereitet. Und hier, weil wir gerade wieder einen Ochsenpflug hatten und vorhin vom Pferdepflug geredet haben, hier sieht man mal einen, also auch das ist absolut verbreitet.
Im April ist Gartenarbeit offensichtlich ganz wichtig, sowohl im eigenen Garten als auch auf Obsthallen und ähnlichen. Die Äcker werden gedüngt, es wird auch gepflügt. Die Tiere werden auf die Weide getrieben. Hier sieht man eben so diese typischen Gartenarbeiten. In einem weiteren Beispiel, das hatten wir vorhin schon mal, sieht man eben, dass die Tiere auch wieder auf die Weiden getrieben werden.
Im Mai lustigerweise gibt es ganz, ganz wenig Abbildung von bäuerlicher Tätigkeit. In allen Versionen, die ich kenne, ist im Mai nichts aus dem bäuerlichen Lebenslauf. Hier sieht man eine Adelsgesellschaft, hier sieht man Tanz, Musik und Baden. Es sind keine Adeligen, es sollen Bauern darstellen.
Hier bei Simon Benning sieht man eine Gesellschaft auf einem Flusskahn fahren. Sehr schön ist die metallene Flasche, die ins Wasser gehängt wird, damit sie kühl bleibt. Und ich kenne überhaupt nur eine einzige Abbildung, die ich so gefunden habe, das ist nämlich die hier von Weidewirtschaft. Das ist auch eine Darstellung für den Monat Mai. Aber der Wonnemonat Mai scheint auch damals schon den Ruf gehabt zu haben, mit Arbeit nicht so viel zu tun gehabt zu haben. Wie realistisch das ist, könnt ihr euch selber vorstellen.
Im Juni kommt dann ein wichtiger Teil des bäuerlichen Kreislaufs, nämlich die Heuernte. Hier sehen wir Sensen, ganz typisch, dass die Heuernte mit der Sense durchgeführt wird. Und ein weiteres sehr schönes Bild, da sieht man einfach einmal so einen Wagen voll mit Heu und dann eben wieder das Heu ins Obergeschoss eines Hauses gebracht und gelagert wird als Futtermittel für den Winter und so. Ist auch nett, mal beide Varianten zu sehen.
Im Juli haben wir dann vor allen Dingen Ernte. Sommer-Wintergetreide ist da gar nicht so unfassbar wichtig. Bei der Ernte ist ganz interessant, sie wird mit Sicheln durchgeführt. Bei der Ernte mit Sense war die Befürchtung, dass zu viel Korn verloren geht, weil es fällt. Mit der Sense kann ich das gar begreifen, abschneiden und sie fällt nicht groß auf den Boden. Ich kann das viel sicherer machen. Einige dieser Sense sind auch gezahnt. Da gibt es
Ganz interessante Abbildung zu. Das war auch nicht ganz unüblich. Neben der Ernte ist die Schafschur und die Obsternte im Juli und August ganz häufig zu finden. Hier haben wir nochmal ein Bild von der Getreideernte. Da kommt auch wieder der Wagen. Auch sehr schön ist hier, dass die Erntearbeiter gerade versorgt werden mit Essen. Hier ein weiteres Bild, die Weiterverarbeitung des Getreides im Trechen auf dem Boden. Auch dann
Mit Hilfe so einer Schütte, also durch Hochwerfen, durch Wind, das Trennen von Spelz und Korn. Und im Hintergrund sieht man auch da, wie das Getreide dann in ein Vorratsgebäude gebracht wird. Im Freien findet man das mit dem Trechen. Es gibt aber auch feste Trechböden. Hier sieht man einen steinernen Boden, auf dem dann Trechböden,
Korn vom Rest getrennt wird. Das ist aber nicht die einzige Art, wie Getreide so gewonnen wird. In einigen Regionen gibt es auch den Trechschlitten. Das ist ein Holzbrett auf der Unterseite mit Feuersteinen besetzt, das dann über auf dem Boden liegendes Getreide gezogen wird. Das ist im kontalischen Raum bis in die Neuzeit verbreitet gewesen. Tatsächlich, da gibt es verschiedene Varianten, aber bei uns ist tatsächlich das Trechen mit dem Trechfliegel sehr, sehr verbreitet. Hier sehen wir auch nochmal die Obsternte. Das ist auch ein eher seltenes Bild aus dem Stundenbuch.
Im September haben wir auf der einen Seite die Weinlese, die ist entweder ein Teil der bäuerlichen Kultur oder wirklich der Hauptteil. Es gibt Regionen, wo es wirklich so wichtig ist, der Weinanbau, dass Leute hauptsächlich Weinbauern sind. Da gibt es dann auch Standesunterschiede. Es gibt Regionen, zum Beispiel in Südtirol, da sind die Weinbauer höher stehend und das Rebmesser gilt geradezu als Standessymbol. Man steht über dem normalen Bauern, aber es ist wirklich auch regional sehr, sehr unterschiedlich.
Ebenso ist die Aussaat des Wintergetreides im September ganz wichtig. Hier haben wir die Arbeit mit Egge, man sieht sogar schon die ersten Schweine, die in den Wald getrieben werden. Und hier sieht man dann auch nochmal Weinlese und Kälter im September in der Hand. Im Oktober wird dann das Wintergetreide ausgesät, was wir eben schon hatten. Außerdem Rinder werden geschlachtet, Schweine kommen etwas später, das ist so die typische Tätigkeit. Und im November geht es dann langsam auf die Vorratshaltung. Die Schweine werden nochmal in den Wald getrieben und dort durch Eichelmast
auch Schlachtgewicht gemästet, ganz wichtiger Teil der Fleischhaltung. Hier in der Version gibt es dann noch eine weitere Tätigkeit, nämlich die Leinenverarbeitung. Die trächen hier kein Korn oder sowas, man sieht im Hintergrund auch, wie die Fasern gebrochen werden hier,
Vorarbeit auf dem Boden mit solchen, ich würde sagen, eisernen Schlägeln. Und im Dezember schließlich kommt dann die Schweineschlacht. Und das ist eine ganz typische Tätigkeit. Auch durch Verbindung mit der weihnachtlichen Fastenzeit ganz häufig und natürlich für die Vorratshaltung im Winter enorm wichtig. Das Ganze nochmal, da wird auch noch Brot dazu gebacken. Aber das ist so der Jahresablauf, den man sich immer vorstellt. Auch Mittelalter ist eine klare Vorstellung, dass eben so das bäuerliche Jahr aussieht. Ja,
Am Ende hatten wir nochmal die Quellen des Mittelalters, wie die sich das vorgestellt haben. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen Eindruck erwecken, wie der Mensch im Mittelalter sein Leben gelebt hat aus Sicht des Bauern. Ich habe viele Dinge weggelassen, so Dörflich-Verfassung und solche Dinge, Adel habe ich gar nicht groß reingenommen. Ich wollte wirklich mal erzählen, was wissen wir über das Leben des Menschen auf dem Dorf, des einfachen Bauern in Anführungszeichen, wobei wir herausstellen konnten, es gibt gar nicht den einfachen Bauern, es gibt
Den Bauern als Gruppe nur aus der Vorstellung des Adels und des Klerus, die haben den Bauernstand konstruiert. Für die Leute vor Ort ist das ein riesiger Unterschied, ob man jetzt ein Hofbauer ist, ob man zur Oberschicht gehört, ob man ein Knecht ist, ob man einen Teilhof hat, das sind gigantische Unterschiede. Diese Standesunterschiede sind auch nicht viel geringer als die zum Adel oder zur Stadt oder sonst etwas.
Ja, ich hoffe es war ein bisschen plastisch. Ich konnte euch ein bisschen was erzählen darüber, was wir so über Bauern im Mittelalter wissen. Wenn es Fragen gibt, schreibt sie in die Kommentare. Ich würde mich freuen. Ich versuche darauf zu antworten. Es wird immer schwerer, weil die Kommentare werden immer mehr. Ich komme da oft nicht nach, aber ich versuche das Ganze. Ansonsten, wenn ihr euch irgendwie an der Diskussion beteiligen wollt, guckt mal auf Discord vorbei. Ich habe einen netten Discord-Kanal, da kann man auch immer Fragen stellen, da kann man immer mitdiskutieren. Ist auch sehr nett. Findet ihr auch unten in der Videobeschreibung.
War schön, dass ihr dabei wart. Nächstes Mal wieder ein anderes Thema. Ich freue mich darauf, wenn ihr da seid. Bis dahin macht's gut und bleibt gesund.
