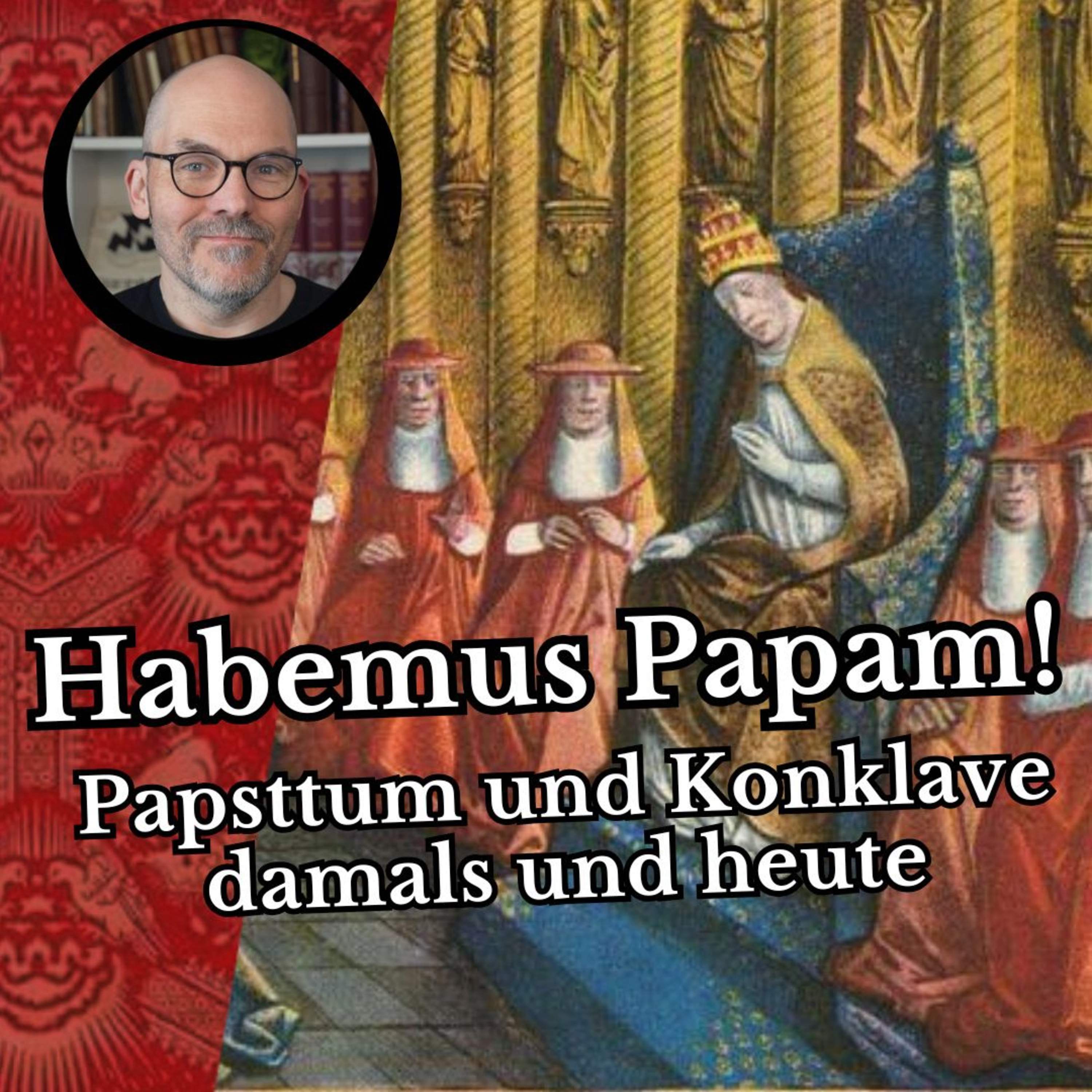
Shownotes Transcript
Herzlich Willkommen bei Geschichtspenster, mein Name ist André und heute geht es um die Päpste und das Konklave. Aktuelles Thema, wenn dieses Video rauskommt, ich habe es extra um eine Stunde verschoben, es kommt eine Stunde früher als sonst, beginnt exakt zum selben Zeitpunkt in Rom das Konklave. Der neue Papst wird gewählt, ist ja nicht so extrem oft, obwohl ein paar Mal werden wir das in unserem Leben noch erleben, aber es ist ein super Anlass um ein Video zu machen. Also, herzlich Willkommen.
Alles, was so um Papst und Mittelalter, Wahl des Papstes, damals und heute, das werden wir alles in diesem Video abfrüchtigen. Und es passt natürlich auch super zum Thema, dass ich ein paar Bücher mitgebracht habe. Ich arbeite ja gerade mit dem Verlag CHBECK zusammen und die Reihe Wissen von CHBECK, die feiert 30-jähriges Jubiläum und allein in der Reihe habe ich
mehrere Bücher. Es gibt ein Buch über den Vatikan, es gibt ein Buch über das Papsttum und es gibt noch ein Buch über Papst Gregor VII., das ist so einer der großen Reformpäpste und ihr seht, es gibt quasi zu jedem Thema das richtige Buch. Die sind nicht sehr groß, die sind auch nicht teuer. Könnt ihr mal gucken, unten unter dem Video habt ihr einen Link dazu, da könnt ihr euch umschauen. Das ist eine unfassbar große Sammlung. Ich verlose auch immer wieder welche, in diesem Video mal keine. Wer noch
gerade mitmachen will, im Video von letzter Woche zu den Bauernkriegen. Da könnt ihr gerade noch mitmachen und an der Verlosung teilnehmen. Ein, zwei Tage habt ihr noch Zeit. Und ich konnte es mir nicht nehmen lassen. Es ist zwar vielleicht ein bisschen unimpeditätlos, aber die allmächtige Kirsche
Die muss heute dabei sein und auch das T-Shirt könnt ihr bei mir im Shop auf meiner Seite kaufen. Also wer so ein prächtiges allmächtiges Kirche-T-Shirt haben möchte, auch den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wenn wir an Papst im Mittelalter denken, denkt man an einen allmächtigen Kirchenfürsten, der eine Armee von Inquisitoren, von...
von Klerikern unter sich hat, der überall in Europa jederzeit seine Macht umsetzen kann. Zumindest ist das, was wir oft hören. Also diese Idee der allmächtigen Kirche, die ist ja häufig zu finden und was die Kirche alles verboten hat, was sie alles tun konnte. Tatsächlich ist es eine ganz lange Entwicklung, bis der Papst im Mittelalter auch nur ungefähr das ist, was wir uns darunter vorstellen. Heute ist er vor allem das Oberhaupt der katholischen Kirche. Das
Das ist ja schon von der Macht her eingeschränkt, weil auf der Welt sind nun mal nicht alles Katholiken. Und er ist natürlich eine der bekanntesten Persönlichkeiten der Welt. Also der gerade verstorbene Papst Franziskus, den kannte quasi jeder. Der Name Papst, der kommt aus dem griechischen Papas, also Vater, und ist erst seit dem 4. Jahrhundert nachweisbar. Also auch das muss sich erst entwickeln. Seit dem 5. Jahrhundert wird er dann auch wirklich exklusiv für den Bischof von Rom verwendet. Zu der Unterscheidung kommen wir gleich noch.
Im Althochdeutschen wird es als Papa übersetzt, dann wird im 13. Jahrhundert daraus der Barbist, im 15. Jahrhundert der Babst und im 18. Jahrhundert dann der Papst, wie wir es heute kennen. Also auch dieser Begriff braucht relativ lange, bis er sich so entwickelt hat. Streng nach Lehramt reden wir die ganze Zeit vom Bischof von Rom. Das ist seine eigentliche Funktion. Seine Amtskirche als Bischof ist die Lateranbasilika. Die liegt so etwa 5 Kilometer südöstlich des Vatikans. Also ihr seht, die ist natürlich irgendwann massiv umgebaut worden, aber das ist seine Funktion.
Kathedrale, da ist er als Bischof eingesetzt. Und ansonsten ist der Papst noch zwei völkerrechtliche Subjekte. Er ist einmal der Staatsoberhaupt des Vatikanstaates und einmal der Inhaber des Amtes des Heiligen Stuhls. Und wie üblich bei Bischöfen und so, es geht wirklich um einen Stuhl. Das hier ist die Kathedra, also das ist der Sitz, den er innehat und daraus bezieht er quasi sein Amt. Und diese beiden
Und Völkerrechtssubjekte sind unabhängig, teilweise überschneiden sie sich, teilweise sind sie was völlig unterschiedliches. Also einmal Staat überhaupt, klar, aber der Heilige Stuhl, der ist eben ein nicht staatliches Völkerrechtssubjekt. Der hat eine ganze Menge Ämter, die er auf sich vereinigt. Und zudem ist er dann noch bekannt als Pontifex Maximus, als Servus Servorum Dei, als Apostolicus und als Vicarius Jesu Christi, also Stellvertreter Jesu Christi.
Und dieser Pontifex Maximus, das ist ein Titel, der ganz oft verwendet wird, also Pontifikal wird auch gerne benutzt, um ihn zu beschreiben. Da haben wir lustigerweise ein altes römisches Amt, einen alten römischen Titel, das heißt Oberster Brückenbauer. Und seit dem dritten Jahrhundert vor Christi ist das der Oberaufseher für alle sakralen Handlungen in Rom.
Julius Caesar, kennt ihr bestimmt, ist ab 63 vor Christi, also 21 Jahre vor seiner Alleinherrschaft, ist er Pontifex Maximus, hat damit also auch ein klerikales Amt im heidnischen Rom. Und 12 vor Christi wird dann der Titel auf Augustus übertragen und seitdem ist Pontifex Maximus Titel der römischen Kaiser.
Wird nach Konstantin zum Beispiel kaum noch gebraucht, außer um das Mitspracherecht in kirchlichen Angelegenheiten noch zu betonen. Und im 5. Jahrhundert übernehmen dann die Päpste diesen Titel. Aber erst Bonifatius IX. im 14. Jahrhundert nutzt das regelmäßig. Seitdem ist das so einer der Titel des Papstes, der dann auch wirklich eine Bedeutung erfährt. Und dieses Amt als Bischof von Rom, erstmal ein normaler Bischof, einer unter vielen.
Nach katholischer Lehre war der Apostel Simon Petrus der erste Bischof von Rom. Das ist historisch nicht nachweisbar. Es gibt da einen deutlichen Unterschied zwischen der katholischen Tradierung und dem, was so historisch nachzuweisen ist.
Die ganzen frühen Päpste, es gibt so eine Liste, die bis auf Petrus zurückgeht, die die Päpste aufzählt. Die meisten davon sind nicht wirklich nachweisbar, zumindest die ganz, ganz frühen. Tatsächlich werden frühchristliche Gemeinschaften auch die in Rom von ältesten Räten geleitet. Da gibt es gar kein Oberhaupt erstmal. Erst im 2. Jahrhundert gibt es dann so die Tendenz, dass eine dauerhafte Leitung gesucht wird. Und der Begriff dafür ist erstmal Episkopos. Griechisch für Aufseher. Davon leitet sich der Begriff Bischof ab. Das ist einfach eine
Lateinisierung oder eine Übernahme dieses Begriffes. Und auch heute ist das Bischofsamt noch das Episkopat. Also der Begriff hat sich tatsächlich erhalten. Um Bischof zu werden, der Ältestenrat schlägt einen Kandidaten vor und die Gläubigen, alle Gläubigen wählen das. Das ist wirklich ein Grundsatz der frühen christlichen Gemeinden. Alle Gläubigen wählen das Oberhauptamt.
Lange gibt es den Begriff Mon Episkopat, also ein allein herrschender Bischof, einer der allein die Leitung hat und dem auch gehorsam geschuldet wird. Und die frühe Gemeinde in Rom hat natürlich ein Problem, sie ist immer wieder Verfolgung ausgesetzt, also wir haben es da immer noch mit einer teilweise auch wirklich geheimen Gesellschaft und einem geheimen Kult zu tun. Es ist schwierig da irgendwelche Ämter zu haben, also ein wirklicher Bischof wäre auch tatsächlich problematisch gewesen.
Trotzdem schafft es die frühe Christenheit auch, sich schon zu vernetzen. Es werden auch schon Konzile abgehalten, zum Beispiel in Nordafrika. Rom ist tatsächlich so ein Außenpost. Ein ganz großer Teil des frühen Christentums findet in Kleinasien und in Afrika statt, Nordafrika. Also auch so Alexandria und so, ganz, ganz wichtige Orte. Und erst mit dem Toleranzerlieb 311 und dann der Meilen der Vereinbarung 1313
beginnt so der Aufstieg des Christentums zur Staatskirche. Dann kommt das Dreikaiser-Edit von 380, damit ist die Verfolgung beendet und das Christentum ist quasi Staatsreligion. Und der Bischof von Rom hat auf einmal eine offizielle Funktion, ist neu. Auch ein Teil der Oberschicht ist in der Zeit konvertiert, also das Christentum breitet sich auch in Rom aus. Es gibt Grundbesitz, also durch Schenkungen und Erbschaften ist der Bischof von Rom auf einmal Grundherr, nicht nur über Boden, sondern auch über Arbeitende.
Und zu der Zeit wird der Laterankomplex Sitz des Bischofs von Rom. Also da gibt es auch wieder Schenkungen und er kann darüber verfügen. Da wird auch ein frühes Baptisterium eingerichtet. Die gesamte Kirche, die es noch nicht so wirklich gibt, aber so die Christenheit, hat im Prinzip eine Führung aus den fünf Patriarchen. Wird auch Pentaschie genannt, also fünf Herrschaften. Da hat man einmal den Patriarch des Abendlandes in Rom, über den reden wir gerade. Wir haben aber auch das Patriarchat von Konstantinopel.
Den Patriarch von Alexandria, den Patriarch von Antiochia und den von Jerusalem. Das sind die fünf großen Patriarchen, die gemeinsam über langwierige Kommunikation die wichtigen Entscheidungen treffen. Konzile werden auch abgehalten, da gibt es auch ganz wichtige Konzile von Nicea zum Beispiel. Aber bereits seit dem 2. Jahrhundert erheben die Bischöfe von Rom den Anspruch für einen Vorrang.
... denen die östlichen Patriarchen zwar zugestehen, aber nur ehrenhalber. Das theologische Zentrum dieser Zeit liegt definitiv nicht in Rom. Und die sind auch tatsächlich nicht auf Augenhöhe. Also die ganzen wichtigen Schriften dieser Zeit werden anderswo geschrieben. Und es kommt auch zum zunehmenden Konflikt mit Byzanz. Also das Kaisertum wandert ab nach Byzanz. Ostrom wird da vorherrschend...
Es kommt zu den Gotenkriegen in Italien. Da habe ich schon mal was gemacht mit Histophilklus zur Spätantike, da reden wir darüber. Und diese Gotenkriege, die schädigen die Wirtschaft in Italien sehr. Nicht so, dass die Gotener einfallen, die Goten verteidigen zum Teil Rom gegen Osttrömer. Das ist ein ganz komplizierter Konflikt. Und nach diesen Gotenkriegen wird Rom de facto Teil des Langobardenreichs. Der Papst hat da eine besondere Stellung, weil in diesem Gebiet ist er der Vorsteher der Christenheit. Das ist auch relativ gut anerkannt.
Es gibt dann zwei Schenkungen. Die Konstantinische Schenkung, angeblich um 315, eher so um 800 gefälscht. Und die Pipinische Schenkung 756. Ob die echt ist, streitet man sich auch. Führen dazu, dass aus diesem Landbesitz ein festes Gebiet wird. Es entsteht der Kirchenstaat. Der Bischof von Rom ist jetzt auch Herrscher. Er ist Herrscher eines eigenen Gebietes. Und
Wir reden hier immer noch von einem Amt, das nicht so gewählt wird wie heute. Wir werden gleich zur Mahlmodi kommen, das ist ja ganz berühmt mit dem Konklave und so, aber wir reden immer noch von derselben Art, einen Oberhaupt zu wählen wie im frühen Christentum, also der Ältestenrat, in dem Fall die Priester, kommen wir auch nochmal dazu.
schlagen einen Kandidaten vor und die Bevölkerung Roms, die stimmt zu oder lehnt ab. Also per Akklamation quasi wird es erhoben und dahinter stehen alteingesessene römische Familien, teilweise auch alte senatorische Familien, die machen das mehr oder minder unter sich auf. Es gibt ein paar Päpste von außerhalb, aber diese Intrigen und diese Wettstreit zwischen alten römischen Familien, das sind die Machtspiele, die dahinter passieren. Also ganz lange Zeit bis ins...
beginnende Hochmittelalter sind das wirklich die Machtstrukturen dahinter, die immer wieder auftauchen. Einer dieser Machtspiele führt dann dazu, dass Leo III. aus Rom fliehen muss, da seine Gegner versuchen ihn zu verstümmeln und dadurch amtsunfähig zu machen. Tatsächlich in der späten Antike und auch im Frühmittelalter noch eine Möglichkeit, jemanden amtsunfähig zu machen, wenn er verstümmelt ist. Und Leo III. flieht um 800 über die Alpen zu Karlsruhe.
Karl dem Großen. Das ist der, an den er sich wendet und er kehrt dann zurück nach Rom mit Unterstützung des Kaisers. Das reicht nicht aus, der Kaiser kommt dann selbst nach Rom, um das am Rechten zu sehen und als Gegenleistung für die Hilfe krönt dann Leo III. ganz überraschend am Weihnachtstag 800 Karl dem Großen zum Kaiser. Und da haben wir eine beginnende Allianz, die auch einige Zeit halten wird, also die jetzt entstehende Kaiser des
Frankreiches, am Heiligen Römisch Reich sind wir noch nicht ganz, und die Päpste, die arbeiten da sehr, sehr eng zusammen. Wirklich zum Oberhaupt der Kirche wird der Papst dann erst im 11. Jahrhundert. Tatsächlich dauert das ziemlich lange. Das ist auch eine Sache der Reformbewegung. Es gibt dann Reformpäpste, die versuchen, die Kirche insgesamt zu reformieren, denn es gibt so ein paar Streitpunkte. Der Zölibat, der ist noch längst nicht allgemein durchgesetzt. Ämterkauf ist ein ganz großes Thema, immerherrlich für Konflikte. Und eben der Anspruch des Papstes auf leitende Gesamtkirche, das sind so die großen Fragen.
Und mehrere Päpste, zum Teil auch aus dem deutschsprachigen Raum, versuchen da die Kirche eben umzuwandeln. Leo IX. ist ein sehr erfolgreicher Reformpapst und der letztlich führt die Kurie als Verwaltungskremium der Gesamtkirche ein. Also die Kurie haben wir heute noch den Begriff.
Dann beginnt allerdings auch der Konflikt mit der weltlichen Herrschaft, denn der Papst innerhalb dieser Reformbewegung entwickelt auch einen Allmachtsanspruch oder einen Herrschaftsanspruch über die gesamte Christenheit. Sagt natürlich der Kaiser, nee, ist nicht. Es kommt zum Investiturstreit. Hier wird sehr gerne auf Heinrich II. und den Gang nach Canossa reduziert.
Vor allem geht es aber um das Verhältnis zwischen Kirche und Krone. Da kommen auch so Sachen, dass irgendwie die Zwei-Schwerter-Lehre entwickelt wird. Es gibt ein weltliches und ein geistliches Schwert. Der Papst hat das Geistliche, der Kaiser hat das Weltliche und zusammen teilen sich die Herrschaft. Aber das ist ein dauernder Konfliktpunkt. Und genau in die Sedisvakanz, also die Zeit nach dem Tod von diesem Leo IX, fällt dann auch noch das morgenblendige Schisma. Die Trennung von Ost- und Westkirche. Die orthodoxen Kirchen, die spalten sich ab, die
Da gibt es diverse Streitpunkte. Tatsächlich führt das dann eben dazu, dass die Westkirche, die verkleinerte Kirche, komplett unter der Herrschaft des Papstes steht. Also diesen Anspruch können die Päpste ab dieser Zeit ungefähr durchsetzen. Und damit nähern wir uns auch dem Papsttum, wie wir es uns oft vorstellen. Also Oberhaupt der Kirche, Machtfaktor auch im Konflikt mit Herrschern. Er hat immer die große Möglichkeit, einen Kirchenmann auszusprechen.
Die Kreuzzüge stärken seine Position noch, er bekommt Einfluss, sowohl durch Aufrufe zum Kreuzzug, die Könige müssen zeigen, dass sie dem folgen und schön gläubig und fromm sind. In den Kreuzfahrerstaaten gewinnt er Einfluss und die Kirchenorden als bewaffneter Arm der Kirche, die machen natürlich dann noch ihr Übriges.
Dazu kommt der Kampf gegen Ketzer und Abweichler, also haben wir sowas wie die Katarer, wie die Baldenser, da gibt es dann auch die Entstehung der Inquisition, dann noch ein weiterer Machtfaktor der Kirche und die zentrale Verwaltung und die eigene Rechtsprechung, das kanonische Recht, das sind weitere Faktoren, die wirklich zu dieser Kirche führen, die wir uns vorstellen, auch wenn die nie so fest im Sattel sitzt, wie wir uns das gerne denken.
Denn real gibt es mehrere Probleme. Es gibt immer wieder Gegenpäpste, es gibt mächtige Ortsbischöfe, die die Kirche herausfordern, es gibt Herrscher, die sich einmischen, schließlich den französischen König Philipp IV., der es tatsächlich schafft, großen Einfluss auf die Kirche auszuüben und vor allem auf die
Papstwahl, also er schafft es, sehr viele Franzosen unter die Kardinäle zu bringen, damit auch die Wahl des nächsten Papstes zu beeinflussen und daraus wird erst das Exil in Avignon von 1309 bis 1377 und dann das große abendländische Schisma von 1378 bis 1417. Da sehen wir den päpstlichen Palast in Avignon, also da gibt es jetzt Päpste, die dort residieren, in Rom gibt es auch Päpste, wir haben jetzt wirklich über wirklich Jahrzehnte Papst und Gegenpapst, also
für Europa keine leichte Zeit. Und das Konzil von Konstanz kann zwar dieses abendländische Schiss mal beenden, aber es kommt das nächste Problem, es kommt die Konzilsbewegung. Hier haben wir die Krone von Martin V., der auf dem Konzil zum Papst gewählt wurde. Das ist übrigens die einzige Papstwahl, die in nördlicher Alpenstadt gefunden hat. Also in Konstanz haben wir eine Papstwahl gehabt. Habe ich aber auch schon ein ganzes Video zum Konzil in Konstanz. Und
Wie gesagt, wir haben wieder eine geeinte Kirche, aber wir haben jetzt die Konzilsbewegung, die sagt, dass das Konzil die Vertretung der Christenheit ist und die Macht des Papstes herausfordert. Das ist jetzt ein ganz langes Thema. Es gibt ja den Pisa-Konzil, es gibt den Basel-Konzil. Also diese Konzilsbewegung ist da sehr, sehr, sehr stark. Im 15. Jahrhundert wird sie überwunden. Die Päpste, zum Beispiel Pius II.,
beenden sie mehr damit der Handstreichartig. Das Problem ist dann wiederum, daraus entstehen die Renaissance-Päpste. Die sind sehr machtbewusste Herrscher, auch wieder hauptsächlich aus italienischen Familien, sehr einflussreichen Familien. Hier haben wir ein sehr gutes Beispiel, Alexander VI., ein Borgia, auch über die haben wir kürzlich schon gesprochen. Und es ist einer aus einer ganzen Reihe von diesen Renaissance-Päpsten, die auf der einen Seite zwar großartige Mäzene sind, Kunst fördern, auch ganz großartige Kunstwerke erschaffen lassen, auf der anderen Seite aber auch fürstenartig
agieren, eine Hofhaltung aufbauen, eben auch Staatsmänner sind. Mit dem Kirchenstaat haben sie ja einen eigenen Staat. Und in der Neuzeit werden dann daraus auch wirklich absolutistische Herrscher mit absolutistischen Ideen. Es wird ein Gehorsamseid auf den Papst geleistet. Es gibt einen regelrechten Hofstaat, kommen wir auch gleich zu, mit den Kardinälen.
Gleichzeitig gibt es aber auch einen Bedeutungsverlust durch sowas wie die Reformation, also es brechen einfach Teile der Gläubigen weg. Staatliche Eigenständigkeiten, gerade so in Frankreich sieht man es, da wird versucht eine eigenständige Politik, auch Kirchenpolitik zu gestalten. Und in napoleonischen Kriegen müssen die Päpste sogar aus Rom fliehen.
Danach gibt es eine Rekonstruktion des Kirchenstaates. Hier haben wir so einen ungefähren Überblick, so sieht der Kirchenstaat dann im 19. Jahrhundert aus. Das lila, die beiden Teile, die sind der Kirchenstaat, da herrscht wirklich der Papst sehr, sehr direkt. Und hier haben wir auch das Wappen des Kirchenstaates, da sieht man die Tiare, kommen wir auch gleich nochmal dazu, das werden wir häufiger sehen, diese beiden Schlüssel. Also da haben wir bis 1870 einen ganz, ganz eigenständigen Staat der Kirchenstaate.
unter der Kontrolle des Papstes steht. Dieser Kirchenstaat hat im 19. Jahrhundert keinen so guten Ruf. Er gilt als rückständig, er gilt als korrupt, er gilt als Polizeistaat und mit der einigen Italiens endet 1870 der Kirchenstaat. Rom wird Teil Italiens, es wird ein König eingesetzt, der Papst ist letztlich Gefangene in seinem direkten Umfeld im Vatikan.
1929 kommt es dann zu den Lateranverträgen mit Mussolini, dadurch wird der Vatikan wieder ein souveräner Staat. Heute ist es der kleinste Staat der Welt. Das Wappen hatten wir eben fast schon mal exakt genauso. Jetzt ist es eben nicht der Kirchenstaat, sondern der heutige Staat Vatikan, das ist das Wappen. Als kleinster Staat der Welt 0,44 Quadratkilometer klein. Ist nebenbei übrigens lustigerweise auch der militarisierteste Staat der Welt, weil die Armee ist riesig, kommen wir gleich zu.
Es gibt ungefähr 900 Einwohner und 764 Staatsbürger. Die Zahl wechselt, das ist jetzt eine Momentaufnahme. Dazu einer der religiösesten Staaten der Welt mit 100% Katholiken und einer der gebildetsten Staaten der Welt, wenn nicht der gebildetste Staat mit 100% Alphabetisierungsrate und auch einem sehr, sehr hohen Anteil an Hochschulabsolventen.
Und beim Vatikan denkt man eben auch sehr schnell an die Schweizer Garde, wie gesagt der militarisierteste Staat der Welt, vielleicht auch mit der höchsten Anzahl von Waffen pro Kopf, wenn man nicht nur Schusswaffen zählt. Offiziell die päpstliche Schweizer Garde wurde 1506 durch Papst Julius II. gegründet und ist damit das älteste noch bestehende Militärkorps der Welt.
135 Soldaten dienen im Vatikan. Es sind unverheiratete katholische Schweizer, die zwischen 18 und 30 Jahre alt sind, wenn sie anfangen, mindestens 1,74 Meter groß sind, einen einwandfreien Leumund besitzen und ihren Rekrutendienst in der Schweiz bereits erfüllt haben.
Eigentlich ist es Schweizer Staatsbürgern verboten, in anderen Armeen zu dienen, aber die Aussage der Schweiz ist mehr oder weniger, es ist ja gar keine Armee, es ist nur eine Wachmannschaft. Also da sind sie sehr pragmatisch. Und schon relativ kurze Zeit nach der Entstehung muss die Schweizer Garde ihre erste Bewerbungsprobe bestehen. Bei der Sacro di Roma sterben 147 Gardisten bei der Flucht des Papstes in die Engelsburg. Also das ist so der große Feiertag, auch der Schweizer Garde, an dem Tag werden auch neue Rekruten vereidigt und so.
Bis 1970 überraschenderweise gab es vier päpstliche Garde. Es gab noch eine Nobelgarde, in der haben Adlige gedient. Es gab eine Palatingarde und es gab die Gendarmerie, die ursprünglich eine berittene Einheit war. Die Gendarmerie gibt es heute immer noch. Es ist das Gendarmerie-Chor des Vatikans, heute eher eine Polizei. Und in der dürfen analog zur Schweizer Garde nur Italiener dienen. Die müssen auch ein klein bisschen größer sein, tatsächlich, aber alles Italiener.
Und diese Uniformen, die wir gerade gesehen haben, die sind auch sehr modern. Die gibt es erst seit 1914. Was es eben heute auch noch gibt, sind die Rüstungen. Also soweit ich weiß, fangen die auch gerade an mit 3D-gedruckten Rüstungen, gerade bei den Helmen. Aber das sind vor allem noch metallene Rüstungen. Die sind auch noch funktional. Ich weiß zumindest, in den 90ern wurden die in Österreich gefertigt. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt genau ist. Aber ja, die Schweizer Garde hat allein aus Repräsentationszwecken noch einen ganzen Haufen historisch, oder sagen wir, historisierender Rüstungen. Das ist
grob 16. Jahrhundert, was wir hier sehen, mit so einem Morion und so, das passt ungefähr die Entstehungszeit, gehen wir aber mal ein bisschen zurück, so sah die Schweizer Garde 1930 aus, mit diesem Kragen, der passt nicht ganz in die Zeit, aus der das Ganze stammt, aber das sieht man eben mit diesem Versuch historisch auszusehen,
Im 18. Jahrhundert sah die Schweizer gerade aber noch so aus. Also diese ganze Kleidung, die wir auch in diesen drei Farben haben, blau, gelb und rot, was an die Farben der Medici angelehnt sein soll, das ist eine spätere Erfindung, die ist später designt worden. Ursprünglich sahen die zeitgenössischer aus. Und wenn wir bei den Päpsten sind, gibt es noch so ein paar Besonderheiten und Rekorde. Wir haben bis heute 308 offiziell gezählte Päpste.
Davon werden 266 als legitim gezählt. Dementsprechend gibt es Gegenpäpste, die nicht gezählt werden. Es gibt auch noch ein, zwei Päpste, die aus anderen Gründen nicht gezählt werden. Komme ich gleich dazu. Von diesen Gegenpäpsten haben 31 in Rom residiert, 2 in Pisa und 7 in Avignon.
Die durchschnittliche Amtszeit eines Papstes beträgt über die letzten fast 2000 Jahre sieben Jahre und fünf Monate. Das längste Pontifikat war das von Pius IX von 846 bis 878 mit einer Amtszeit von 31 Jahren und acht Monaten. Beim kürzesten Pontifikat gibt es zwei Kandidaten. Es gibt einmal Stephan II. 752, der ganze vier Tage lebt.
Papst war, dann ist er an Malaria gestorben, hat allerdings nicht mal seine Bischofsweihe erhalten, der konnte noch als Nichtbischof gewählt werden, es geht heute offiziell immer noch, erzähle ich gleich auch noch was dazu. Er wird aber seit 1961 nicht mehr als Papst gezählt, er war zu kurz, wird nicht gezählt. Der offiziell kürzeste Papst im Amt war Urban VII., 1590 war er für ganze zwölf Tage im Amt, bevor auch er an Malaria gestorben ist.
Benedikt IX. ist dann noch eine Besonderheit, denn der war zwischen 1032 und 1048 gleich dreimal Papst. Der kommt an der Liste dreimal vor. Der musste wegen Machtkämpfen mehrfach rum verlassen. Dann wurde ein anderer Papst eingesetzt. Er kam zurück, hat das Ganze sich zurückgeholt und damit ist er dreimal drin. Er ist möglicherweise auch der jüngste Papst, der je gebildet wurde. Je nach Historiker wird sein Alter bei seiner Papstwahl zwischen 12 und 30 Jahren angegeben.
Es gibt sehr junge Päpste in der Zeit, gerade am Anfang, wie gesagt, das waren Familien in Rom, die um Macht gerungen haben, da haben wir sehr junge Päpste, inzwischen haben wir eher alte Päpste. Der älteste Papst war Leo XIII., der 1903 im Alter von 93 Jahren gestorben ist, also das ist der bisherige Rekord, wird nur geschlagen von Benedikt XVI., der war tatsächlich älter als er gestorben ist, ist aber schon 2013 eremitiert worden.
hat diesen Rekord also nicht. Es gibt etliche Päpste, die gar nicht in der Liste auftauchen, zum Beispiel Martin II. und Martin III., die sind durch einen Fehler nicht reingekommen, weil es gab einen Marinus II. und einen Marinus III., die wurden dann als Martin gezählt und auch einen Johannes XX. sucht man vergeblich, der wurde einfach übersprungen, der nächste Johannes XXI. hat sich verhältlicherweise so genannt und seitdem haben wir da eine Falschzählung. Es gibt
Johannes den 23. dafür doppelt, denn es gibt ihn einmal als normalen Papst, einmal als Gegenpapst. Der Gegenpapst ist im 15. Jahrhundert der normale Papst erst im 20. Jahrhundert. Der Gegenpapst aus dem 15. Jahrhundert wird aber seit dem 20. Jahrhundert auch einfach nicht mehr gezählt. Also von daher ist Johannes der 23. aus dem 20. Jahrhundert völlig richtig in der Zählung.
Eine ganz berühmte Frage ist die, ob es eine Päpstin gegeben habe. Gibt es ja einen ganzen Film zu, gibt es einen Roman zu. Es gibt aber, wie ihr hier seht, auch Quellen dazu. Das ist aus der schädlichen Weltkronung gezeigt, eindeutig eine Päpstin. Auch Boccaccio in seiner Beschreibung berühmter Frauen redet über die Päpstin Johanna. Also das ist was, was im 15. Jahrhundert völlig verbreitet war. Im 30. Jahrhundert kommt diese Geschichte auf, wird dann sehr populär.
Es gibt auch die Legende um das Stuhl mit einem Loch, damit beim neuen Papst geguckt wird, ob er männliche Geschlechtsteile hat oder sowas, das ist aber auch eine Legende und diese ganze Geschichte ist sehr sicherlich nicht wahr, es war wohl eine Satire auf Johannes den 8., der im 9. Jahrhundert gelebt hat und die hat sich verselbstständigt, dem wurde quasi Weichheit, Weibigkeit nachgesagt im Umgang mit Ketzern und daraus hat sich die Geschichte mit Johanna geändert.
wohl entwickelt ebenso die Sache das nur italienische Päpste ganz lange gegeben hat ich hab schon gehört es hätte bis in die Neuzeit überhaupt nur italienische Päpste gegeben
455 Jahre lang, von 1523 bis 1978, gibt es tatsächlich nur Italiener. Italiener muss man dazu sagen, denn tatsächlich ist die Staatsangehörigkeit natürlich nicht italienisch. Die gibt es noch nicht so lange. Es ist meistens entweder Kirchenstaat oder Heiliges Römisches Reich. Norditalien war zum guten Teil Heiliges Römisches Reich. Also wenn wir nach Päpsten aus dem Heiligen Römischen Reich zählen, da haben wir sehr, sehr, sehr viele.
Italiener haben wir tatsächlich sehr, sehr wenige, wirklich Italiener, aber Italiener nicht sprachiger, also nicht als Nationalität, sondern als Ethnie, als Sprache, als Identität haben wir sehr, sehr viele. Und diese 455 Jahre sind auch gar nicht überraschend, denn wir reden von einer Zeit, in der Reisen immer problematisch ist und
Es gibt viele Konklave, wirklich viele. Komme ich gleich noch dazu, weil die meisten Päpste treten ja amtalt an und dann kommt die nächste Konklave relativ bald. Da die gesamte Weltkirche zusammenzurufen, damals ist es vor allem noch Europa, das wäre sehr viel Aufwand und daher ergibt es durchaus Sinn, die Kardinäle in der Nähe zu halten. Kardinäle machen wir gleich nochmal ein bisschen mehr dazu.
Es gibt trotzdem über die Zeit einen ganzen Haufen deutsche Päpste. Selbes Problem, Deutsch als Nationalität gibt es noch nicht. Der erste, der so gezählt wird, ist Bonifatius II. im 6. Jahrhundert, der war Ostgote, also da wird Deutsch schon sehr großzügig ausgelegt. Dann Gregor V., der in Kärnten geboren wird und von 996 bis 999 amtiert.
Im 11. Jahrhundert kommen dann diese Reformpäpste, da hatte ich eben schon was dazu, da haben wir eine ganze Menge deutschsprachiger. Clemens II. in Hornburg in Sachsen, heute gesehen der Sachsen geboren und dessen Grab ist auch das einzige Papstgrab nördlich der Alpen, nämlich in Bamberg. Dann haben wir Damasus II. aus Niederbayern, Leo IX. aus dem Elsass, Viktor II. wahrscheinlich in Franken geboren und am Ende noch Stephan IX. in Lothringen.
Später haben wir noch Hadrian VI., der ist in Utrecht geboren, da gibt es seit Jahrhunderten Streit, ob er jetzt Deutscher oder Niederländer ist, das ist so die Befindlichkeiten, das können die gerne unter sich aus machen. Und dann haben wir eben mit Benedikt XVI. den einzigen deutschen Staatsbürger unter den Päpsten, der jetzt aktuell vorletzte Papst. Der Wahllort ist tatsächlich erst seit 1878 fest, die Sixtinische Kapelle.
Vorher wurde sie auch verwendet, aber dann wird das mehr oder minder üblich und erst 1996 wird das festgelegt, dass die Sixtinich-Kapelle wirklich der Wahlort ist. Hier sehen wir sie von außen, hier sehen wir sie von innen, sehr berühmt Deckengemälde und so, Michelangelo, berühmte Gemälde, aber auch der Band, haben wir ein paar andere große Namen, unter anderem Botticelli, also ein Wahnsinnskunstwerk und in genau dieser Kapelle wird eben gewählt. Bis 1870 war der Quirinalspalast üblicher, der jetzt eben Sitz des italienischen Staatspräsidenten ist.
Historisch sehr oft der Sterbeort des Papstes. Es war selten festgelegt, aber es war sehr üblich, dass man am Ort, an dem ein alter Papst gestorben ist, auch die Wahl des Neuen abgehalten hat. Deswegen haben wir eine ganze Menge Papstwahlen so kreuz und quer in Italien. Bis zur zweiten Papstwahl 1978, das waren drei Päpstjahre, da hatten wir zwei Konklave und bis zum zweiten blieben die Kardinäle in der Sixtinienkapelle eingeschlossen. Da wurden auch Betten aufgebaut, die sind jetzt tatsächlich komplett drin gewesen.
Heute beziehen sie ein Gästehaus, dessen Rollläden allerdings geschlossen bleiben. Es darf kein Tageslicht in die Zimmer und es gibt immer noch eine völlige Abschattung von der Außenwelt, insbesondere von Medien. Das ist tatsächlich auch nach kanonischem Recht festgelegt. Da darf überhaupt keine
kein Kontakt aufkommen. Und neben den wahlberechtigten Kardinälen gibt es auch Personal, es gibt Priester für die Beichte, es gibt Leute, die Personal versorgt und so weiter, Assistenten, Schweizer Garde, davon dürfen erstmal etliche mit in die sowohl ins Gästehaus als auch dann in die Sixtinische Kapelle. Beim eigentlichen Wahlgang dürfen allerdings ausschließlich Wahlberechtigte anwesend sein.
Dieses Jahr, also 2025, werden auch weder der Kardinaldekan noch der Kardinalsubdekan anwesend sein. Beide fallen wegen Alter raus. Die spielen da keine Rolle. Das Ganze beginnt mit einer Messe, die gelesen wird von diesen Kardinälen. Dann ziehen sie in die Sixtinische Kapelle ein. Die Kardinäle werden vereidigt. Es kommt dann zum berühmten Ausspruch extra omnes, alles raus. Alle, die nicht wahlberechtigt sind, müssen die Kapelle verlassen und die wird versiedelt.
Jetzt heutzutage nur noch bis sie abends ins Gästehaus dürfen. So ungefähr sieht das dann aus, also das ist zumindest ein Bild, das um ein Konklave herum entstanden ist, da sieht man genau die Sixtinische Kapelle und ganz ganz viel Kardinäle in ihrem Kardinalspurpur, der gar kein Purpur ist, sondern es ist scharlachrot.
Am ersten Tag des Wahlgangs gibt es einen Wahlgang, an den folgenden Tagen jeweils zwei am Vor- und Nachmittag, also vier insgesamt. Und die Kardinäle erhalten einen Wahlzettel mit der Aufschrift Eligio in Summum Pontificem. Ich wähle zum obersten Pontifex.
Da schreiben sie den Namen rein, der wird dann mehrfach gefaltet und mit einem Gebet in die Urne gesteckt. Dann gibt es eine Auszählung mit drei Wahlhelfern, die das Ganze parallel zählen und nach jedem Wahlgang werden diese Wahlzettel dann verbrannt. Das ist dann ganz bekannt, dieser schwarze oder weiße Rauch.
Der Schornstein, die Sixtinische Kapelle, hat natürlich keinen Ofen. Da wird dann von der Vatikanischen Feuerwehr, die gibt es tatsächlich, einen Ofen eingebaut. Und der Rauch, dieser weiße und schwarze Rauch, wird heute durch Zugabe von Inhaltsstoffen erzeugt. Also der ist nicht wie früher irgendwie durch Werk oder sonst was. Da werden tatsächlich chemische Stoffe zugesetzt. Gibt es dann tatsächlich einen gewählten Kandidaten, wird der gefragt, nimmst du deine kanonische Wahl zum Papst an? Und als zweite Frage, mit welchem Namen willst du gerufen werden?
Dann kommt der neu gebildete Papst in den sogenannten Raum der Tränen. Dort hängen drei Zutaten in weiß in verschiedenen Größen bereit, außerdem eine Stohle aus Goldbrokat. Die legt der neue Papst dann an, setzt sich auf einen Schemel in der Nähe des Altars und nimmt die Gehorsamsversprechen aller Kardinäle entgegen. Der Kardinäle als Protodiakon, also der
dienstälteste Kardinalsdiakon verkündet dann von der Mittellogia des Peterdoms Anutio Phobis Gaudium Magnum Habemus Papam. Ich verkünde euch große Freude, wir haben einen Papst. Und zumindest davon haben wir auch ein Bild aus der
Konzilschronik aus Konstanz, da ist noch kein Rauch im Spiel, da wird offensichtlich eine Fahne herausgehalten, aber auch hier haben wir diese öffentliche Verkündigung an die Welt quasi, es wurde ein Papst gewählt, es gibt einen neuen Papst. Bis 1963 gab es da noch eine Papstkrönung.
Also, es gibt eine Papstkrone, hier haben wir diese dreifach gestaffelte Tiara, die auch ganz lange noch im Wappen zu sehen ist. Paul VI. war der letzte Papst, der eben 1963 mit so einer Tiara gekrönt wurde, der legte sie aber während des Zweiten Vatikanischen Konzils ab.
Hat sie gespendet gegen den Hunger der Welt, wurde verkauft, die Einnahmen wurden behalten und seitdem ist die Mitra als tatsächliche Chronik nicht mehr in Gebrauch. Es gibt immer wieder welche, Päpste kriegen die auch gerne mal als Geschenk überreicht oder so etwas von irgendwelchen Staatsbesuchern. Und seit Benedikt XVI ist sie auch nicht mehr im Wappen zu sehen. Ihr habt vorhin auch gesehen, Wappen des Papstes mit Tiara, inzwischen wird diese Mitra verwendet, die zwar diese Streifen hat und damit einer Tiara sehr ähnlich sieht, aber offiziell ist es jetzt eine Mitra.
Auch bei Konklaben haben wir Superlative. Das längste Konklave ab 1286 im Viterbo hat zwei Jahre, neun Monate und zwei Tage gedauert. Das ist auch so. Ab dann ist das Konklave recht gut geregelt.
Die Kardinäle wurden erst im bischöflichen Palast eingesperrt, dann hat man ihnen nur noch Wasser und Brot gegeben und am Ende hat man sogar das Dach abgedeckt. Und da gibt es zwei unterschiedliche Varianten. Entweder wollte man sie dazu zwingen, durch quasi fehlendes Dach, Regen, Kälte, sich schneller zu entscheiden. Oder die Kardinäle hätten selbst darum gebeten, damit der Heilige Geist direkt zu ihnen kommen kann und sie inspirieren kann. Ja, zwei Jahre, neun Monate, zwei Tage für eine Wahl. Irre.
Die kürzesten Konklave waren, je nachdem, Gregor IX. 1227 oder Julius II. 1503, die beide am ersten Tag schon gewählt worden sind.
Ich habe eben ein Drei-Päpste-Jahr erwähnt, das haben wir tatsächlich häufiger, nämlich ganze 14 Mal in der Kirchengeschichte. Zuletzt 1978 als Drei-Päpste-Jahr, da erinnern sich ein paar Leute vielleicht noch dran. Im Jahr 1276 gab es sogar vier Päpste, da wurde tatsächlich ganze drei Mal ein Konklabe abgehalten. Und alle Konklaben der jüngeren Zeit waren sehr kurz gehalten.
Gregor XVI. Nach 50 Tagen im Jahr 1851 war das letzte Mal, dass wir wirklich ein langes Konklave hatten, wo das wirklich gedauert hat. Die ganzen letzten waren sehr, sehr kurz, maximal ein paar Tage. Also wir können aus diesem Mal damit rechnen, dass es relativ schnell geht. Ja, Päpste, wie gesagt, wir haben alle eine Vorstellung, gerade zum Thema Mittelalter, aber auch heute. Ihr habt aber gesehen, das ist eine lange Entwicklung, bis der Papst zu dem wird, was wir uns heute darunter vorstellen. Konklave, auch
Die Idee ist eine uralte Tradition und wir haben gerade mitbekommen, die Sextinische Kapelle ist noch gar nicht so lange verbindlich. Das haben wir noch nicht so lange. Auch die Regeln sind zum Teil relativ neu. Da haben auch die letzten Päpste alle etwas dran rum gemacht. Also Benedikt XVI. hat Regeln verändert. Auch kurz vor seiner Amtsniederlegung hat er nochmal die Regeln verändert. Nämlich genau diese Sache, ob es eine Stichwahl gibt oder nicht. Das wurde mehrfach verändert. Und auch Franziskus hat nochmal einiges an diesen Regeln modifiziert. Also die
Das Konklave ist gar nicht so eine festgeschriebene Tradition, das ist bis heute in Bewegung. Es gibt auch aktuelle Reformvorschläge, wie man das ändern kann. Einer der Reformvorschläge sagt vor allem wieder mehr.
oder ausschließlich italienische Kardinäle. Die Kardinäle sollen in der Nähe von Rom sein, weil es wenig Sinn bringen würde, wenn aus aller Welt diese Leute zusammenkommen, die sonst gar nicht viel Kontakt haben und da erstmal sich kennenlernen müssten und so. Also das ist eine innerkirchliche Diskussion, da mische ich mich nicht ein. Aber man sieht eben, das Ganze ist nichts, was so festgelegt ist, wie man es gerne hätte oder wie man es sich vorstellt. Da ist noch sehr, sehr viel mehr Bewegung. Und ihr habt so ungefähr mitbekommen, was gerade jetzt in Rom passieren wird. Also die
Darstellen des Konklaves von heute ist genau das, was wir jetzt da
nicht sehen werden, weil es hinter verschlossenen Türen ist. Wir werden auch eigentlich nicht viele Inhalte mitbekommen, weil man soll nicht darüber reden. Es gibt aber immer wieder Sachen, die durchgestochen werden, also auch die Wahl Benedikt XVI., also Karnal Ratzinger. Da ist auch relativ genau die Stimmverhältnisse am Ende rausgekommen. Also da kommt schon mehr raus, als es sein sollte. Aber letztlich werden wir als normale Zuschauer gar nicht viel davon sehen. Deswegen dachte ich, es interessiert euch vielleicht, was da genau passiert und wo das Ganze herkommt.
Ja, nicht mein Hauptthema, hat man vielleicht gemerkt. Ich hatte schon unterhaltsamere Videos, aber ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen über das, was gerade in der Welt passiert. Schreibt mir in die Kommentare, schreibt mir alle meine Zahlenträger, alle die Papstnummern, die ich durcheinander gebracht habe. Wie oft habe ich statt das Konglave, der Konglave oder die Konglave gesagt? Könnt ihr alles in die Kommentare schreiben. Ich freue mich drüber. Wir sehen uns nächste Woche wieder mit einem anderen, einem neuen Thema. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund.
