
Die 70er: Atomkraft - Nein danke! (11/12)
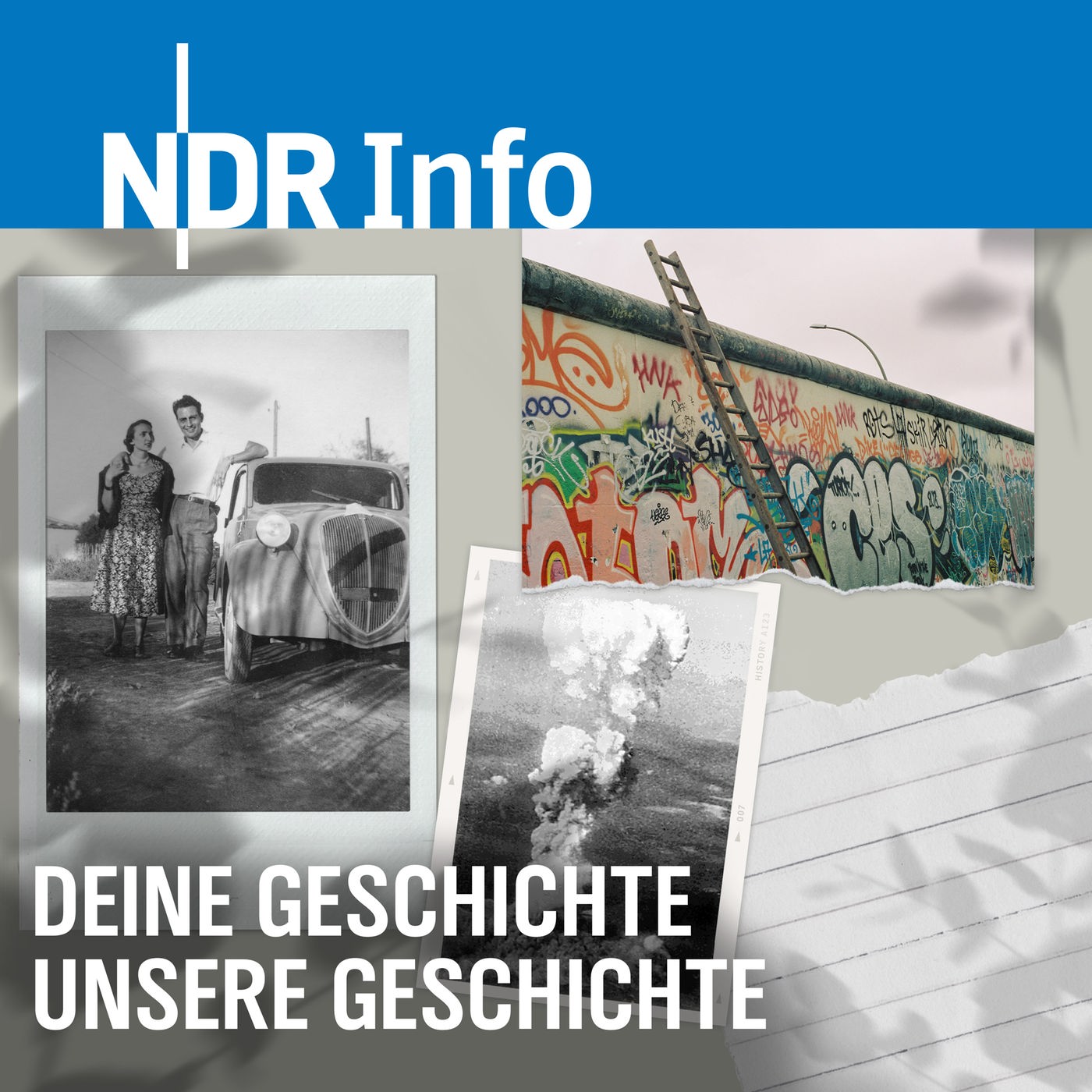
Deine Geschichte – unsere Geschichte
Deep Dive
- Die Besetzung des Bauplatzes für das Atomkraftwerk Wyhl im Februar 1975 markierte den Beginn der Anti-Atomkraft-Bewegung in der Bundesrepublik.
- In Brockdorf entstand eine Bürgerinitiative, die sich gegen den Bau des Atomkraftwerks aussprach.
- Die Proteste in Wyhl führten zu einem befristeten Baustopp und letztendlich zur Einstellung des Projekts im Jahr 1994.
Shownotes Transcript
Es wurde im Herbst 1973 bekannt, dass hier das Atomkraftwerk gebaut werden sollte. Wir sind der Meinung, dass man beispielsweise bei der Stromerzeugung verstärkt auf Kernenergie übergehen soll. Und dann kam diese Nacht- und Nebelaktion. Und an der ungeschützten Flanke direkt am Deich eine zwei Meter hohe Mauer, bewährt mit Stahlgittern und einer messerscharfen Spirale aus sogenanntem NATO-Draht.
Also jetzt im Verlauf der Demos wurde unheimlich Panik gemacht von Seiten der Landesregierung. Am Abend kam es zu einer regelrechten Schlacht in das schwer befestigte Baugelände in Brockdorf. Das habe ich hier noch nie erlebt, wenn man nie auf dem Lande wird. Um 21 Uhr sind Gesetz und Ordnung wieder hergestellt. Die Bauarbeiten können weitergehen. Deine Geschichte. Unsere Geschichte. Ein Podcast von NDR Info.
Ich glaube, unsere Stärke hier vor Ort war politisch gesehen, dass wir kontinuierlich am Ball geblieben sind.
Und letztlich haben wir ja auch erreicht, dass keine AKWs mehr gebaut werden und sie jetzt auch abgeschaltet werden. Der Widerstand war auch nicht so ausgehend von der Angst geprägt, sondern einfach von diesem Unrecht, wie hier mit uns umgesprungen wird. Der kam nicht aus der Angst davor.
sondern wirklich dieses Durchhalten, dass man es angehen kann, dass so mit Leuten und so eine Region so umgegangen wird. Dass man sich wirklich zur Wehr setzen muss. Das war für mich schon entscheidend. Atomkraft, nein danke. Seit dem Reaktorunglück im japanischen Fukushima 2011 folgt die Regierungspolitik in Deutschland dem Slogan der Anti-AKW-Bewegung.
Zwar gibt es angesichts der Energiepreisexplosion infolge des russischen Angriffskriegs in der Ukraine und denkbarer Engpässe bei der Versorgung Anhänger der Kernenergie, die versuchen, das Rad der Zeit zurückzudrehen. Aber die Mehrheit der Deutschen ist wohl nur für einen pragmatischen Umgang mit den Ressourcen der noch laufenden Atomkraftwerke zu haben, nicht für den Bau neuer AKWs. Und auch die Energiewirtschaft hat sich längst umorientiert in Richtung erneuerbarer Energien.
Das war anders in den 70er Jahren, als die Anti-Atomkraft-Bewegung entstand und sich von lokalen Initiativen zu einem breiten Bürgerbündnis entwickelte. Die Zeitzeugen unserer heutigen Folge, Heinrich Voss und Christine Schär, haben diese Entwicklung am Beispiel des Kernkraftwerks Brockdorf miterlebt und auch mitgestaltet.
Beide waren dort in der Anti-Atomkraft-Bewegung aktiv. Sie haben sich bei den Aktionen kennen und auch lieben gelernt. Und sie leben bis heute in Sichtweite zur mittlerweile, muss man sagen, ehemaligen Atommeiler.
Atomkraft, ja bitte, so hatten wir eine unserer Podcast-Folgen über die 60er Jahre überschrieben. Die friedliche Nutzung der Kernenergie versprach, alle Energieprobleme einer boomenden Industrienation zu lösen. Überall auf der Welt wurde das so gesehen. Wissenschaftler warben für und Politiker setzten auf die Kernenergie. Es gab nur wenige, die diese Euphorie kritisierten und vor den Folgen warnten.
Im Juni 1961 ging das Kernkraftwerk Kahl als erstes kommerzielles AKW der Bundesrepublik ans Netz. In der DDR war es 1966 das Kernkraftwerk in Rheinsberg. 1973, als die erste Ölpreiskrise im Westen das Bewusstsein dafür weckte, dass eine sichere und günstige Energieversorgung nicht selbstverständlich ist, schien die Kernenergie der ideale Ausweg.
Mit ihr würde es Versorgungssicherheit geben, glaubte man. Das vierte Atomprogramm der Bundesregierung vom Dezember 1973 sah daher einen massiven Ausbau in diesem Bereich vor. Innerhalb von 15 Jahren sollte der Anteil der Kernenergie am gesamten Energiebedarf auf nahezu 50 Prozent steigen.
Die Risiken, sei es bei der Produktion oder bei der Endlagerung der Brennstäbe oder aber eines Unfalls, die Risiken hielt man für beherrschbar.
Und die Kernkraft schien sich als Energieform auch im Hinblick auf den Umweltschutz anzubieten, der ab Anfang der 70er Jahre auch in der Politik allmählich eine Rolle zu spielen begann. So beschreibt Bundeswirtschaftsminister Hans Friedrich von der FDP in einem Interview 1973 das unter dem Eindruck der Ölpreiskrise entwickelte Energiekonzept.
Wir sind der Meinung, dass man beispielsweise bei der Stromerzeugung verstärkt auf Kernenergie übergehen soll. Kernenergie hat den Vorteil, dass sie keine Abgase verursacht, dass sie keinen Sauerstoff verbraucht. Hier ist das Kühlproblem allerdings zu lösen. Das wird aber technologisch lösbar sein.
1973 begann für Heinrich Voss auch seine persönliche Geschichte mit der Kernenergie, als die schleswig-holsteinische Landesregierung beschloss, nur ein paar hundert Meter entfernt, direkt an der Sichtachse seines Bauernhofes, ein Atomkraftwerk zu bauen. Es wurde im Herbst 1973 bekannt, dass hier das Atomkraftwerk gebaut werden sollte.
Und daraufhin haben sich die Bürgermeister der Gemeinden hier, das AKW muss ich einflechten, wird direkt an der Gemeindegrenze zwischen Brockdorf und Wilfersburg gebaut, also wie es so häufig ist. Und dann nehmen wir Sachen, bringt man irgendwie an die Grenze. Das erleben wir immer wieder. Also die beiden Bürgermeister haben sich zusammengetan, waren sozusagen die Urzelle der Bürgerinitiative und haben dann eine Abstimmung in den Gemeinden auf den Weg gebracht. Und in beiden Gemeinden hat sich die Mehrheit der Leute geäußert.
eindeutig dagegen ausgesprochen. Man hat dann diese Wahlergebnisse insofern verfälscht, dass man gesagt hat, okay, die Wahlbeteiligung war irgendwo bei 70 Prozent und wenn man das auf 100 Prozent rechnet, dann ist es doch eine Minderheit, die dagegen ist. Also
Das ist absurd, kennt man sonst nur aus Diktaturen. Heinrich Voss wusste bis dahin überhaupt nicht viel über das Thema der friedlichen Nutzung der Kernenergie. Aber dass ein Kernkraftwerk so nah an seinem Hof errichtet werden sollte, hat ihn dazu gebracht, sich in die Thematik richtig reinzuknien, wie er sagt. Ich war völlig irritiert, weil kurz zuvor hatten die norddeutschen Bundesländer vereinbart,
an der Elbe Industrie-Schwerpunkte einzurichten. Also Brunnspüttel und Stade, um eine Bandbebauung an der Elbe zu vermeiden. Also man wollte Industrie-Schwerpunkte und den Rest der Elbe naturnah erhalten. Und dies war so ein Ausbruch aus diesem Konzept. Und das Konzept war erst ein Jahr alt. Also ich war...
Ja, das hat mich irritiert. Und er hatte auch Angst. Klar, einmal das Unfall-Szenario, obwohl das in so großem Stil scheinbar noch nicht passiert war, aber das war ja bekannt. GAU, die Gülsü anzunehmende Unfall. Dann ein wichtiges Argument war ja die permanente Abgabe von radioaktiven Stoffen, die Anreicherung landwirtschaftlichen Nahrungsmittel, also über die Kühe in die Milch und dass die Milch nicht mehr verkäuflich war. Also dass die landwirtschaftliche Nutzung hier...
Sie sind ja Milchbauer. Hatten Sie auch Angst um Ihre Existenz? Ja, sicher. Die Sorge spielte eine wichtige Rolle.
Die Sorge der Bauern und Winzer um ihre Existenz stand auch am Anfang des Widerstands gegen ein Atomkraftwerk in Wiel in Baden-Württemberg, der allgemein als Geburtsstunde der deutschen Anti-Atomkraft-Bewegung gilt. Auch vorher gab es Proteste und Einsprüche gegen den Bau von Atomanlagen auf regionaler Basis. Anderswo wurden die Kraftwerksbetreiber mit offenen Armen empfangen, weil sie Arbeitsplätze und Gewerbesteuer versprachen.
In Wiel am Kaiserstuhl fürchteten die Winzer, die Dampfschwaren der Kühltürme eines AKW könnten zur Verschattung und einem veränderten Mikroklima führen. Ihren Protesten schlossen sich die Studierenden aus dem nahen Freiburg an, für die die Risiken der Kernkrafttechnologie im Vordergrund standen.
Am 18. Februar 1975 besetzten sie den Bauplatz für das AKW. Am Morgen nach der zweiten Nacht rückte die Polizei mit Wasserwerfern und Hundestaffeln an und räumte den Platz, was zu bundesweiter Aufmerksamkeit führte.
Auch die Gegner des AKW in Brockdorf bekamen natürlich mit, was sich da in Wiel abspielte. Ja, Begeisterung. Ja, natürlich, auch anderswo passiert was. Nicht nur hier bei uns. Auf jeden Fall, ja, Begeisterung. Klar, jede Aktion, die auch anderswo stattfindet, bestärkt einen doch. Das ist doch klar. Das ist ja...
Ja, der Anfang der Vernetzung. Jedenfalls habe ich das mit Begeisterung zur Kenntnis genommen. Wenige Tage nach Räumung des Bauplatzes in Wiel wurde er erneut besetzt. In den nächsten Wochen entstand dort ein regelrechtes Dorf mit Holzhütten, Imbissbuden und einem Freundschaftshaus in der Mitte, in dem Vorträge gehalten wurden und über Atomkraft diskutiert, aber auch Theater gespielt und miteinander gesungen wurde.
Im Spätherbst 75 verließen die AKW-Gegner das Hüttendorf. Die baden-württembergische Landesregierung hatte sich auf Verhandlungen eingelassen und es gab einen befristeten Baustopp. 1994 wurde das AKW-Projekt in Wiel endgültig eingestellt.
Das AKW Brockdorf wurde gebaut und ging 1986 in Betrieb, trotz der Proteste, die es dagegen gegeben hatte. Heinrich Voss hat damals unheimlich viel Zeit in seinen Kampf gegen den Betrieb des AKW Brockdorf gesteckt.
Für ihn war das ein zweiter Job, sagt er heute. Immer wenn im Kopf ein bisschen Platz war, dann habe er darüber nachgedacht, sich vernetzt und vor allem intensiv informiert. Wir haben uns dann sehr um Unterschriften bemüht. Damals hatten wir 30.000 gegen den Standort, 30.000 Unterschriften. Wir hatten dann einen Erörterungstermin, der über vier Tage lief. Also wir konnten sozusagen...
So viele Argumente vortragen, so viele Wissenschaftler waren dort, die ihre Sichtweise dargelegt haben gegen die Nutzung der Atomenergie, dass eigentlich klar war, dass man ein Atomkraftwerk nicht bauen kann. Es wurde eigentlich auch sehr schnell klar, dass wenn man ein Atomkraftwerk hier nicht will, auch einerwo kein Atomkraftwerk haben kann.
Insofern war dieser Slogan kein AKW in Brockdorf und auch nicht anderswo schon sehr schnell präsent und in aller Munde. Aber bei der schleswig-holsteinischen Landesregierung fanden die AKW-Gegner kein Gehör. Naja, wir haben gelernt eine andere Sichtweise auf die Politik. Wir haben gesehen, dass unsere Interessen in den Parlamenten nicht wahrgenommen wurden. Also jeweils Genehmigungsbehörde war ja das Land und das Bund. Also es gab keine Genehmigungsbehörde.
Wir haben in diesen drei Jahren Gespräche, also auch in kleineren Kreisgesprächen mit Politikern gesucht und festgestellt, dass sie, ja, okay, aber dass unsere Sichtweise in keiner Weise geteilt wurde. Das Hauptanliegen war, man hat die Steigerung der Energieverbräuche aus der Nachgriffszeit hochgerechnet und hat gesagt, wir brauchen, weiß ich, jedes Jahr ein neues AKW. Musik
Im Herbst 1976 eskaliert die Auseinandersetzung zwischen Staat und Atomkraftgegnern. Der 13. November 1976 wird mit der sogenannten Schlacht um Brockdorf zum Inbegriff gewalttätiger Auseinandersetzungen, wie sie den Kampf um die Atomkraft in den nächsten Jahren an verschiedenen Orten in der Bundesrepublik kennzeichnen sollten.
Heinrich Voss hat mir erzählt, dass die Eskalation nicht völlig aus dem Nichts kam. Um die Demos zu verstehen, müsse man wissen, was in den zwei Jahren zuvor passiert war. Die beiden Erörterungstermine waren geprägt von massiven Polizeieinsätzen, die sachlich überhaupt nicht gerechtfertigt waren. Beim wasserrechtlichen Erörterungstermin wurden Gutachter und einheimische Einwander getrennt. Also wir wurden beteiligt.
Am 25. Oktober 1976 spricht die schleswig-holsteinische Landesregierung die erste atomrechtliche Teilgenehmigung für das Kernkraftwerk Brockdorf aus.
Heinrich Voss sagt, diese Entscheidung sei für ihn völlig unerwartet gekommen. Nee, es gab in der Nacht, am Abend gab es zwar eins, in dem die Gerüchte gehört haben, aber bei mir ist es nicht angekommen. Ich habe es nicht mitbekommen. In der Nacht zum 26. Oktober wird mit den Arbeiten begonnen.
Ich habe es erst am nächsten Morgen erfahren, mitbekommen. Ja, man hat das wirklich militärisch abgesichert, den Bauplatz. Und die Landesregierung, also mit Herrn Stoltenberg, meinte, sie wären besonders schlau, wenn sie das militärisch durchsetzen. Ja, der Bauplatz war abgesperrt, aber wirklich als Nacht- und Nebelaktion und nicht mit...
Ja, wir waren fassungslos, so kann man es auf den Punkt bringen. Auch Christine Schär führte sich total überrumpelt. Ich habe damals in St. Margareten gearbeitet, musste hier zur Arbeit vorbeifahren und dann kam diese Nacht- und Nebelaktion und plötzlich war der Bauplatz besetzt vom Staat. Und ja, das ist einfach ein absoluter Schock gewesen, dass so ein Verhalten möglich ist.
Am 30. Oktober findet die erste Großdemonstration am Bauplatz statt. In einem Bericht des Politmagazins Panorama werden die Ereignisse zwei Wochen später so geschildert. Samstag, 31. Oktober. 6000 Demonstranten sind zur Stelle.
800 überwinden Wassergräben und Stacheldraht und besetzen eine Ecke des Geländes. Dann Wasserwerfer, Tränengas, die chemische Keule. Nach dem Zusammenstoß ist Brockdorf das, was die Staatsgewalt nicht wollte. Symbol des Widerstandes. Heinrich Voss ist vor allem in Erinnerung geblieben, wie viele Menschen damals nach Brockdorf gekommen sind, um sie zu unterstützen. Er hat das Ganze so wahrgenommen. Ich
Ich denke, dass das maßgeblich ist. Und die Gewalt ging eindeutig vom Staat aus, in meiner Wahrnehmung.
Und dass Leute sich dann spontan wehren, kann man ja nachvollziehen. Also man muss sich ja nur mit Gewalteskalationen befassen. Ministerpräsident Gerhard Stoltenberg verteidigt bei einer Pressekonferenz in Kiel das Vorgehen der Polizei. Ich habe nach den jetzigen Erkenntnissen keine Veranlassung, Kritik an der gewissenhaft Erwogenen und Verantwortungsbewussten zuzulassen.
Entscheidung der Leitung der Polizei zu üben. Wer Landfriedensbruch übt, wer Sachbeschädigungen vornimmt, wer rechtswidrig in ein Gelände eindringt und dabei leider auch einzelne Polizeibeamte verletzt, muss als Täter oder Mitbeteiligter auch mit der gesetzlichen Reaktion des Staates rechnen. Musik
Sollte die schleswig-holsteinische Landesregierung die Absicht gehabt haben, die Atomkraftgegner von weiteren Demonstrationen abzuhalten, so ging das Kalkül nicht auf. Für den 13. November rief die Bürgerinitiative Umweltschutz Unterelbe erneut zu einer Demonstration auf. Christine Scheer hat erzählt, dass schon Tage vor den Demos eine gewisse Anspannung in der Luft lag, auf beiden Seiten.
Die Atmosphäre war insofern aufgeheizt, dass schon im Vorwege der Demonstration die Polizeipräsenz in der Region sehr deutlich war. Und dass dann zum Beispiel so etwas passierte, als mein Mann dann nachts aufstand, um einen Kalb zu greifen und über den Hof ging und Licht anmachte.
Da kam kurze Zeit später ein Polizeiauto auf den Hof gefahren und wendete dann wieder, als hier nichts Spektakuläres passiert war, außer Arbeit. Es war schon ein von beiden Seiten spektakuläres Klima. Und das hat natürlich dann auch unseren jungen Leuten mal Spaß gemacht, dann auch nachts mit einem kleinen F4 durch die Gegend zu fahren. Mal gucken, ob jemand hinterher fährt. Also das kann man sich aber einfach heute nicht mehr vorstellen, was das für ein Klima gewesen ist.
Nicht nur nachts, auch tagsüber gibt es Polizeikontrollen. Die nordwestdeutschen Kraftwerke, die den Brockdorfer Atomreaktor bauen wollen, nehmen die Herausforderung auf ihre Weise an. Die Bewachung des Geländes wird verstärkt, die Baustelle zur Festung gemacht.
Der Panoramabericht schildert, wie am Bauplatz aufgerüstet wird. Im Vorfeld noch tiefere Gräben, noch mehr Stacheldraht. Und an der ungeschützten Flanke direkt am Deich eine 2 m hohe Mauer, bewährt mit Stahlgittern und einer messerscharfen Spirale aus sog. NATO-Draht. Im Schichtdienst rund um die Uhr rammen 400 Arbeiter in den Lehmboden der Wilstermarsch, was die NWK eine Sicherungsanlage nennt. Die Bauern ringsum sind drastischer Atom-KZ.
Es gibt allerdings auch Befürworter des Kernkraftwerks, nicht nur in der Politik. Panorama berichtet von einer Demonstration von Mitarbeitern der Nordwestdeutsche Kraftwerke AG, die die Position dieser Befürworter ganz gut zum Ausdruck bringt.
Es gibt ja Arbeitsplätze hier. Wir wollen doch mal versuchen, uns mal einen sozialeren Betrieb in Niedersachsen oder Schleswig-Holstein zu suchen als die NBK. Das ist ja schon mal ein Witz. Und deshalb machen wir uns gerade. Und außerdem ist es so: Es liegen hier in Westdeutschland Tausende von Atombomben. Kein Mensch motzt. Aber jetzt, wo wir anfangen,
Die Kernkraft friedlich zu verwenden, jetzt auf einmal dieser unheimliche Aufstand, das finde ich ja nicht gut. Heinrich Voss hat mir erzählt, dass auch in Brockdorf selbst die Meinungen über das Kernkraftwerk auseinandergingen. Eine echte Belastung für die Bewohner. Die Gesellschaft war hier im Laufe der Zeit gespalten.
Meine Mutter hat sehr untergelitten. Wenn sie zu den Landfrauen ging, wurde sie schief angeguckt, weil ihre Kinder so entschieden dagegen waren und sich auch artikuliert haben. Also das ist so ein persönliches Beispiel, was einen ein bisschen betroffen macht, dass Leute sich ausgegrenzt fühlen, nur weil Familienangehörige sich entschieden dagegen wären. Musik
Der Aufruf der Bürgerinitiative Umweltschutz Unterelbe für den 13. November 1976 zeigt allerdings, dass die Anti-Atomkraft-Bewegung längst nicht nur national, sondern international verankert ist. Nicht nur aus anderen Teilen der Bundesrepublik, sondern auch aus Dänemark oder aus den Niederlanden reisen Demonstrierende an. Unter dem Lärm von Hubschraubern begann die Demonstration um 13 Uhr mit einem sogenannten Feldgottesdienst.
Er ist uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen. Obwohl die Polizei das Gelände weiträumig abgeriegelt hat, kommen zwischen 25.000 und 30.000 an die Baustelle.
Bilder, die sich bei späteren Demonstrationen wiederholten, berichtet Heinrich Voss. Also jetzt im Verlauf der Demos wurde ja unheimlich Panik gemacht von Seiten der Landesregierung, eigentlich zu jeder Demo. Leute haben dann auch ihre Schaufensterscheiben vernagelt. Manche Orte, bedingt durch die Absperrung, kamen eben sehr viele Demonstranten, durch andere Orte nicht.
Und in den Orten, wo die Demonstranten durchgegangen waren auf dem Weg zur Demo, da waren die Leute in den Orten wirklich entspannt und fröhlich. Nach diesen Demo, weil sie Menschen gesehen hatten, viele interessante Menschen, auch im Vorbeigehen. Und in anderen Orten war diese Angst auch nach der Demo noch spürbar. Applaus
Schon während der Ansprachen wird am Bauzaun gekämpft. Nach einem Versuch der Demonstranten, das Haupttor zu stürmen, setzen Polizei und Bundesgrenzschutz Wasserwerfer mit chemischen Zusätzen ein. Etwa 3000 versuchen trotz der Befestigungen, den Bauplatz zu besetzen.
Dann werden Tränengaspatronen in die Menge abgeschossen. Vom Baugelände aus vor allem gegen die Angreifer. Gleich zu Beginn aber werden von dicht über der Veranstaltung kreisenden Hubschraubern der Polizei und des Bundesgrenzschutzes Wasserwerfer und Tränengasbomben auch gegen friedliche Demonstranten eingesetzt.
Viele Menschen wurden auch nass durch die Wasserwerfer und so. Und die wurden überall versorgt. Die Stimmung hier war Hilfsbereitschaft. Die Menschen, die Hilfe brauchen, die andere Klamotten brauchen, die wurden auch hier von meinen Eltern nass. Aber überall, also unabhängig von den absoluten Widerstandswillen, war die Hilfsbereitschaft groß. Also das ist auch eine wichtige Beobachtung, glaube ich.
So massiv die Polizei an diesem 13. November auch auftritt, viele Demonstranten lassen sich nicht einschüchtern. Am Abend kam es zu einer regelrechten Schlacht in das schwer befestigte Baugelände in Brockdorf. Mehrere Stunden lang versuchten einige tausend Demonstranten an verschiedenen Stellen, Mauer und Stacheldraht der NWK-Festung zu überwinden und den Platz zu besetzen. Die Umweltschützer mit friedlichen Mitteln, verschiedene kommunistische Gruppen mit Wurfankern, Drahtscheren und Steinwürfen.
Polizei und Bundesgrenzschutzeinheiten antworteten mit einem Dauerfeuer von Tränengasbomben, Wasserwerfern mit chemischer Beimengung und der chemischen Keule.
Für Christine Scheer wurden die Erfahrungen bei den Demonstrationen in Brockdorf prägend für ihr Verhältnis zur Politik, zu dem Staat, in dem sie lebte, hat sie mir erzählt. Wenn man wirklich sein Recht auf unversehrte Heimat kundtun will, dann auch konfrontiert wird mit Tränengas und solchen Wasserwerfern. Das habe ich hier noch nie erlebt, wenn man hier auf dem Lande wird. Und das macht ja auch was mit einem. Also man muss ja immer gucken, welchem Gefühl gehe ich zu der Demo? Was will ich unterstützen? Was will ich unterstützen?
als Einheimischer hier und wie wird dann mit mir umgegangen und das ist doch sehr prägend für mich gewesen. Zwischen 8 und 9 Uhr abends, als die meisten Demonstranten sich schon zurückgezogen haben, bricht die Polizei aus dem Baugelände aus und räumt die Straßen der Umgebung. Es kommt zu Ausschreitungen einzelner Polizisten, die ohne erkennbaren Grund auf heimkehrende Demonstranten und Kamerateams einprügeln und auch die chemische Keule einsetzen.
Um 21 Uhr sind Gesetz und Ordnung in Brockdorf wiederhergestellt. Die Bauarbeiten können weitergehen. Die Atomkraftgegner unter den Anwohnern versuchen, das AKW Brockdorf auch mit juristischen Mitteln zu verhindern. Im Dezember 1976 verhängt das Verwaltungsgericht Schleswig einen vorläufigen Baustopp, der 1977 verlängert wird. Begründet wird das mit einem mangelnden Entsorgungskonzept.
1981 hebt das Oberverwaltungsgericht Lüneburg den Baustopp auf, weil es Fortschritte beim Thema Entsorgung sieht. Nach Aufhebung des Baustopps findet in Brockdorf die größte Demonstration von Atomkraftgegnern mit rund 100.000 Teilnehmern statt. 1983 zieht Christine Scheer zu Heinrich Voss nach Brockdorf, obwohl direkt nebenan das AKW gebaut wird und sie und ihr Mann sich Sorgen machen, welche Folgen das vielleicht für ihre Kinder haben könnte.
Den Kampf gegen das AKW geben sie aber nicht auf, auch wenn er sehr zermürbend ist. Seine Motivation hat mir Heinrich Voss so beschrieben. Ich habe kürzlich irgendwo in der Runde gesagt, ich bin ein Indigener. Also diese Verwurzelung, glaube ich, spielt eine große Rolle. Dass man sich hier persönlich verwurzelt fühlt, dass man hier seine Perspektive sieht, auf diesem Bauernhof hier sein Berufsleben zu verbringen. Und dann kommt plötzlich eine Sache, die man nicht okay findet, wo man auch nicht den gesellschaftlichen Mehrwert sieht.
Das Entsorgungskonzept, nachdem das Oberverwaltungsgericht Lüneburg den Baustopp für Brockdorf aufhebt, war zum einen der Beschluss der Regierungschefs von Bund und Ländern von 1979, eine Wiederaufarbeitungsanlage zu bauen. Nach langer Standortsuche wird 1985 in Wackersdorf mit dem Bau der WAA begonnen. Nach Protesten der Bevölkerung und aufgrund der Entscheidung der Energiekonzerne wird er aber 1989 eingestellt.
Niedersachsens Ministerpräsident Ernst Albrecht hatte ursprünglich 1977 den Plan vorgelegt, in Gorleben ein nukleares Entsorgungszentrum zu bauen mit Wiederaufarbeitungsanlage, Brennelementefabrik, zwei Zwischenlagern und einem Endlager für hochradioaktive Abfälle.
1979, nach dem Atomunfall im amerikanischen Kernkraftwerk Harrisburg und aufgrund der Proteste in der Bevölkerung, nahm er Abstand vom Bau der WAA in Gorleben, nicht aber vom Gesamtkonzept. Am 31. März 1979 gab es einen Track der Bauern und Bürger aus Lichaudannenberg nach Hannover, der dort von 100.000 Demonstrierenden begeistert empfangen wurde.
Dieser Dreck wurde zum Symbol für den weiteren Kampf gegen die Atomkraft in den 80er Jahren. Die Anti-Atomkraft-Bewegung ist dann auch eng verbunden mit dem Aufstieg einer neuen, bundespolitisch wirksamen Partei, den Grünen.
Christine Scheer hat mir erzählt, dass die Brockdorfer Atomkraftgegner den Widerstand in Gorleben begrüßt und natürlich unterstützt haben, so wie sie sich auch über die Solidarität der Niedersachsen in Brockdorf gefreut hatten. Überhaupt hatte man sich ständig ausgetauscht und vernetzt. Ja, wir sind mehrfach zum Demonstrieren in Gorleben gewesen, haben selber auch mal eine Fahrradtour dahin gemacht und da auch ein paar Leute kennengelernt. Also das war ja schon wichtig für mich.
Weil im Grunde genommen ja Brockdorf weitergebaut wurde mit dem Hinweis darauf, dass die Brennstäbe nachher in Gorleben eingelagert werden können. Dass man das also wirklich zusammenführt, den Widerstand. So singt doch Vogelsing, dass Gorleben lebt. Dass dort der Totengräber seine eigene Grube gräbt.
Der Atomunfall in Harrisburg 1979 hatte nicht verhindert, dass der Baustopp für das AKW Brockdorf 1981 aufgehoben wurde. Die nukleare Katastrophe von Tschernobyl im April 1986 verhinderte nicht, dass das AKW Brockdorf im Oktober 1986 in Betrieb genommen wurde.
Seither leben Heinrich Voss und Christine Schär mit dem Kernkraftwerk nebenan. 35 Jahre lang schauen sie auf den Atommeiler, jeden Tag.
Also ich habe das als eine große Belastung empfunden, auf jeden Fall. Weil im Grunde genommen, was hier für mich unsere Region ausmacht und was mir am liebsten ist, das ist die Elbe. Das ist der große Fluss und da konnte man immer hingucken, die Schiffe fahren, sehen. Dafür war extra das freigehalten worden auf dem Hof seit Generationen von Bepflanzung. Und jetzt hat man sich das zugepflanzt, damit man nicht immer da drauf guckt. Und dann ist es ja so, dass das Ding ständig beleuchtet war.
Mit Jahren nicht wieder jemand auf dumme Gedanken kommt, aber auch so eine Ausstrahlung, wir sind hier wehrhaft. Und es wurde nie mehr dunkel. Es wird auf dem Hof nachts nicht dunkel, es war immer Licht. Und sowas habe ich als große Belastung empfunden. Aber auch wenn sie den Kampf gegen den Bau des Kernkraftwerks in Brockdorf verloren haben, als Atomkraftgegner hätten sie am Ende ja doch gewonnen, betonen Heinrich Voss und Christine Scheer immer wieder während unseres Gesprächs. Ich habe das insgesamt dann doch als eine wirklich positive Erinnerung insgesamt gesehen wirklich abgespeichert bei mir.
Die Angst vor möglichen Folgen der Atomkraft bewegte die Anti-AKW-Bewegung. Sie trieb aber auch diejenigen an, die sich ab Ende der 70er Jahre in der Friedensbewegung engagierten.
Im Dezember 1979 wurde der sogenannte NATO-Doppelbeschluss gefasst, der als Reaktion auf die Aufrüstung der Sowjetunion mit SS-20-Mittelstreckenraketen die Stationierung von Nuklearraketen ankündigte, falls Abrüstungsgespräche bis 1983 nicht zum Erfolg führen würden.
Dagegen protestierten Hunderttausende. Darum geht es in der nächsten Folge von Deine Geschichte, unsere Geschichte.
Unser Zeitzeuge ist dann Bernhard Fitzner. Der heute 73-Jährige war Ende der 70er Jahre, aber insbesondere dann in den 80er Jahren sehr aktiv in der Friedensbewegung in Hannover. Für die große legendäre Friedensdemo am 10.10.1981 in Bonn organisierte er die Sonderzüge für mehrere tausend Mark. Die Verträge mit der Deutschen Bundesbahn und die Fahrkarten hat er übrigens heute noch.
Alex und Dennis haben den Podcast diesmal mit uns produziert. Ihr findet, sie finden diese und alle anderen Podcast-Folgen in der ARD Audiothek. Fotos, Filme und Texte zu den einzelnen Folgen gibt es unter ndr.de-geschichte. Und über Lob und Kritik freuen wir uns unter der E-Mail-Adresse deinegeschichte.ndr.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.