
Die 70er: Die Anfänge der Schwulenbewegung (6/12)
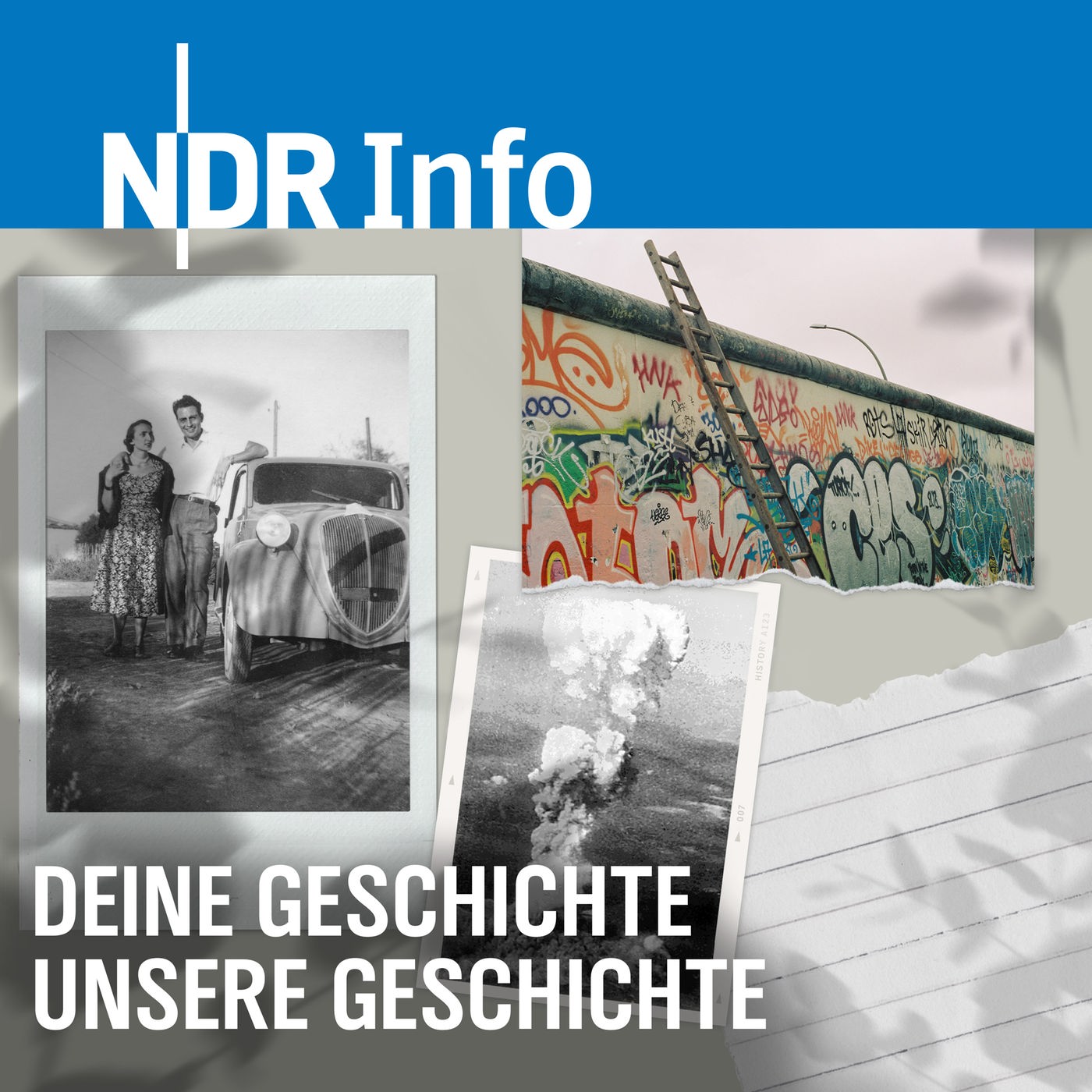
Deine Geschichte – unsere Geschichte
- Stonewall-Aufstand als Beginn der internationalen Schwulenbewegung
- Rosa von Praunheims Film als Initialzündung der deutschen Schwulenbewegung
- Gründung von homosexuellen Aktionsgruppen in den 70er Jahren
- Erfahrungen von Thomas Grossmann mit seinem Coming-out und seinem Engagement in der Hamburger Schwulenbewegung
Shownotes Transcript
Es war also überhaupt keine Bereitschaft bei vielen Leuten in den 60er Jahren noch eine Offenheit zu zeigen gegenüber allem, was anders als heterosexuell ist. Da in der Großstadt kann man anonym leben, man kann untertauchen in der Masse. Ich wollte, dass sich was an unserer Situation verändert. Ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass die Nazis, die wir alle so gehasst haben, heute noch unter uns sind und leben und
und dass die die Homosexuellen noch genauso betrachten wie in früheren Jahren. Sex gehört zum Leben, von daher, wenn schwuler Sex bestraft wird, wird damit eigentlich schwules Leben bestraft. Ich würde wahrscheinlich Schwierigkeiten mit meinen Kollegen bekommen. Sie würden das wahrscheinlich nicht respektieren oder so weit tolerant sein, dass sie eben meine Veranlagung anerkennen. Es war unglaublich spannend, weil wir waren wirklich die Ersten, die gesagt haben,
Wir wollen was verändern. Und wenn es noch so lange dauert. Deine Geschichte, unsere Geschichte. Ein Podcast von NDR Info. Deine Geschichte erzählt dein Leben. Unsere Geschichte erzählt von unser aller Leben. Ich habe Zeitzeugen gefragt. Ich habe in den Tonarchiven recherchiert. Deine Geschichte, unsere Geschichte. Die 70er, Folge 6, die Anfänge der Schwulenbewegung.
Willkommen zu einer neuen Folge unseres Geschichtspodcasts mit Ulrike Bossel und Franziska Ammler. In der Zeit habe ich mich lösen können, Gott sei Dank, von vielen Dingen, die ich vorab gelesen oder gehört habe oder die gesagt wurden über Homosexualität. Ich habe einfach nur gemerkt, es ist so, das hat was mit mir zu tun und ich habe mich nicht mehr so viel mit dem Thema Homosexualität beschäftigt.
Ich will dann auch so leben und ich will mir nicht von jemand anderem vorschreiben lassen, das ist irgendwas Strafwürdiges oder das ist irgendetwas Schlimmes, sondern ich finde, dass das in Ordnung ist und ich fordere für mich schon, habe den Anspruch, dass ich auch so leben kann und dass ich da nicht deswegen angegriffen oder sogar angeklagt werde. Ein junger Mann, der sich offen zu seiner Homosexualität bekennt. Das war nicht selbstverständlich Anfang der 70er Jahre.
Erst 1969 war im Zuge der großen Strafrechtsreform auch der Paragraf 175 überarbeitet worden, der bis dahin jede Form von Homosexualität unter Strafe stellte. Seit der Reform war homosexueller Sex unter erwachsenen Männern nicht mehr verboten, was aber nicht bedeutete, dass er auch gesellschaftlich akzeptiert worden wäre.
Unser Zeitzeuge für diese Folge ist Thomas Grossmann, der heute 71-Jähriger hatte sein Coming-out als 20-Jähriger Anfang der 70er Jahre und er hat sich danach sehr in der Hamburger Schwulenbewegung engagiert. Die LGBTQ-Bewegung hat viel erreicht seit den Anfängen.
Auch wenn vor allem ihre jungen Mitglieder die Defizite sehen und beklagen, allein die Tatsache, dass und wie offen über sexuelle Selbstbestimmung diskutiert wird, wäre damals kaum denkbar gewesen. Und auch wenn noch immer rund 70 Staaten gleichgeschlechtliche Beziehungen diskriminieren und wenn sie in vielen Gesellschaften tabuisiert werden, selbst wenn sie nicht strafrechtlich verfolgt werden,
dass bekennende Homosexuelle heute ganz selbstverständlich Bürgermeister und Minister sein können, dass an Rathäusern die Regenbogenflagge gehisst wird und dass sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität in Deutschland ein anerkannter Asylgrund sind, das sind Errungenschaften des Kampfes von Thomas Grossmann und seinen Mitstreitern. Begonnen hat es mit dem Stonewall-Aufstand im Sommer 1969 in New York.
Von der Weltgesundheitsorganisation wurden gleichgeschlechtliche Beziehungen damals als Krankheit gelistet. In vielen US-Staaten waren sie noch illegal. In New York hatten einzelne Aktivisten seit Mitte der 60er Jahre erfolgreich gegen Diskriminierung gekämpft. Seit 1966 gab es legale Schwulenbars. Die Zahl der Polizeirazzien gegen Homosexuelle war zurückgegangen. Aber es gab sie nach wie vor.
Mit dem Argument Erregung öffentlichen Ärgernisses wurden dann Verhaftungen von Personen begründet, die keine Ausweispapiere dabei hatten oder Kleidung des anderen Geschlechts trugen. Am 28. Juni 1969 um 1.20 Uhr nachts begann die Polizei eine Razzia in der Stonewall Bar in der Christopher Street in Greenwich Village.
Angeblich gab es Verbindungen zur organisierten Kriminalität, aber das war offenbar nicht der Grund des Einsatzes. Schwule und Drag-Queens verkehrten dort, nicht nur Weiße, sondern auch viele Latinos und Afroamerikaner. An diesem Abend aber widersetzten sich die Betroffenen der Verhaftung, es kam zu einer Schlägerei.
Die Polizisten zogen sich in die Bar zurück. Mit dabei war Howard Smith, ein Reporter der Wochenzeitung Village Voice, der sich später erinnerte, wie sie beim Blick aus dem Fenster feststellten, wie die Menge draußen innerhalb von fünf bis zehn Minuten auf tausend, eher zweitausend Menschen anwuchs. Es war wirklich so, dass das Publikum...
Wir konnten durch kleine Schuhe in den Kleidungszimmern schauen. Wir konnten aussehen und wir konnten sehen, dass die Leute, naja, mein Wunsch war, dass es in 5-10 Minuten wahrscheinlich mehrere tausend Leute waren. 2.000, einfach. Und sie schreien, töten die Polizisten, Polizei-Mord, wir werden sie bekommen, wir werden das nicht mehr nehmen.
Sie waren nicht mehr bereit, die Brutalität der Polizei hinzunehmen und forderten andere auf, dagegen aufzustehen. Die Polizei schickte schließlich eine Einheit, die dafür trainiert war, Demonstrationen von Vietnamkriegsgegnern zu bekämpfen, um der Lage Herr zu werden. Doch der Fall war damit nicht erledigt. Die Auseinandersetzungen zogen sich fünf Nächte hin. Vor allem aber wurden sie zum Katalysator einer politischen Bewegung.
Schon kurz nach dem Stonewall-Aufstand gründete sich die GLF, die Gay Liberation Front, die dafür eintrat, dass Schwule und Lesben sichtbar sein sollten, die Voraussetzung für viele spätere Veränderungen in der Gesellschaft.
Für den Hamburger Thomas Grossmann war ein anderes Ereignis Auslöser für sein Engagement. Die Aufführung des Films von Rosa von Braunheim, nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Gesellschaft, in der er lebt. Das ist ja genau diese Haltung, die bei mir auch entstanden war. Also nicht ich bin pervers, sondern das ist pervers, dass die Gesellschaft sagt, deine Liebe, deine Sehnsucht, die du hast oder sowas,
Die ist nicht in Ordnung. Die muss bestraft werden, die muss verhindert werden.
Der Film von Rosa von Braunheim über einen jungen Mann in der Berliner homosexuellen Szene gilt als Initialzündung der deutschen Schwulenbewegung. Er wurde bei den Filmfestspielen in Berlin 1971 Uhr aufgeführt. Die anschließend geplante Ausstrahlung in der ARD scheiterte dann aber erst einmal, weil die Mehrheit der Verantwortlichen meinte, das ihrem Publikum nicht zumuten zu können.
was der Produzent des Films, Günther Rohrbach, in einem Interview mit dem NDR Filmspiegel so einordnete. Wir wissen alle, dass es reife und unreife, aufgeklärte und weniger aufgeklärte Zuschauer gibt. Das ist die Realität des Bildungsgefälles, das wir in unserer Gesellschaft haben.
Und der eine beruft sich halt auf den Reifen und der andere beruft sich unter gewissen Aspekten und wenn es ihm vielleicht gerade auch, ich will das nicht sagen, dass das hier der Fall war bei der Entscheidung der Programmkonferenz, aber es könnte ja sein.
Dass es einem ganz lieb ist, sich auf den unreifen Zuschauer berufen zu können. Der Film »Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Gesellschaft, in der er lebt« lief dann zunächst nur im dritten Programm des WDR-Fernsehens zu später Stunde und dann in verschiedenen Programmkinos in der Bundesrepublik, bevor er etwa ein Jahr später begleitet von einer Diskussionssendung dann doch noch in der ARD ausgestrahlt wurde.
Thomas Grossmann hat den Film damals in Hamburg im Abaton, einem Programmkino, gesehen. Und er war nicht nur begeistert. Der Film hat bei ihm einen gemischten Eindruck hinterlassen, erinnert er sich. Also er war insofern gemischt, weil da ein schwules Leben gezeigt wurde, was bewusst provozierend, provokant sein sollte, sehr komisch.
Also so dieses typisch künstlerisch Interessierte, manieriertes Verhalten, die Lederszene mit nächtlichen Treffen in Parks und auf Toiletten. Das hat er bewusst gemacht, Rosa von Braunheim.
Da konnte ich mich überhaupt nicht drin wiederfinden. Nicht jetzt, weil ich einzelne Aspekte davon abgelehnt habe, sondern ganz viel davon passte nicht zu mir. Denn Schwule wurden in dem Film in einer Art und Weise dargestellt, in der sich Thomas Grossmann einfach nicht wiederfand. Es war ihm zu klischeehaft, sagt er.
Ich habe ja dann später auch lernen müssen, dass ich vielleicht in vielen nicht so dem entspreche, was das Klischee von Schwulen ausmacht. Ich habe zwar kein Fußball gespielt als Kind, aber ich war technisch interessiert zum Beispiel. Ich habe einen großen Bruder gehabt, der auch technisch interessiert war und das hat sehr gut abgefärbt. Und ich bin es immer noch. Und in vielerlei Hinsicht. Oder ich habe erzählt, dass ich in die schwule Disco ging.
einfach keine Lust hatte, mit dem Anzug zu gehen oder mich irgendwie rauszustaffieren für die Szene, sondern ich bin so gegangen, wie ich auch in die Uni gegangen bin. Und das gilt für viele Bereiche. Ich bin kein Opernfan, ich laufe nicht ständig in Ausstellungen und so und das war auch früher schon kaum so.
Also das war dieser Teil, den ich eher befremdend für mich fand. Aber die Botschaft, die Rosa von Braunheim mit dem Film vermitteln wollte, dieses Raus aus den Verstecken und rein in die Öffentlichkeit, dass sich Homosexuelle selbst um ihre Situation kümmern und dafür kämpfen müssten, dass sie sich verbessert, die hat sich sofort bei ihm verfangen. Und vor allem dieses Gefühl zu merken...
Man ist nicht allein, da gibt es andere Leute, die genauso fühlen wie man selbst. Das war schon bei der Ausstrahlung von dem Braunheim-Film so. Hinterher war eine Diskussion. Rosa von Braunheim war dabei und es waren eben diejenigen, die aus der IHWU mitfuhren.
sich engagiert hatten, dass dieser Film gezeigt wurde. IHWO war eine damals in Hamburg aktive Homosexuellenorganisation, die allerdings, so hat es Thomas Grossmann mir erzählt, sehr zurückhaltend und vorsichtig auftrat. Dort hatte man eher die Sorge, dass man mit Provokationen die Leute verschreckt, anders als im Film von Rosa von Braunheim. Und am Schluss haben sie dann dazu eingeladen, sich zu treffen, wer möchte.
Und ich war sofort Feuer und Flamme, weil das wollte ich auch. Und ich wollte auch was verändern. Ich wollte, dass sich was an unserer Situation verändert. Und so haben wir uns zusammengesetzt und überlegt, was können wir machen, damit es so kommt.
Vielleicht sollten wir doch noch einmal einen Blick darauf werfen, wie die Situation der Homosexuellen damals war. Denn auch wenn Sex unter erwachsenen Männern seit der Strafrechtsreform 1969 nicht mehr strafbar war, Homosexualität war damit noch lange nicht als normale sexuelle Identität anerkannt, sondern wurde von den meisten als Abweichung von der Norm Heterosexualität betrachtet.
Thomas Grossmann erzählt, dass auch er sich als Jugendlicher mit dieser vorherrschenden Meinung auseinandersetzen musste, bis er soweit war, sein Schwulsein zu akzeptieren. Also ich habe erstens gemerkt in der Pubertät, da ist was in der Richtung. Auf der anderen Seite war ich nicht so eindeutig festgelegt und konnte mich also auch damit quasi trösten. Ich finde ja Frauen sexuell sehr interessant, also sexuell.
Vielleicht ist das nur irgendwie sowas Vorübergehendes. Und das geht dann weg, das geht vorbei. Also ich kann mich noch daran erinnern, dass ich als 16-Jähriger oder so etwas, da habe ich ein paar, ich hatte mir beim Ausflug nach Dänemark, in Dänemark war damals Pornografie frei, da hatte ich mir ein Heft von einem schwulen Verlag gekauft. Und irgendwann gab es einen Punkt, wo ich dachte, nein, ich muss jetzt mal einen Schnitt machen.
Ich will das nicht sein und habe das dann verbrannt, um so quasi das symbolisch loszuwerden. Das waren so Auswirkungen von dieser Wahrnehmung, dass man als Schwuler diskriminiert ist und abgelehnt wird. Und als Jugendlicher gibt es ja nun eigentlich nichts Wichtigeres, als dass man von den anderen akzeptiert wird.
Zu dem Zeitpunkt, als Thomas Grossmann dann aber klar wurde, was er wirklich will, wohnte er noch bei seinen Eltern. Und als die im Urlaub waren, ging er das erste Mal in eine schwulen Disco, lernte jemanden kennen und übernachtete auch bei ihm. Da habe er einfach gemerkt, das ist das, was er wirklich möchte. Als seine Eltern dann aus ihrem Urlaub zurückkamen, outete er sich. Seine Mutter reagierte zu seinem Erstaunen äußerst gelassen mit den Worten »Meine Güte, ich dachte, es ist was Schlimmes«.
Nachdem er es für sich akzeptiert hatte, wollte er seine Sexualität dann aber auch offen leben und nicht so heimlich, wie das in der schwulen Szene in Hamburg damals üblich war. Ja, sie war hinter verschlossenen Türen. Das ist erstmal schon was Entscheidendes gewesen. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass wir oftmals, eine ganze Reihe von uns, sind in eine Diskothek, die in St. Pauli liegt, gegangen, am Wochenendeabends, freitags, sonnabends, abends.
Und wir haben uns daran gestört, dass die Tür verschlossen war und man musste klingeln. Dann guckte jemand und dann wurde man reingelassen. Und damals haben wir das überhaupt nicht akzeptieren wollen, dass wir hinter einer verschlossenen Tür uns nur treffen dürfen. Das hatte natürlich mit den Grund, dass sie Angst hatten, auch vorzutreten.
Erstens vor Überfällen und zweitens, dass sie selektieren wollten, wer reinkommt. Dass jetzt nicht zum Beispiel massenhaft Frauen reinkommen, weil das wollten sie nämlich. Auch dagegen haben wir protestiert. Warum sollen denn nicht auch Frauen dazugehen? Wenn ich eine gute Freundin habe und mit der gerne dahin gehen möchte, warum darf sie nicht mitkommen? Das fand ich befremdlich. Weißt du jetzt, dass du frei bist? Weißt du jetzt, wer du bist?
Anders als Thomas Grossmann hatten viele Homosexuelle damals durchaus das Bedürfnis, für sich zu leben. So sagt zum Beispiel ein Gesprächspartner in einer NDR-Sendung über homosexuelles Leben im Jahr 1971. Wir sind auch nicht daran interessiert, was in den Schlafzimmern der sogenannten Normalen passiert. Also beanspruchen wir für uns dasselbe Recht,
dass man auch von uns nicht erwartet, dass wir alle unsere Geheimnisse preisgeben und dass wir so eben zurückgezogen leben möchten. Ein anderer weist darauf hin, wie wichtig für ihn Anonymität ist. Ich bin der Meinung, dass der beste Lebensraum für uns im Grunde genommen die Großstadt ist. In der Großstadt kann man anonym leben, man kann untertauchen in der Masse, was ja leider immer noch
aus der Vergangenheit stammt, dieses Untertauchen, sich verstecken. Man lebt aber freier, man wird nicht so stark beobachtet wie in einer Kleinstadt oder auf dem Dorf zum Beispiel. Und sie berichten, dass sie auch zwei Jahre nach der Strafrechtsreform und obwohl homosexuelle Beziehungen unter Erwachsenen vom Staat akzeptiert werden, weiter in einer Doppelrolle leben müssten. Dazu bin ich leider gezwungen, denn die Gesellschaft hat sich ja in zwei Jahren nicht verändert.
Ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass die Nazis, die wir alle so gehasst haben, heute noch unter uns sind und leben und die Homosexuellen noch genauso betrachten wie in früheren Jahren. Darf ich noch dazu sagen? Ich würde sagen, das Bewusstsein des Dritten Reiches ist noch nicht abgeschafft worden. Die Nazis sind vielleicht nicht mehr da, aber das Bewusstsein dieser Macht, die damals regierte, das ist noch vorhanden.
Thomas Grossmann hat diese Erfahrung auch gemacht, führt sie allerdings auch auf die verklemmte Sexualmoral zurück, die herrschte, bevor die in den 60er Jahren einsetzende sexuelle Revolution in der Breite der Gesellschaft zu wirken begann. Ja, das Schlimme ist ja, die meisten Leute haben ja gar nicht drüber geredet. Von daher haben sie auch nichts gesagt, sie haben es nur gedacht.
Also das Schlimmste waren natürlich so Sachen wie, die Nazis haben euch ausgerottet oder die Nazis haben quasi da mal was richtig gemacht. Es war also überhaupt keine Bereitschaft bei vielen Leuten in den 60er Jahren noch,
eine Offenheit zu zeigen gegenüber allem, was anders als heterosexuell ist. Oder selbst den Begriff heterosexuell kannten die meisten ja nicht. Also alles, was nicht Beziehung zwischen Mann und Frau ist, wurde nicht toleriert. Holly came from Miami, F.L.A.
Wir haben eben Aussagen aus dem Jahr 1971 gehört, also vor der Bewegung, die durch den Film von Rosa von Braunheim ausgelöst wurde. Ab 1972 gründeten sich in vielen deutschen Großstädten und in den Universitätsstädten schwule Aktionsgruppen. In Hamburg die Homosexuelle Aktion Hamburg.
Auch für Thomas Grossmann war der Rosa-von-Braunheim-Film der Auslöser, sich zu engagieren, wie wir gehört haben. Und er und seine Mitstreiter haben ja dann auch eine ganze Menge Dinge auf die Beine gestellt. Zunächst einmal ging es aber darum, sich zu vernetzen, erzählt er. Zum einen haben wir auch den Kontakt zu anderen bundesweit gesucht, weil das Problem war natürlich damals, wir waren halt ein paar Leute. Im großen Hamburg waren das damals eben ein paar Leute, die sich getraut haben und die sich getroffen haben.
Und ich bin dann zum Beispiel mitgefahren zu einem Treffen, was Leute aus der Gruppe in Berlin veranstaltet haben, zu Silvester. Ich bin über Silvester dort gewesen und da waren dann plötzlich 30, 40.
Das war wieder eine neue Situation. Und wir haben gemeinsam überlegt, was können wir tun, damit sich was ändert. Das Wichtigste sei für die jungen Leute erst einmal gewesen, dass die Strafbarkeit homosexueller Beziehungen generell abgeschafft wird. Denn auch wenn der Paragraf 175 reformiert worden war, für homosexuelle Männer galten andere Regeln als für heterosexuelle Paare. Lesbische Liebe wurde völlig ignoriert. Take a walk on the wild side. Said hey.
Sex gehört zum Leben, von daher, wenn schwuler Sex bestraft wird, wird damit eigentlich schwules Leben bestraft. Und daraus erwuchs dann ja auch die Idee anlässlich der 73, 74 anstehenden zweiten Strafrechtsreform, des Sexualstrafrechts. Die erste Reform war ja 1969, wodurch Homosexualität unbegründet
zwischen Erwachsenen nicht mehr strafbar wurde. Und 1974 ging es eben darum, dass wir sagten, wir wollen, dass der ganze Paragraf 175 gestrichen wird. Und da haben wir dann bundesweit geplant, Aktionen zu machen, Unterschriften zu sammeln gegen den Paragrafen 175. Und plötzlich war Thomas Grossmann mittendrin, nahm bei der Bewegung eine sehr aktive Rolle ein, weil er eben als Student mehr Freiheiten hatte als berufstätige Homosexuelle. Dann hieß es,
trägst du auch dies transparent. Und es gab einfach doch eine ganze Reihe auch in der Gruppe, die mehr Angst hatten, weil sie zum Beispiel berufstätig waren. Ich war Student, ich konnte mir das eher erlauben. Die hatten Angst, dass sie vielleicht aus ihrem Beruf rausfliegen oder sowas, wenn sie das machen. Und so diese Mischung aus Trotz und Mut, die hat einfach dazu geführt, dass ich das gemacht habe und habe erlebt,
dass Menschen eigentlich eher verdutzt und überrascht waren. Aber von feindseligen Reaktionen habe ich gar nicht so viel, ich zumindest nicht viel abgekriegt. Vielleicht hat es wirklich so, wenn man da längs marschiert mutig, dann ist es manchmal so, dass wirklich die Leute eher
überrascht sind und denken, vielleicht hat der ja recht. Dass seine berufstätigen Mitstreiter sich aber offenbar zu Recht Sorgen machten, was denn passieren würde, wenn sie durch solche Aktionen geoutet würden, das zeigen auch die Aussagen aus der NDR-Sendung über homosexuelles Leben von 1971. Ich bin Kaufmann im weitesten Sinne des Wortes.
und ich habe jeden Tag mit sehr vielen Kunden zu tun und ich muss also da schon sehr vorsichtig sein. Ich bin dort, wo ich tätig bin, ziemlich bekannt und ich muss schon sehr viel Rücksicht nehmen. Ich kann also nicht ohne weiteres das tun, was ich vielleicht manches Mal tun möchte. Wie ist es bei Ihnen? Müssen Sie am Arbeitsplatz eine Doppelrolle spielen? Müssen Sie schauspielern? Sicher, ich muss mich...
etwas verstellen, wenn man das mal so sagen darf. Ich muss also den normalen Mann herauslassen. Ich würde wahrscheinlich Schwierigkeiten mit meinen Kollegen bekommen. Sie würden das wahrscheinlich nicht respektieren oder so weit tolerant sein, dass sie eben meine Veranlagung anerkennen.
Ich muss also ein normales Bild abgeben, meinen Kollegen gegenüber. Darf man erfahren, in welcher Berufsbranche, welchen Beruf Sie haben? Ja, ich bin graduierter Ingenieur, ich bin bei der Fliegerei tätig.
Und wenn man einen solchen Beruf hat, sieht das so aus, dass man in diesem Beruf, und das ist Gott sei Dank für mich ein Vorteil, keine homophilen Männer erwartet. Da man immer der Überzeugung ist, dass wenn ein Mann homophil ist, dass er irgendwie einen künstlerischen Beruf hat oder einen ähnlichen Beruf, der vielleicht künstlerische Ambitionen hat.
Bei diesen Aussagen fällt auf, dass die Männer über sich als homophil sprechen. Das ist eine Ausdrucksweise, die vermutlich gleichermaßen dem Selbstschutz geschuldet ist wie den Anforderungen des öffentlich-rechtlichen Radios damals. Schwul war noch negativ und wurde abwertend benutzt. Das hat sich erst verändert, nachdem die Schwulenbewegung den Begriff aufgegriffen und ins Positive gewendet hat. Trotzdem.
Thomas Grossmann erzählt, dass auch die Bewegung anfangs noch den wissenschaftlichen Begriff homosexuell zur Selbstbeschreibung nutzte. Ich kenne Leute, die damals von verzaubert geredet haben und was weiß ich, also lauter so verbrämte Dinge, um bloß nicht auszusprechen, um was es geht. Wir haben gesagt, wir sind homosexuell. Und mit der Zeit war es aber so, dass wir sagten, wir brauchen eigentlich einen Begriff, der nicht so wissenschaftlich steril klingt.
Und eigentlich schwul. Warum sagen wir nicht, ja, wir sind schwul? Und das Tolle war einfach mit der Zeit, dass wir damit diesen Begriff, das Verächtliche und die Schimpfwortcharakter genommen haben, weil wir gesagt haben, ja, ich bin schwul. Und für mich ist das was Positives. Musik
Thomas Grossmann hat erzählt, dass er bei öffentlichen Aktionen Transparente hielt oder Schilder trug. Die erste Schwulendemonstration in der Bundesrepublik fand 1972 in Münster statt. 1973, bei der Abschlussdemonstration eines Pfingstreffens in West-Berlin, kam es dann zum sogenannten Tundenstreit.
Es ging um die Frage, ob man mit Provokationen im Auftreten Solidarisierung verhindert oder ob umgekehrt normales Demonstrieren nicht ein unangemessen angepasstes Verhalten gegenüber der bürgerlichen Gesellschaft sei. Thomas Grossmann hat diesen Streit 1973 miterlebt und kann sich noch gut an ihn erinnern. Es gab im Zuge dieser Demonstration schon eine sehr scharfe Auseinandersetzung zwischen
den eher sehr politisch orientierten Nordeuropäern und den eher italienischen und französischen, die zum Beispiel in Frauenkleidern, also im Fummel, demonstriert haben. Und die beiden Gruppen miteinander sich stritten drum. Die politischen, die hatten das Gefühl, die
Die machen unsere ganze Demo, unsere politische Demonstration kaputt und führen das ad absurdum. Wo dann jeder sagen kann: "Na ja, was sind das denn für Hampelmänner?" Ja, das waren so diese beiden Schwergewichte, die es gab und die nicht immer so gut miteinander konnten.
Ich fand eigentlich beide immer wichtig. Ich hatte nur keine Lust, mir deshalb einen Fummel anziehen zu müssen. Weil ich habe gesagt, ich trage sonst auch keinen Fummel. Warum soll ich ihn jetzt auf einer Demo tragen? Aber ich habe auch nichts dagegen. Das Einzige, was mich stört, dass wenn bei irgendwelchen Beiträgen von der Demo die Rede ist oder gezeigt werden im Fernsehen, werden vor allen Dingen die Paradiesvögel gezeigt. Und damit eigentlich die hunderte andere Person,
die nicht 'nen Fummel anhaben, verschwinden wieder so 'n bisschen. Dagegen hab ich auch was.
Zu diesem Streit sei dann die Enttäuschung gekommen, dass trotz des ganzen Engagements der § 175 StGB zwar noch einmal modifiziert, aber eben nicht abgeschafft wurde. Thomas Grossmann erzählt, dass die Schwulenszene sich daraufhin Mitte der 70er Jahre stark zersplitterte. Er engagierte sich weiter, zum Beispiel beim ersten Schwulen-Kommunikationszentrum in Hamburg.
1975 wurde von der HAH, der Homosexuellen Aktion Hamburg, eine Zeitung der Schwulenbewegung gegründet unter dem Titel Rosa. Das war die Adaption des Rosa Winkel, mit dem Homosexuelle in den KZs des Nationalsozialismus gekennzeichnet wurden.
Bundesweit entstanden ab Mitte der 70er Jahre Schwuleprojekte, Schulen, Cafés. 1978 der erste Schwule Buchladen Prinz Eisenherz in Berlin. Ab 1979 gab es dann die ersten Demonstrationen zum Christopher Street Day in der Bundesrepublik.
Die Regenbogenflagge, die heute alle mit der LGBTQ-Bewegung verbinden, wurde 1978 in den USA entworfen. Sie setzte sich in Deutschland aber erst in den 1990er Jahren durch.
Wie wichtig neben dem politischen Engagement die Selbsthilfeprojekte der Schwulenbewegung waren, wird deutlich in dem, was Thomas Grossmann über seine Erfahrungen in der Beratungsgruppe erzählt, die er damals mit Freunden an der Uni gründete. Also ein Jugendlicher, der anrief und sagte, seine Eltern hätten seinen Freund ins Gefängnis gebracht und er will sich umbringen.
Und ich weiß noch, dass ich wirklich damals am Telefon saß und versucht habe, ihm irgendwie am Telefon, also ohne ihn zu kennen, weit weg Mut zu machen, dass er das nicht macht, dass er trotzdem irgendwie weitermacht. Und habe dann nie von ihm gehört. Und Jahre später...
Bei einer Veranstaltung im Magnus Hirschfeld Zentrum hatten wir hinterher noch ein Gespräch über die Veranstaltung. Und da saß neben mir ein etwas jüngerer Mann und irgendwann stellte sich raus, das war der. Und da ist mir Jahre danach noch ein Stein vom Herzen gefallen, dass er sich nicht umgebracht hat. Weil das natürlich, das ist immer eine Belastung, weil man hat ja nicht die Macht, das zu verhindern. Erst recht am Telefon, wo jeder jederzeit aufliegen kann.
Eine große Rolle spielten die schwulen Verbände dann wieder in den 80er Jahren im Zusammenhang mit der Aids-Debatte und bei der Aids-Hilfe.
Der Paragraf 175 verschwand erst 1994 aus dem deutschen Strafrecht. Das Recht für Homosexuelle war in der DDR sehr viel fortschrittlicher als in der Bundesrepublik und der Paragraf 175 nach der Wiedervereinigung daher nicht mehr haltbar.
Und während Schwule und Lesben in den 70er Jahren noch weitgehend getrennt für ihre Rechte eintraten, kämpfte der Lesben- und Schwulenverband ab 1999 für gemeinsame Interessen wie die Homo-Ehe oder den Abbau von Diskriminierungen in der Gesellschaft. Die Ehe für alle wurde in Deutschland erst 2017 eingeführt. Aber Thomas Grossmann sagt, entscheidend sei, was die Schwulenbewegung erreicht habe, nicht wie lange es gedauert hat.
Ich glaube, ich habe immer schon das Gefühl gehabt, solche gesellschaftlichen Entwicklungen brauchen ziemlich lange. Das hat oft zu Konflikten mit jenen geführt, die sagten, ich will alles und jetzt. Weil ich immer gesagt habe, das kriegst du nicht. Das funktioniert nicht, weil gesellschaftliche Veränderungen gehen nicht so schnell.
Davon war ich immer überzeugt. Und das betrifft alle Dinge. Das betrifft den Punkt Abtreibung, das Recht auf den eigenen Körper, alles Mögliche. Das braucht einfach eine Zeit lang und das ist ein harter, langer Kampf. Und wenn er heute zurückblickt, beschreibt er die 70er Jahre vor allem mit einem Wort. Spannend. Es war unglaublich spannend, weil wir waren wirklich die Ersten, die gesagt haben, wir wollen was verändern.
Und wenn es noch so lange dauert, aber wir wollen das einfach nicht mehr hinnehmen, wie es eben auch die Frauenbewegung gemacht hat. Also wir haben hier unglaublich was erreicht und wir haben sehr gelernt vor allen Dingen, anders auch mit unseren Bedürfnissen umzugehen und da dann zu fordern, dafür wollen wir Respekt haben für das, was wir sind. Und dass es nicht nur nicht strafbar ist, sondern dass es auch genauso viel wert ist wie Gewalt.
Jemand, der heterosexuell ist oder sonst was anderes.
Veränderung braucht Zeit, sagt Thomas Grossmann. Das war auch die Haltung derjenigen Aktivisten der Studentenbewegung, die in den 70er Jahren dann in die Politik gingen und dort dafür stritten, mehr Demokratie zu wagen, wie Willy Brandt es formulierte, oder die als Lehrer, Richter oder Ministerialbeamte den Weg durch die Institutionen antraten, um ihren gesellschaftlichen Idealen Geltung zu verschaffen.
Es gab aber auch die Gruppe derer, die keine Geduld hatte, die eine Revolution forderte und Terror praktizierte.
Wie die Rote Armee Fraktion, die RAF, das Leben in der Bundesrepublik in den 70er Jahren prägte, darum geht es in der nächsten Folge von Deine Geschichte, unsere Geschichte. Unser Zeitzeuge ist dann Klaus Flieger. Der heute 75-Jährige gilt als einer der engagiertesten Verfolger der RAF. Er war unmittelbar beteiligt an zahlreichen Ermittlungen, etwa zur Schleierentführung und anderen RAF-Anschlägen sowie zur Todesnacht von Stammheim.
Jürgen und Christoph haben den Podcast diesmal mit uns produziert. Alle Podcast-Folgen finden Sie, findet ihr in der AD Audiothek. Und Fotos, Filme und Texte zu den einzelnen Folgen gibt es unter ndr.de-geschichte. Und für Lob und Kritik gibt es eine E-Mail-Adresse. Deine Geschichte in einem Wort. DeineGeschichte.ndr.de Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Untertitelung des ZDF, 2020