
Die 70er: NATO-Doppelbeschluss und Friedensbewegung (12/12)
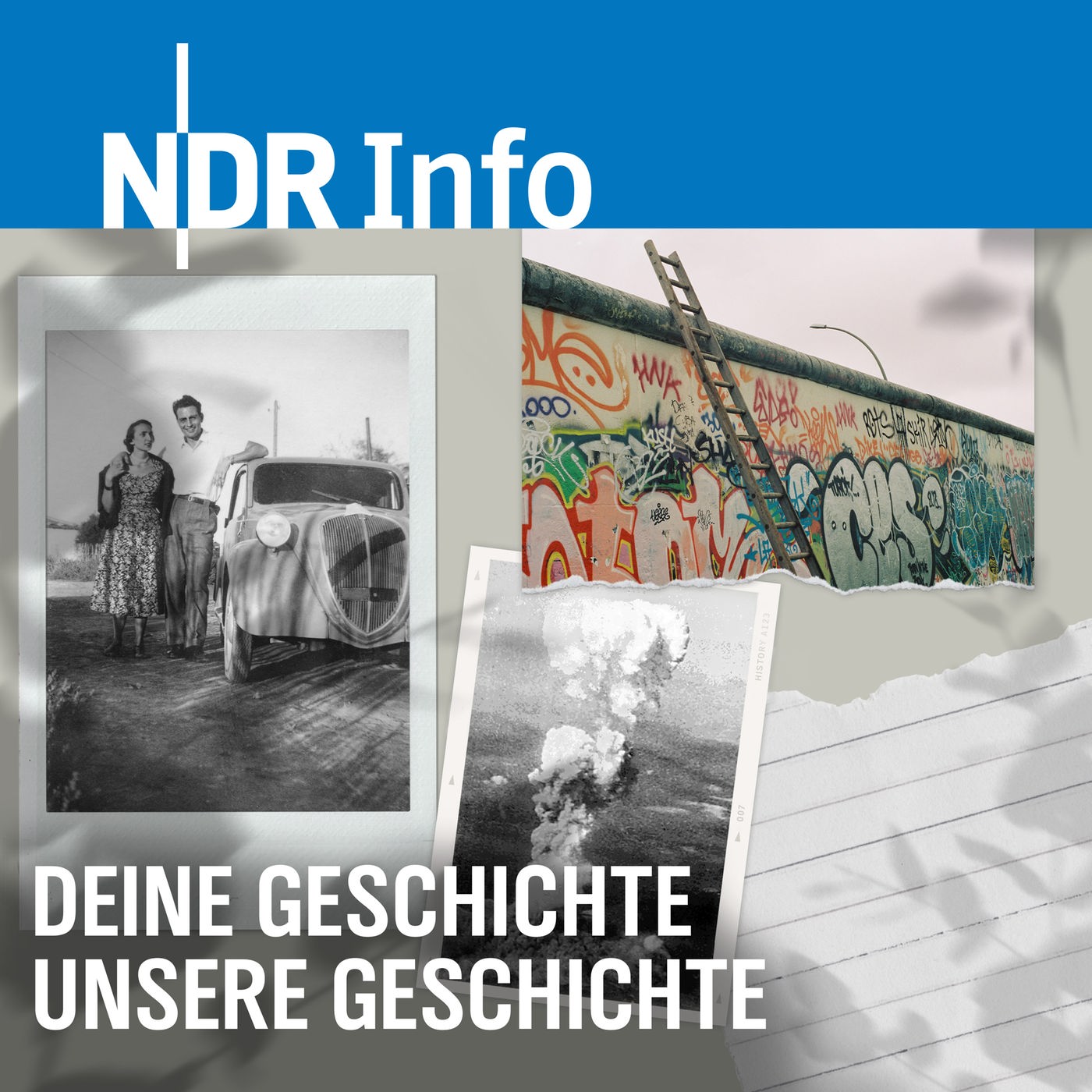
Deine Geschichte – unsere Geschichte
- Angst vor Atomkrieg durch Mittelstreckenraketen
- NATO-Doppelbeschluss 1979
- Friedensbewegung als Reaktion
- Hoffnung auf Entspannung nach KSZE-Schlussakte enttäuscht
Shownotes Transcript
Ja, es war schon diese Sorge, dass mit den Mittelstreckenraketen eine neue Qualität der Bedrohung da ist. Wir wollen mit der Sowjetunion die Disparitäten, das heißt die sowjetische Überlegenheit im Mittelstreckenbereich über Abrüstungs-, Überrüstungskontrollverhandlungen beseitigen. Die Sonderzüge waren ausgebucht. Friedlich ist die größte Kundgebung in der Geschichte der Bundesrepublik am Abend in Bonn zu Ende gegangen.
Also da haben wir tatsächlich etwas erreicht, was eben tatsächlich bis heute nachwirkt. Deine Geschichte, unsere Geschichte. Ein Podcast von NDR Info. Deine Geschichte erzählt dein Leben. Unsere Geschichte erzählt von unser aller Leben. Ich habe Zeitzeugen gefragt. Ich habe in den Tonarchiven recherchiert. Deine Geschichte. Unsere Geschichte.
Die 70er, Folge 12, NATO-Doppelbeschluss und Friedensbewegung. Willkommen zu einer neuen Folge unseres Geschichtspodcasts mit Ulrike Bosse und Franziska Ammler. Weil ich selbst Kriegsteilnehmer war. Ich habe das durchgemacht. Ich habe auch Angst und ich glaube, das ist das Ende. Wenn es anfängt, wenn einer anfängt, ist es das Ende. Wir haben die Welt!
Mich erinnert das schon auch rückblickend sehr an etwas wie die heutige Situation, wo man eben auch die Befürchtung haben muss, da muss nur irgendwer, sagen wir mal einen technischen Fehler oder irgendein untergeordneter Kommandeur, der da verrückt spielt, kann hier die absolute Katastrophe auslösen.
Die Angst vor einem Atomwaffeneinsatz, von der der alte Demonstrant und von der unser Zeitzeuge Bernhard Fitzner heute spricht, lässt sich nicht wegdiskutieren. Heute ist es die Sorge, dass der Krieg in der Ukraine eskalieren könnte. Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre ging es um eine mögliche Konfrontation zwischen den Supermächten UdSSR und USA auf europäischem und speziell natürlich auf deutschem Boden.
Bernhard Fitzner war damals in der Friedensbewegung in Hannover aktiv. Unter anderem organisierte er als Student die Sonderzüge, die am 10. Oktober 1981 zu großen Friedensdemonstrationen zum Sitz der Bundesregierung nach Bonn fuhren. Friedensdemonstrationen mit vielen Teilnehmern hatte es in der Bundesrepublik in den 50er Jahren gegeben, als es um den Aufbau der Bundeswehr ging und mehr noch als über die atomare Bewaffnung der Bundeswehr diskutiert wurde.
Die Studenten von 1968 demonstrierten dann gegen den Vietnamkrieg, gemischt mit einer allgemeinen Kritik an der Politik der US-Regierung.
Auslöser für das erneute Engagement vieler Menschen für den Frieden ab Ende der 70er Jahre war der sogenannte Doppelbeschluss der NATO über die Aufstellung atomarer Mittelstreckenraketen in Europa. In vielen Ländern wurde dagegen demonstriert, aber am stärksten war die Friedensbewegung in der Bundesrepublik, wo sie zur größten Bürgerbewegung in der Geschichte des Landes wurde.
Bernhard Fitzner sagt, nach Unterzeichnung der KSZE-Schlussakte in Helsinki 1975 hätten er und seine Freunde an eine dauerhafte Entspannung zwischen Ost und West geglaubt. Dass die Unterzeichnerstaaten sich auf diplomatische Formeln geeinigt hatten, die nachher sehr unterschiedlich interpretiert werden, wurde ihnen erst später klar. Für uns war es tatsächlich die Vorstellung, jetzt haben wir es geschafft.
Von daher dann auch die Enttäuschung, als dann 1979 dieser sogenannte Doppelbeschluss zustande kam. Wir haben es offensichtlich doch noch nicht geschafft. In der Schlussakte von Helsinki waren die Unverletzlichkeit der Grenzen und das Prinzip der Nicht-Einmischung festgeschrieben. Und es gab eine Selbstverpflichtung zur Umsetzung der Regeln der UN-Charta in Europa auf vielerlei Ebenen.
Welche Sprengkraft die darin enthaltene Festschreibung der Menschenrechte und Grundfreiheiten in den Staaten Osteuropas entwickelt hat, darüber haben wir in unserer Folge über die Opposition in der DDR mit Ulrike Poppe gesprochen. In der Bundesrepublik interessierten sich die Menschen mehr für das dort verankerte Bekenntnis zur friedlichen Beilegung von Konflikten. Sie glaubten und sie hofften, dass die von Willy Brandt eingeleitete Entspannungspolitik unumkehrbar sei.
Und sie übersahen, dass über Fragen des Militärs und der Rüstung in Helsinki nicht verhandelt worden war, weil die Unterzeichnerstaaten sonst schwer zu einer gemeinsamen Abschlusserklärung gekommen wären. Musik
Die Hoffnung auf eine dauerhafte Entspannung im Kalten Krieg wurde auch durch Abrüstungsverhandlungen genährt. 1972 war mit SALT I ein erstes Abkommen zur Rüstungsbegrenzung zwischen den USA und der Sowjetunion abgeschlossen worden. Direkt danach begannen die Verhandlungen für SALT II. Auch dieses Abkommen wurde unterzeichnet, aufgrund einer erneuten Zuspitzung des Kalten Krieges dann aber vom US-Senat nicht mehr ratifiziert.
Während die meisten Deutschen wahrnahmen, dass die Großmächte über Rüstungskontrolle verhandelten, beobachtete Bundeskanzler Helmut Schmidt und mit ihm auch die Militärexperten in Europa mit Sorge, dass es dabei primär um die Sicherheitsinteressen der Großmächte ging. Musik
In Europa war die UdSSR dem Westen bei der konventionellen Rüstung überlegen. Außerdem hatte Moskau begonnen, im Bereich der atomaren Mittelstreckenraketen, alte SS-4 und SS-5-Systeme durch modernere, zielgenauere und mit mehreren Sprengköpfen ausgestattete SS-20 auszutauschen. Dazu kamen militärpolitische Entscheidungen in Washington, die die Europäer beunruhigten.
Schmidt fürchtete, dass die Großmächte sich bei der Rüstungsbeschränkung einigen könnten, ohne dass die Sicherheitsinteressen der Europäer und der Deutschen zumal beachtet würden. Das thematisierte Schmidt bei einer Rede in London im Herbst 1977.
Durch die Reaktionen in Washington darauf und durch die später getroffenen Entscheidungen wurde diese Rede als Aufforderung zu einer Aufrüstung mit taktischen Atomwaffen in Europa aufgenommen. In der politischen Diskussion in Westdeutschland war von Nachrüstung die Rede. Bernhard Fitzner konnte mit Schmidts sicherheitspolitischen Überlegungen wenig anfangen. Nein, gut, da muss ich natürlich persönlich sagen, dass er mein Kanzler nie war.
Weil ich mich immer links oder damals links von der SPD verortet habe. Und natürlich haben wir schon den Wechsel von Willy Brandt zu Helmut Schmidt als sehr problematisch empfunden.
Weil Willy Brandt stand eben für die Ostverträge. Aber immerhin bei der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 75 war Schmidt ja schon Bundeskanzler. Und die hat er auch als Bundeskanzler mitgetragen. Für uns war das ein Widerspruch in der damaligen offiziellen sozialdemokratischen Politik. Musik
Bei den Bundesbürgern, die sich an eine erfolgreiche Entspannungspolitik gewöhnt hatten, kam Schmidts Rede mehrheitlich nicht gut an. Auch Bernhard Fitzner gehörte zu dieser Mehrheit. Eine weitere Hochrüstung des Westens war etwas, was er sich absolut nicht vorstellen wollte. Wir hatten zwei Sorgen. Einmal die allgemeine Sorge über eine weitere Hochrüstungsspirale und die,
Diese Mittelstreckenraketen hatten ja gegenüber bisherigen Atomraketen das Problem sehr kurzer Vorwarnzeiten, sodass damals viele die ernsthafte Sorge hatten, die uns ja auch heute wieder umtreibt, dass alleine durch, sei es ein Versehen, sei es durch irgendeinen ausgetickten Schuss,
eine Katastrophe verursacht werden konnte. Und für diejenigen, die sehr sich für die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa und die Ostverträge eingesetzt hatten, der Eindruck, das alles geht jetzt den Bach runter.
Und das wurde schon als eine ausgesprochen bedrohliche Situation empfunden. Und das wohl nicht nur in meinem engeren politischen Spektrum, sondern bei großen Teilen der Bevölkerung. Musik
Ein Vorschlag der USA, Neutronenbomben nach Europa zu liefern, verschlimmerte die Lage, statt sie zu beruhigen. Die Neutronenwaffe sollte die gegnerischen Soldaten töten, ohne bei der Infrastruktur so große Schäden anzurichten wie klassische Atombomben. Für Bernhard Fitzner und seine Freunde war das unvorstellbar. Und da zumindest waren sie sich mit vielen Politikern einig.
Ich meine, Egon Bahr war es, der sie als Perversion des Denkens bezeichnet hat, weil die Neutronenbombe sollte ja eine Waffe sein, die nur in Anführungsstrichen Menschen tötet, die Sachwerte aber unbeschädigt lässt. Und das war schon etwas, was durchaus die Stimmung, dass das nicht in Ordnung ist,
Zu Massenprotesten habe dieser Vorschlag in Deutschland aber noch nicht geführt, erinnert Bernhard Fitzner sich. Das sei dann erst mit dem NATO-Doppelbeschluss gekommen. Zwischen 1977 und 1979 verschlechterte sich das Klima zwischen der UdSSR und den USA. Dort war mittlerweile der Demokrat Jimmy Carter zum Präsidenten gewählt worden.
Carters Betonung der Menschenrechte in seiner Außenpolitik trug so wenig zu einer Entspannung des Verhältnisses bei, wie sein Zugehen auf China.
Das Engagement Moskaus in Afrika wurde wiederum von den USA als aggressiv wahrgenommen. In den Jahren, die folgten, unterstützten die Großmächte dort in Afrika wie in Südamerika gegensätzliche Machtgruppen. Ende 1979 marschierte die Sowjetunion in Afghanistan ein und die USA unterstützten in der Folge die islamischen Widerstandsgruppen der Taliban.
Die Großmächte rutschten in eine neue Phase des Kalten Kriegs und führten weiter Stellvertreterkriege. Die Verhandlungen in der NATO über das militärische Sicherheitskonzept in Europa entwickelten sich weiter.
Am 12. Dezember 1979 wird schließlich der sogenannte NATO-Doppelbeschluss gefasst, der eine Stationierung von Pershing-Raketen und Marschflugkörpern ankündigt, wenn die Sowjetunion nicht bei ihren auf Westeuropa gerichteten SS-20-Raketen abrüstet. Es gehe darum, die Entspannungspolitik abzusichern, sagt Bundesverteidigungsminister Hans Apel dazu in einem NDR-Interview. Wir sagen...
Der Rüstungskontrollpolitik gebührt der Vorrang. Wir wollen mit der Sowjetunion die Disparitäten, das heißt die sowjetische Überlegenheit im Mittelstreckenbereich über Abrüstungs-, über Rüstungskontrollverhandlungen beseitigen. Wir wollen auch hier gleiche militärische Fähigkeiten haben, aber wir sagen...
Wenn dies nicht gelingen sollte und wir haben dafür mehrere Jahre Zeit, die neuen Waffen können frühestens 1983, 1984 nach Europa kommen, dann müssen wir der Sowjetunion allerdings sagen, wir werden die Verteidigungsfähigkeit aufrechterhalten, weil dann diese Waffen auch kommen.
Der Bundesverteidigungsminister spricht von Abrüstung. Bernhard Fitzner sagt, er habe da eher ein Signal zu einem neuen Wettrüsten gesehen. In der Friedensbewegung seien die Meinungen darüber auseinandergegangen, wer dafür verantwortlich sei. Die einen haben gesagt, auf beiden Seiten wird hochgerüstet.
Andere, zu denen ich damals gehört habe, haben die Hauptverantwortung zumindest auf westlicher Seite gesehen. Das war eben eine dieser unterschiedlichen Positionen schon. Aber dass auf Dauer ein Parallellaufen von politischer Entspannung und immer weiterer Aufrüstung nicht gut gehen könnte, das haben viele so gesehen. Herr Präsident, ich bin jetzt zehn Jahre alt.
Ich fürchte mich in diesem Atomraketen.
Eines bewirkt der NATO-Doppelbeschluss auf jeden Fall. Er weckt die Aufmerksamkeit auch derer, die sich bisher nicht mit dem Thema Rüstung und Abrüstung auseinandergesetzt haben. Bernhard Fitzner sagt, bis dahin sei die Friedensbewegung für die meisten Deutschen kein Thema gewesen. Noch zum Zeitpunkt des sogenannten NATO-Doppelbeschlusses 12.12.1979 gab es keine euphorische Friedensstimmung mehr.
Diejenigen, die sich vorher schon engagierten, seien vielmehr oft als Kommunisten beschimpft worden. Wenn man, sagen wir mal, 1979 einen Informationsstand in der Stadt machte zu Friedensthemen oder Themen, die ja oft gleich als links eingestuft wurden, da konnte einem schon dieser Spruch begegnen, geht doch nach drüben. Wir alle Milliarden Menschen auf der Welt
Nach dem 12.12.1979 habe sich die Stimmung dann aber gedreht.
Relativ kurzfristig, nach dem Doppelbeschluss 1980, gab es dann das sogenannte Krefelder Forum, von dem der Krefelder Appell ausgegangen ist. Der Krefelder Appell rief die Bundesregierung auf, ihre Zustimmung zur Stationierung neuer atomarer Mittelstreckenwaffen in Europa zurückzuziehen.
Formuliert worden war er auf dem Krefelder Forum. Initiatoren waren Menschen, die schon in den 50er Jahren in der Bewegung Kampf dem Atomtod aktiv waren, wie Martin Niemöller oder Helmut Ritter. Und Vertreter der neuen Friedensbewegung, wie die grünen Politiker Petra Kelly und Gerd Bastian.
Der Krefelder Appell wurde am 16. November 1980 veröffentlicht. Bis zur Bundestagsentscheidung über die Nachrüstung im November 1983 haben ihn rund vier Millionen Menschen unterzeichnet. Die Friedensbewegung bekam nach dem NATO-Doppelbeschluss plötzlich sehr schnell sehr viel Zulauf, erzählt Bernhard Fitzner. Da hat sich das also in ganz kurzer Zeit aufgeschaukelt, wenn man so will.
Aber diese Zuspitzung auf die Friedensfrage, die hat sich im Grunde genommen, sagen wir mal, zwischen dem NATO-Doppelbeschluss Dezember 79 und dem 10.10.81, das ist sozusagen das Referenzdatum, von dem aus dann die Zeit neu gerechnet wurde, dazwischen ergeben. Musik
Schon vorher sei er immer demonstrieren gegangen. Ab 1979 habe er sich dann aber verstärkt engagiert. Was ihn dazu bewegt hat, beschreibt Bernhard Fitzner so. Es war schon diese Sorge, dass mit den Mittelstreckenraketen eine neue Qualität der Bedrohung da ist. Und dass die Entspannungspolitik, für die wir uns eben doch aktiv eingesetzt hatten,
dass die damit zumindest ganz massiv gefährdet würde. Und gegen diese Gefährdung anzugehen, war wichtig. Wie groß die Sorge um den Frieden in Deutschland war, wurde spätestens am 10. Oktober 1981 bei der großen Friedensdemonstration in Bonn sichtbar. Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Friedlich ist die größte Kundgebung in der Geschichte der Bundesrepublik am Abend in Bonn zu Ende gegangen. 250.000 bis 300.000 Menschen hatten sich in der Bundeshauptstadt versammelt, um für Frieden und Abrüstung zu demonstrieren.
Sie folgten einem Aufruf der Aktion Sühnezeichen und der Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden, der von über 1000 politischen und kirchlichen Organisationen unterstützt wurde. Europa hatte zweimal Krieg, der dritte wird der letzte sein. Gib bloß nicht auf, gib nicht klein bei.
Für Bernhard Witzner war die Demo rückblickend einer der Höhepunkte der Friedensbewegung. Nicht nur, weil so viele Menschen daran teilgenommen haben, sondern weil es für den heute 73-Jährigen ganz persönlich nochmal eine besondere Erfahrung war. Schließlich hat er damals die Sonderzüge in die Bundeshauptstadt organisiert. Fahrkarten und Vertrag hat er bis heute aufbewahrt. Ich habe mir meine Unterlagen nochmal angeguckt.
Ich persönlich habe Ende August 1981 Verhandlungen mit der Bundesbahn über einen Sonderzug geführt.
Da waren viele auch in meinem Umkreis eher skeptisch, ob wir einen Sonderzug mit 700 Menschen vollkriegen. Innerhalb eines Monats, von Ende August bis Ende September, sind wir dann von einem Sonderzug mit 700 Personen auf drei Sonderzüge mit 3000 Personen hochgegangen. Und die Sonderzüge waren ausgebucht.
Das war natürlich so für uns im Grunde genommen nicht vorhersehbar. Für die meisten begann die Friedensdemonstration früh am Morgen. Rund 40 Sonderzüge rollten in die Bahnhöfe in und um Bonn ein. Da gab es Gedränge, aber mehr auch nicht. Die ca. 3000 Busse waren meist schon in der Nacht eingetroffen. So blieb das erwartete, ja prophezeite Verkehrschaos aus. Wer gestern noch gemeint hatte, Bonn könne den Ansturm gar nicht verkraften, der wurde heute eines Besseren belehrt.
Wissen Sie noch, mit welchem Gefühl Sie da morgens aufgestanden sind? Immerhin hingen auch die ganzen Sonderzüge von Ihnen ab, ob die Menschen nach Bonn kommen und wie auch dann die Stimmung vor Ort war?
Also das war schon eine Euphorie, das kann ich nicht anders sagen. Das waren ja laienhaft gedruckte Fahrkarten, die wir gemacht hatten und die wir ausgegeben hatten und wo natürlich nicht hundertprozentig absehbar war, ob das alles funktionieren würde. Aber im Grunde genommen, als wir dann im Zug gesessen haben und gesehen haben, der Zug ist rappeldicke voll,
eigentlich nur noch diese euphorische Stimmung. Ja, und was eben auch diese Euphorie mit ausgemacht hat, man fand plötzlich in den Sonderzügen Menschen, die ich etwa aus der 68, 69er frühen Zeit
Studentenbewegung kannte, die man dann jahrelang nicht gesehen hatte, weil sie sich im persönlichen privaten Bereich, das waren dann eben Menschen, die dann mittlerweile Familie gegründet hatten. Die meisten Demonstranten zogen zuerst zu den Sammelstellen der fünf Demonstrationszüge.
Für ein Kulturprogramm mit Reden und Musik war überall am Wege gesorgt oder sie sorgten selbst dafür. Auf ihre Weise trug auch die Polizei zu einem friedlichen Verlauf bei. Sie hielt sich betont im Hintergrund. Waren Sie, auch wenn sich das natürlich in den Tagen davor angedeutet hat, aber waren Sie dann nicht dennoch überrascht, als Sie dann dort vor Ort hunderttausende Menschen gesehen haben?
Ja, die hat man ja nicht gesehen. Man hat nur gesehen, man kommt nicht vorwärts. Und das heißt, man hat gemerkt, ja, hier sind ziemlich viele.
Und die Zahlen, das überblickt ja keiner bei solch einer Demonstration. Das war dann eher die Sache, als man dann am Tag danach zu Hause war. Der von den Teilnehmern am meisten geäußerte Wunsch heute, wir wollen wissen, was ist und was kommt. Die Sorge, dass es immer möglicher wird, einen Atomkrieg zu führen und dass dieser die Vernichtung Zentraleuropas bedeuten würde, war Hauptbestandteil fast aller Reden.
Aber auch wenn man bei der Demonstration in Bonn gemeinsam auftrat, habe es in der Friedensbewegung durchaus unterschiedliche Meinungen gegeben.
die auch mit gewisser Heftigkeit ausgetragen worden seien, sagt Bernhard Fitzner. Es gab in der Friedensbewegung sehr kontroverse Auffassungen, ob man sich nun vorrangig gegen diese Stationierung hier bei uns richten sollte oder ob man sich nicht genauso gegen die SS 20 richten müsste.
sagen wir mal, aus dem eher christlichen Spektrum der Friedensbewegung
gab es doch sehr erhebliche Vorbehalte auch gegenüber den realsozialistischen Ländern und damit auch Positionen gegen die dortige Aufrüstung, während in dem, sagen wir mal, eher linken Spektrum, dass eher so gesehen wurde, dass die Aufrüstung jeweils vom Westen ausging. Jetzt müssen wir streiten, keiner weiß wie lang, ja für ein Leben ohne Zwang.
Jetzt müssen wir streiten, keiner weiß, wie lang wir für ein Leben sind.
Die Bonner Friedensdemonstration war zugleich politisches Redemarathon, Verbrüderung vieler Teilnehmer, aber auch die Gemeinsamkeit verschiedener Ideen und Ideologien unter der Überschrift Frieden. Und sie war auch an Zahl und Friedfertigkeit eindrucksvoll ein großes Volksfest, aufgewertet durch die Teilnahme ausländischer Stars, der Friedensbewegung zum Teil seit Jahren verbunden. Oh yes, the whole world.
Ja, das ist eben nicht nur so ein einmaliges Aufbäumen, sondern wir haben wirklich einen breiten Zulauf in der Bevölkerung. Und ich glaube, wir hatten gut zehn Stadtteilinitiativen. Wir hatten die berufsbezogenen, wir hatten die Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter für den Frieden. Dann gab es die Künstler für den Frieden, die Sportler für den Frieden, die Kulturwissenschaftler und so weiter und so fort.
Seit Stunden regnet es, trotzdem kommen die Demonstranten ganz fröhlich zu den Abfahrtplätzen ihrer Busse oder hier zum Bonner Hauptbahnhof. Sie haben ein gutes Gefühl.
Vielleicht haben sie nicht einmal alle Reden gehört, vielleicht haben sie den Versammlungsplatz nicht einmal gesehen, weil so viele Menschen nach Bonn gekommen waren. Aber sie hatten das Gefühl, einfach dabei gewesen zu sein. Das galt für sie an diesem Tag hier in Bonn. Denken Sie da heute auch gern wieder ran zurück?
Ach natürlich, also so etwas zu wuppen wie solche drei Sonderzüge, das ist schon etwas, was einen dann schon weiter auch begleitet. Nach der Großdemonstration in Bonn engagierten sich viele Menschen bei regionalen Friedensgruppen weiter. Schulen, Nachbarschaften, Gemeinden erklärten sich zu atomwaffenfreien Zonen. So zum Beispiel auch der Hamburger Stadtteil Eimsbüttel.
Für uns hat der Beschluss, Amsbüttels atomwaffenfreien Zone zu deklarieren, nicht bloß eine symbolische Wirkung. Wir wollen natürlich auch das, was wir beschlossen haben, durchsetzen. Deswegen auch unsere Forderung an die Verwaltung, uns über alle Vorfälle zu informieren, wo gegen diesen Beschluss verstoßen werden könnte oder wird.
Wenn wir zum Beispiel erfahren, dass Atomwaffen zum Beispiel über die Autobahn hier durch Amtsbüttel transportiert werden, dann werden wir versuchen, dass diese Transporte unterbunden werden. Der Beschluss hatte keine rechtliche Kraft, aber Logische Konsequenz aus der atomwaffenfreien Zone Amtsbüttel ergibt sich auch die Forderung, den Nachrüstungsteil des NATO-Doppelbeschlusses abzulehnen.
Dieses können wir nur über den Senat erreichen. Darum haben wir den Senat aufgefordert, im Bundesrat sich dafür einzusetzen. Bernhard Fitzner fand die Signalwirkung der atomwaffenfreien Zonen durchaus wichtig, weshalb er auch in der Friedensbewegung in Hannover dafür war. Es war unsere Vorstellung und in vielen Stellen hat es auch geklappt, wir versuchen in einzelnen Straßenzügen 50 Prozent der Menschen, die dort wohnen,
zur Unterschrift unter den Krefelder Appell und für eine atomwaffenfreie Zone zu kriegen. Und diese Straßen, bei denen wir 50 Prozent geschafft haben, die nennen wir dann atomwaffenfreie Straßen. Und das hat an einigen Stellen geklappt.
Bernhard Fitzner ist 1979 dann stärker in die Friedensbewegung eingestiegen. Zu seinen Aufgaben zählte das Organisieren von großen Veranstaltungen oder eben der Sonderzüge nach Bonn. Selbstverständlich ist er auch demonstrieren gegangen, aber vor allem ging es ihm auch um die intensive inhaltliche Auseinandersetzung mit der Politik. Also ich war etwas ungewöhnlich.
Ich habe immer Schwierigkeiten mit diesem Ausdruck Experte, aber bis zu einem gewissen Grad war ich der Experte der Friedensbewegung, denn wer hatte schon die Zeit damals...
Gerade bei denjenigen, die eben von Haustür zu Haustür gegangen sind, die haben sich nicht das Weißbuch der Bundesregierung durchgelesen. Dafür war ich dann sozusagen zuständig, so etwas zu lesen. Oder die Schlussakte von Helsinki. Ich weiß nicht, ob Sie sich das jemals angetan haben. Solche diplomatischen Dokumente sind nicht nur erfrischend, wenn man sie liest.
Aber das war dann eben meine zweite Aufgabe. Die beiden Aufgaben hatte ich hauptsächlich und die Arbeit direkt an der Basis, das haben dann allerdings eben die Menschen aus den Initiativen gemacht.
Ab 1982 war er dann hauptberuflich bei der Deutschen Friedensunion und dort für ganz Niedersachsen zuständig. Er ist vom Harz bis Ostfriesland in der Gegend herumgereist, um die Initiativen auf dem flachen Land, die natürlich noch viel mehr Informationsbedarf hatten, zu unterstützen. Es gab ja praktisch in jeder, auch in jeder Kleinstadt Informationen.
gab es eine Friedensinitiative. Und dort wurden die Informationen geradezu aufgesogen. Natürlich gab es auch Publikationen,
die Einzelne aus diesen Initiativen dann zur Verfügung hatten. Aber dann war es doch oft schon ganz wichtig für sie, dann jemanden da zu haben, dem man dann auch konkrete Fragen stellen konnte und wo man eben, wenn einem irgendwas nicht klar war, nochmal nachfragen konnte. Mit der Sowjetunion wurde über die Mittelstreckenraketen verhandelt, ohne Ergebnis.
Je näher der voraussichtliche Stationierungstermin rückte, desto mehr Menschen waren bereit, bei Aktionen der Friedensbewegung mitzumachen. Dabei habe es durchaus Kontroversen innerhalb der Friedensbewegung gegeben, erzählt Bernhard Fitzner. Es gab natürlich diejenigen, für die Friedensbewegung auch hieß, wir müssen auch friedlich im Innern sein.
Das war aber keineswegs allgemein so. Es gab auch die Gruppierungen, die sich, sagen wir mal, mehr als Antimilitaristen verstanden haben und zumindest Blockadeaktionen, da würde ich auch sagen, das ist auch durchaus friedfertig, um da jetzt nicht missverstanden zu werden, aber dann es eventuell für sinnvoll hielten, auch bis zu einem gewissen Grad in eine Konfrontation mit der Polizei zu gehen. Musik
Konfrontativ war auf jeden Fall die politische Auseinandersetzung über den anstehenden Nachrüstungsbeschluss. Die Unionsparteien waren dafür, auch wenn sie Verständnis für christliche Friedensinitiativen äußerten. Auch die FDP trug ihn mit. Die im Januar 1980 gegründeten Grünen umgekehrt wurden zur parlamentarischen Plattform für die Friedensbewegung ebenso wie für die Anti-Atomkraft- und Umweltbewegung.
In der SPD hatte Bundeskanzler Helmut Schmidt den NATO-Doppelbeschluss mit initiiert. Die Mehrheit der Partei Basis aber lehnte ihn ab. Im Herbst 1983, als der Stationierungsbeschluss anstand, hatten sich fast alle SPD-Landesverbände gegen die Stationierung von Mittelstreckenwaffen ausgesprochen.
Am 22. Oktober 1983, also einen Monat vor der Abstimmung im Bundestag, sagte der damalige Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion in Schleswig-Holstein, Björn Engholm, bei einer Demonstration in Hamburg.
Nicht alle Sozialdemokraten waren in den letzten Jahren die Ersten, die das Umdenken hin zu neuer Friedfertigkeit geleistet haben. Ich gehöre auch nicht zu denen, die an der Spitze dieser Bewegung gestanden haben. Dies soll hier nicht geleugnet werden. Aber ich meine, wie lange viele Sozialdemokraten auch gebraucht haben, um den Weg zu gehen, dass sie heute hier stehen können. Heute stehen Tausende von Sozialdemokraten unter uns.
Und sie waren an diesem Tag Teil einer Gemeinschaft von mehr als einer Million Menschen, die überall in der Republik gegen die Raketenstationierung demonstrierten. Mit Kundgebungen, mit Friedensmärschen oder einer Menschenkette mit rund 200.000 Teilnehmern zwischen Neu-Ulm und Stuttgart. Einen Monat später wurde die Stationierung der Mittelstreckenraketen dem Bundestag mit der Mehrheit der mittlerweile regierenden Koalition von Union und FDP verabschiedet.
Während unseres Gesprächs habe ich gemerkt, wie leidenschaftlich Bernhard Fitzner heute noch über seine damalige Zeit in der Friedensbewegung spricht. Und er zieht rückblickend eine positive Bilanz. Die Friedensbewegung konnte zwar den Nachrüstungsbeschluss nicht verhindern, aber habe bei sehr, sehr vielen Menschen zu einem Umdenken geführt. Das ist durchaus ein großer Stolz, weil ich denke, wir haben damals etwas bewirkt,
Man muss sich ja klarmachen, als der NATO-Doppelbeschluss gefasst wurde, es gab eine fast hundertprozentige Zustimmung, keine Gegenstimmen im Bundestag dagegen. Es waren dann ganz vereinzelte SPD-Abgeordnete, die sich allmählich davon abgesetzt haben.
Also da haben wir tatsächlich etwas erreicht, was eben tatsächlich bis heute nachwirkt. Wir haben uns da sicherlich an der einen oder anderen Stelle Illusionen gemacht, was die Wirksamkeit angeht, aber alles in allem, ja, stolz. Es reißt die schwersten Mauern ein, uns sind wir schwach, uns sind wir klein, wir
Worüber wir jetzt nicht gesprochen haben, ist die Friedensbewegung in der DDR, die dort ja unter ganz anderen Bedingungen aktiv war. Schwerter zu Flugscharen war ihr Motto und sie wurde Teil der Oppositionsbewegung in der DDR hin zur friedlichen Revolution. Aber das gehört dann zur Geschichte der 80er Jahre. Musik
Es war spannend und bewegend, die Geschichten der Zeitzeugen zu hören und ich habe viel gelernt. So in etwa hat das Katharina Kaufmann am Ende unserer letzten Staffel gesagt. Dasselbe gilt für mich auch diesmal, aber ich bin jetzt an einem Punkt angekommen, dass ich dazusetzen muss, ich erinnere mich gut.
Denn zum Beispiel bei der großen Friedensdemonstration in Bonn 1981 war ich dabei. Wir haben es damals bis zum Bonner Hofgarten geschafft, nur ganz hinten, ganz weit weg von der Bühne, aber immerhin. An die Reden habe ich keine Erinnerung, aber an die Stimmung damals.
Und die haben die Reporter der Tagesschau, die wir gehört haben, ganz gut eingefangen. Aber wenn ich das erzähle, rutsche ich ja jetzt selbst in die Rolle einer Zeitzeugin statt in die der Historikerin. Und das ist nicht Sinn dieses Podcasts.
Hanna und Dennis haben den Podcast diesmal mit uns produziert. Ihr findet sie finden diese und alle anderen Podcast-Folgen in der ARD Audiothek. Fotos, Filme und Texte zu den einzelnen Folgen gibt es unter ndr.de-geschichte.
Und über Lob und Kritik freuen wir uns unter der E-Mail-Adresse deinegeschichte.ndr.de in einem Wort, deinegeschichte.ndr.de. Das war sie, unsere Staffel über die 70er Jahre. Tschüss!