
Die 70er: Probleme mit dem Plan - Die Wirtschaft im Osten (3/12)
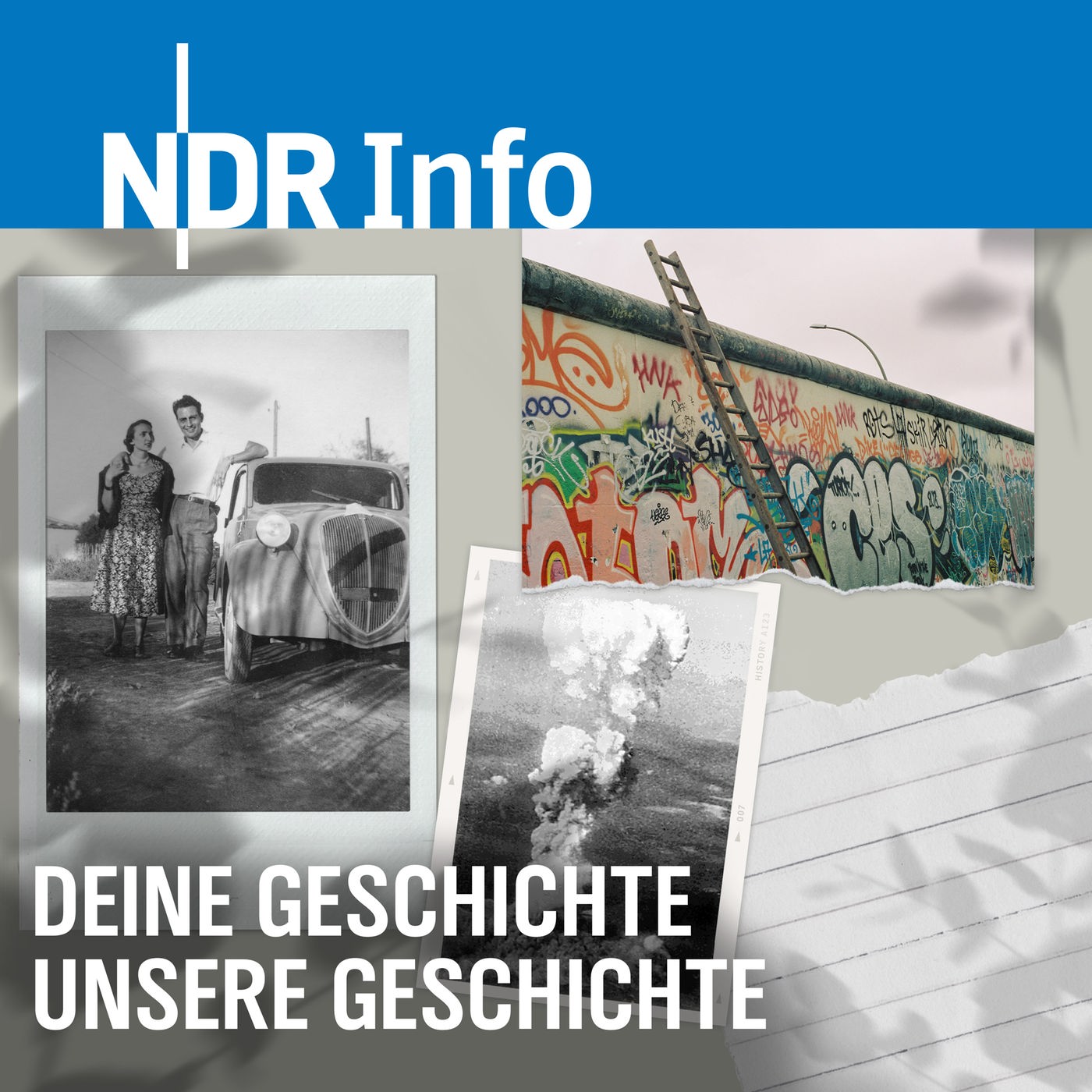
Deine Geschichte – unsere Geschichte
- Positive Erfahrungen einer Familie in den 70er Jahren
- Erwerb von Auto, Grundstück und Wohnung
- Arbeitsplatzsicherheit
- Subventionierte Güter
Shownotes Transcript
Für uns als junge Familie war die 70er Jahre eine wunderschöne Zeit. Das Zentralkomitee wählte einstimmig Genossen Erich Honecker zum ersten Sekretär des Zentralkomitees der SED. Also für uns als studierende Ökonomen war die Politik Honeckers nicht ganz nachvollziehbar. Eine Million Menschen...
Vor allem Arbeiter und ihre Familien haben Urlaub in den Hotels und Interhotels gemacht. Unser Betrieb hatte sowieso ein ganz hervorragendes Kultur- und Sozialwesen. Wir bezahlen für diese fast Fünfraumwohnung, kann man sagen, 88 Mark Miete. Dass die Partei immer höhere Steigerungsraten wollte, als geleistet werden konnte, war normal. Deine Geschichte. Unsere Geschichte. Ein Podcast von NDR Info.
Deine Geschichte erzählt dein Leben. Unsere Geschichte erzählt von unser aller Leben. Ich habe Zeitzeugen gefragt. Ich habe in den Tonarchiven recherchiert. Deine Geschichte. Unsere Geschichte. Die 70er, Folge 3. Probleme mit dem Plan. Die Wirtschaft im Osten. Willkommen zu einer neuen Folge unseres Geschichtspodcasts mit Ulrike Bosse und Franziska Ammler. Rollt ihr durchs Land, mitten im Regen?
Ich muss ganz einfach sagen, für uns als junge Familie war die 70er Jahre eine wunderschöne Zeit. Wir kriegten Familienzuwachs, wir kriegten ein Auto, wir kriegten unser Wochenendgrundstück, wir kriegten unsere neue Wohnung. Und ich sag's mal, wir waren eigentlich zu dem Zeitpunkt eine wirklich glückliche junge Familie.
Erwin Mittelhues, unser Zeitzeuge für diese Folge über die Wirtschaft in der DDR in den 70er Jahren. Er hatte 1970 schon vor Abschluss seines Studiums eine Anstellung in der VVB-Hochseefischerei bekommen. Später wurde das das VEB-Fischkombinat Rostock.
Dort arbeitete der heute 76-Jährige als Ökonom und später als Stellvertreter des Generaldirektors und Direktor für Produktion bis zum Ende der DDR. In einem Industriezweig, der in den 70er Jahren zu den modernsten in der DDR gehörte. Und wenn man ihn so hört, klingt es, als seien die 70er Jahre in der DDR ein goldenes Zeitalter gewesen.
Also vom Glück seiner jungen Familie in den 70ern hat mir auch der Zeitzeuge unserer letzten Folge über die Wirtschaft in Westdeutschland, Hans-Ulrich Stangen, erzählt. Der Unterschied? Er lebte nicht in einer Welt, in der scheinbar immer alles besser wurde, sondern er sagte, er und seine Frau hätten sich angesichts der wirtschaftlichen Probleme in der Bundesrepublik verletzt.
damals schon überlegt, ob sie in diese Welt überhaupt Kinder setzen könnten. Und dass sie dann glücklich waren, weil sie sich dafür entschieden haben. Sorgen um einen Arbeitsplatz mussten sich die DDR-Bürger nicht machen. Und Inflation war für sie kein Thema, weil der Staat von den Grundnahrungsmitteln bis zur Wohnung das Notwendige subventionierte. Andererseits, das, was Erwin Mittelhoos so positiv hervorhebt am DDR-Leben in den 70ern,
Eine ordentliche Wohnung, ein Auto, das war für die meisten Westdeutschen schon lang vorher Standard. Und es waren Errungenschaften, die die DDR zu einem Guteil auf Pump finanzierte, was letztlich dazu führte, dass sie Ende der 80er Jahre bankrott war. Das Zentralkomitee trat am 3. Mai zu seiner 16. Tagung zusammen. Zu Punkt 1 der Tagesordnung gab Genosse Watter-Ulbricht eine Erklärung ab.
Er bat das Zentralkomitee, ihn aus Altersgründen von der Funktion des ersten Sekretärs des Zentralkomitees der SED zu entbinden, um diese Funktion in jüngere Hände zu geben. Am 3. Mai 1971 unterrichtete das DDR-Fernsehen sein Publikum über das Ende einer Ära. Walter Ulbricht, der die DDR seit ihrer Gründung geleitet und geprägt hatte, trat ab.
Auch wenn er zunächst noch Vorsitzender des Staatsrats blieb, die Macht ging in diesem Moment über in die Hände seines bisherigen Stellvertreters. Das Zentralkomitee wählte einstimmig Genossen Erich Honecker zum ersten Sekretär des Zentralkomitees der SED.
Sechs Wochen später, beim achten Parteitag der SED, erfolgte dann quasi die Intronisation Honeckers durch die gesamte Partei, geadelt durch die Anwesenheit des Generalsekretärs der KPDSU, Leonid Brezhnev und Wiesbaden.
Mit den Huldigungen durch die übrige Führungsriege der SED, zum Beispiel vom ersten Sekretär der SED-Bezirksleitung Rostock und späteren Vorsitzenden der DDR-Gewerkschaft FDGB Harry Tisch. Von der Tribüne des 8. Parteitages versichern wir, die Parteiorganisation des Bezirkes Rostock steht einheitlich und geschlossen. Fest und treu zum Zentralkomitee, zur kollektiven Führung des Politbüros mit dem ersten Sekretär unserer Partei, Genossen Erich Honecker.
Was wie eine Hymne auf die Einheit der SED klingt, beschreibt in Wirklichkeit Honeckers Sieg im innerparteilichen Machtkampf gegen Walter Ulbricht. Honecker hatte mit Billigung Brezhnevs schon länger darauf hingearbeitet. Im SED-Politbüro, also der Machtzentrale der DDR-Staatspartei, wurde die Ablösung Ulbrichts mit dessen Fehlentscheidungen in der Wirtschaftspolitik begründet.
Die Lebensverhältnisse in den sozialistischen Staaten hatten sich gegenüber der Nachkriegszeit zwar deutlich verbessert, aber es gab doch auch immer wieder spürbare Versorgungsmängel, so auch im Winter 1969-70.
Während die meisten Ostblockstaaten daraufhin, in Übereinstimmung mit Moskau, den Aufschwung des materiellen und kulturellen Lebensniveaus des Volkes, wie es hieß, zum Ziel ihrer Fünf-Jahres-Pläne machten, gab Ulbricht der DDR eine Strukturpolitik vor, die sich darauf konzentrieren sollte, Zukunftsindustrien zu modernisieren. Die Versorgung der Bevölkerung wurde hintangestellt. Das änderte Honecker.
Durch die Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik, wie es künftig hieß, sollten sich die Lebensbedingungen für die Menschen in der DDR verbessern und mehr Konsummöglichkeiten geschaffen werden. Tausend kleine Dinge braucht man jeden Tag im Haus. Ohne sie kommt man im Leben einfach nicht mehr aus. So geben wir heute in dem einen gut gemeinten Rat. Schau dich doch mal im Konsum um, was man dort alles hat.
Erwin Mittelhus erzählt, dass sich die Lebensbedingungen nach Honeckers Amtsantritt tatsächlich gebessert haben. Also ich sag mal, die Leute haben es spürbar gemerkt.
Und es war ja so, auch bei uns, wenn ich überlege, wir hatten ja beide ein sehr gutes Gehalt, meine Frau und ich. Und wir konnten dann doch mehr kaufen. Und wir hatten natürlich auch gleich einen Kühlschrank, wir hatten einen Fernseher, auch wenn wir keine neue Wohnung hatten, war das aber alles schon da. Und wir haben auch, ich will das mal so ganz einfach sagen, als junge Leute, 72, als unser Sohn geboren wurde, Kinderwagen und Auto und AWG-Wohnung, alles bezahlen können, Geld hatten wir auf dem Konto.
weil wir gut verdient haben. Und in der Fischerei wurde besonders gut verdient. Muss man auch so sagen. Denn die Hochseefischer waren genau wie die Bergleute privilegierte Leute. Es war eine sehr, sehr harte Arbeit, aber es gab auch eine sehr gute Bezahlung. Aber so sehr er und seine Frau das damals genossen, als angehender Wirtschaftswissenschaftler hatte er seine Zweifel, ob der neue Kurs denn funktionieren kann. Also für uns als studierende Ökonomen war das,
Die Politik Honeggers ist nicht ganz nachvollziehbar. Wir haben immer gesagt, das kann man mal eine gewisse Zeit machen, aber es kann nicht lange Zeit gut gehen, dass man die Akkumulationsrate vernachlässigt und eben mehr Konsumption macht. Später hat sich dann herausgestellt, dass natürlich auch noch erhebliche Kredite aufgenommen wurden, was natürlich auch eine große wirtschaftliche Belastung in den 80er Jahren bei der Rückzahlung darstellte.
In der DDR-Öffentlichkeit spielten solche Zweifel von Ökonomen keine Rolle. Da hielt man sich streng an die Vorgaben des Politbüros. Dort wurden die politischen Ziele definiert, vor Ort, in den Bezirken und in den Betrieben sollten sie umgesetzt werden.
Entsprechend klingt etwa die Berichterstattung über eine Bezirksratssitzung in Rostock Ende 1971. Ausgangspunkt aller Tätigkeit, so betonte Ratsvorsitzender Willi Marle in seinen Ausführungen, denen in der Diskussion die Sprecher der Parteien ihre Zustimmung gaben, sei es immer die gesellschaftlichen Bedürfnisse und die ständig wachsenden Anforderungen an die Versorgung der Bevölkerung im Auge zu behalten. Vier Trümpfe mit dem Rabant 601, bequem für vier Erwachsene.
RFT Fernsehgeräte. Mit gutem Bild Kontakt zur Welt. Drum ist allen Müttern klar. Viel Raum für Ihr Gepäck. Babyschick Spezial. Wendig. Fürs erste halbe Jahr. RFT Radio Television. Technische Leistung für Sie.
Hinter der von Honecker proklamierten Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik stand keine volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, sondern das politische Ziel, die Menschen in der DDR für den sozialistischen Staat zu gewinnen. Es sollte bessere Konsummöglichkeiten geben, mehr Sozialleistungen und höhere Löhne und gleichzeitig weiterhin Arbeitsplätze für alle und gleichbleibende Preise.
Es galt nicht das marktwirtschaftliche Prinzip, dass durch höhere Produktivität mehr Konsum möglich wird, sondern Honecker und seine Genossen wollten es umdrehen. Erst sollte der Lebensstandard verbessert werden. Dadurch sollten die Leute so motiviert werden, dass dann auch die Produktivität im notwendigen Maße steigt. Aber das hat nicht funktioniert. Die Verantwortlichen in den Betrieben haben das auch in den 70er Jahren schon gemerkt, erzählt Erwin Mittelhus.
Investitionen wurden vernachlässigt zugunsten des Konsums, was dazu führte, dass die DDR mehr Produkte aus dem Ausland einführen musste. Im Westen konnte man alles Notwendige kaufen, das musste aber in westlicher Währung bezahlt werden oder in Valuta, wie das im DDR-Sprachgebrauch hieß. Und das Geld, das man da ausgab, musste ja auch irgendwo herkommen. Ja, was haben wir in den 70er Jahren gemerkt? Wir haben natürlich...
engpässe gehabt ich bin ja sage ich jetzt mal insofern immer damit verbunden gewesen weil auch von unserer flotte dann zunehmend anforderungen kam dass einiges im ausland gekauft werden musste und da ich ja
der Verantwortliche für die Valutawirtschaft war, haben wir uns dann immer bemüht, doch immer mehr auch zu versuchen, weil die Schiffe mussten laufen, auch einiges im Ausland, gerade an Ersatzteilen und sonstigen Sachen zu besorgen. Es war einfach so, dass dadurch, dass jetzt unsere eigene Industrie doch, ich würde es jetzt mal höflich sagen, stiefmütterlich behandelt wurde, also das heißt, dass nicht mehr so viel investiert wurde wie in den 60er Jahren,
kam es natürlich gerade in der Wirtschaft, die Bevölkerung hat es nicht gemerkt, das hat man durch Importe weitestgehend ausgeglichen, aber kam es doch zu ganz schönen Engpässen. Die Bevölkerung hat es nicht gemerkt, sagt Erwin Mittelhus über die fehlenden Ersatzteile. Im Laufe der Jahre hat sich das sicher geändert, weil solche Probleme ja in vielen Betrieben irgendwann aufgetaucht sind.
Und die Menschen in der DDR haben Strategien entwickelt, mit der Mangelwirtschaft umzugehen. Schlange stehen. Kaufen, was es gibt, auch wenn man es gerade nicht braucht, weil man es später ja vielleicht gegen etwas Notwendiges tauschen kann. Oder um eine Dienstleistung zu bezahlen. Oder um eine Beziehung zu pflegen, die sich am Ende auszahlen kann. Aber erst einmal hat Honecker tatsächlich sein Konsumversprechen eingelöst.
Wenn man über die Wirtschaft in der DDR spricht, sollte man aber vermutlich erst einmal über die Rolle der Betriebe reden, die ja sehr viel mehr waren als Produktionsstätten und Arbeitsplätze.
Der große Unterschied war, dass viele Dinge, die im Westen als Privatangelegenheit betrachtet wurden und die wir auch heute noch als Privatangelegenheit betrachten, durch den Betrieb geregelt wurden. Unser Betrieb hatte sowieso ein ganz hervorragendes Kultur- und Sozialwesen. Wir hatten eine Poststelle, wir hatten Urlaubsbetreuung, wir hatten eine eigene Polyklinik, wir haben Klinik.
einen Kindergarten bei uns drin gehabt, wir hatten eine Kinderkrippe bei uns. Und das ist natürlich so, dass wir auch einen Patenwohnbezirk hatten, das war der Wohnbezirk Reutershagen in Rostock, für den also unser Kombinat bzw. unser Standort Rostock Fischerei verantwortlich war, wo wir auch viel gemacht haben mit Kindergärten, mit Kinderkrippen und dadurch natürlich auch dort Plätze bekommen haben für unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
Wohnen, Gesundheit, Kinderbetreuung, Urlaub. Damit half der Betrieb in vielen Bereichen, die Arbeitnehmern im Westen gehörige Kopfzerbrechen bereiten konnten, vor allem wenn Vater und Mutter in einer Familie arbeiten wollten. Die Sozialleistungen waren ja auch ein Grund dafür, dass der Anteil von berufstätigen Frauen in der DDR viel höher war als im Westen.
Allerdings muss man dazu sagen, all die Leistungen, die Erwin Mittelhus da aufzählt, konnten über seinen Arbeitgeber, das Fischkombinat, organisiert werden, weil so ein Kombinat einfach ein Riesenunternehmen war. In Kombinaten waren in den sozialistischen Ländern verschiedene Betriebe aus einem Produktionsbereich zusammengeschlossen.
Das Fischkombinat Rostock war im Norden einer der wichtigsten Arbeitgeber nach den Werften, hat er mir erzählt. 16.000 Beschäftigte, Standorte in Rostock und in Sassnitz und acht weitere kleinere Verarbeitungsbetriebe in der gesamten DDR. Zuständig für alles vom Fischfang bis zur Herstellung von Räucherfisch und Marinaden.
Ganze Familien arbeiteten teilweise dort, die Großeltern seit der Gründung in den 50er Jahren, dann die Eltern und in den 70er und 80er Jahren haben dann auch die Kinder wieder da angefangen. Aber auch unabhängig von solchen echten Familienbanden hat Erwin Mittelhus das Arbeitsklima
als eher familiär geschildert. Die Kollegen untereinander hatten eigentlich ein sehr gutes Verhältnis. Er begründet das damit, dass niemand um seinen Arbeitsplatz fürchten musste und es auch keinen Konkurrenzkampf um gute Posten gegeben habe. Denn wir hatten ja eigentlich Arbeitskräftemangel, wie man so schön sagt, insbesondere in der Produktion.
weniger in der Verwaltung. Aber auch in der Verwaltung gab es eigentlich kein großes Gerangel, denn es war gar nicht mal so erstrebenswert, unbedingt Abteilungsleiter zu werden. Denn Abteilungsleiter hatte meistens nur 150, wenn es gut kam, 200 Mark mehr. Und das war auch noch brutto. Und dann hatte man die Verantwortung für mehrere Leute. Und naja, Sie wissen ja, wie das ist. Wenn man mehrere Leute hat, hat man natürlich auch mehr Ärger.
Und da haben viele deswegen gar nicht das große Ziel gehabt und haben gesagt, wenn ich eine sehr gute Ingenieurstelle oder Ökonomstelle habe, die gut bezahlt ist, warum soll ich mir das antun und mir hier 10, 12, 20 Leute überhängen? Macht man nicht. Dadurch, dass man nicht in Konkurrenz zueinander stand, habe es einen wirklich guten kollegialen Zusammenhalt gegeben, erzählt er. Wir haben ja auch...
sehr viel zusammen unternommen. Das ging los bei Ausflügen, das ging los bei gemeinsamen Feiern. Auch die Geburtstage der jeweiligen Kollegen wurden miteinander kurz gefeiert oder auch mehr oder weniger zusammen. Wir hatten ja auch organisierten Urlaub über, wir hatten ja, ich sag mal, eigene Betriebsferienplätze, wo man dann mit vielen wieder zusammen kam, wo dann abends gegrillt wurde, man zusammensaß.
Da wird der Pack nach Plan und ganz genau. Der Trabi fährt im Zweier-Tag, um fünf steht er im Stau. Vor Straß und steht die DDR, um grünes Licht zu kriegen. Alle sind jetzt Teilnehmer der Invasion auf Rue.
Ein schöner Urlaub, das gehörte zu den Konsumversprechen Erich Honeckers, als er 1971 die Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik propagierte. Aber freies Reisen war für die DDR-Bürger nicht möglich. Erwin Mittelhus erzählt, dass er und seine Frau in den 70er Jahren die wenigen Möglichkeiten, ins Ausland zu fahren, noch genutzt haben, dann aber damit aufgehört haben, weil sie die Erfahrung machen mussten, dass sie schlechter behandelt wurden als Reisende aus Westdeutschland.
Wir konnten ja nicht viel ins Ausland fahren. Sicherlich ja, wie man so sagt, die sozialistischen Länder. Wir waren auch in der Tschechei, in Ungarn, in Bulgarien. Aber nach Ungarn sind wir nicht mehr gefahren nach 1979, weil wir nicht genügend Geld tauschen konnten. Und ich sagen muss, ich war nirgendswo gerne Mensch zweiter Klasse. Und deswegen hat man sich natürlich dann versucht, in der DDR das so gut wie möglich zu machen mit Menschen,
eben Ferienplätzen des Betriebes oder auch des FDGB, des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes, wie es ja hieß, oder eben auch das private Wochenendgrundstück. Sommer, Sonne, Sonnenbrand, Crackerboik im Gieselsand, Adios, sie macht was her, was sollen wir denn am Schwarzen Meer?
Und wer so eine Datsche hatte, der war fein raus. Die anderen waren angewiesen auf die Plätze in den Ferienheimen, die durch die Ferienkommissionen der Betriebe vergeben wurden. Deren Ausstattung war teilweise karges Jugendherbergsniveau. Ab 1971 wurden dann allerdings auch Plätze in Interhotels vergeben, die ursprünglich eingerichtet wurden für mit harten Devisen zahlende Gäste aus dem Ausland. Zum Beispiel das Hotel Neptun in Warnemünde.
Zehn Jahre später verwiesen die Verantwortlichen stolz darauf, dass in diesem Zeitraum von zehn Jahren 20.000 Plätze für den Feriendienst der Gewerkschaften neu gebaut oder modernisiert worden seien. So habe man den Beschluss umgesetzt, mehr für das Erholungsbedürfnis der Menschen zu tun, erläuterte ein Genosse Dr. Rösel, wie er im Radiointerview genannt wurde. Eine Million Menschen...
Vor allem Arbeiter und ihre Familien haben Urlaub in den Hotels und Interhotels gemacht. Darunter sind so schöne Erinnerungen für die Teilnehmer dieses Urlaubs, dass sie in Dresden das Grüne Gewölbe, die Gemäldegalerie besuchen konnten, dass sie in Potsdam die Schönheiten von St. Josi kennenlernten, dass sie in Oberhof zu jeder Zeit einen angenehmen Sport treiben können
Also das, was sich der Werktätige unter Urlaub vorstellt. Wobei wir es jetzt lieber dahingestellt lassen, ob die Mehrheit der Werktätigen lieber Bildungsurlaub in Dresden machte oder nicht doch eher die Badeferien an der Ostsee gewählt hätte. Ich hab den Vorfilm vergessen, mein Michael. Nun glaubt uns kein Mensch, wie schön's hier war. Ich hab den Vorfilm vergessen, bei meiner Seel.
Allerdings war es für die DDR durchaus ein Kraftakt, neue Hotels und Ferienunterkünfte zu bauen, während noch jede Menge Wohnungen im Land fehlten. Auch ein Wohnungsbauprogramm gehörte zu den Versprechen, die Honecker bei seinem Amtsantritt machte.
Erwin Mittelhus und seine Frau hatten 1969 geheiratet, mussten aber fünf Jahre auf eine Neubauwohnung warten. Wir haben dann unsere AWG-Wohnung, zweieinhalb Zimmer in Lichtenhagen, im November 1974 bekommen. Das war natürlich für uns ein ganz entscheidender Sprung, also warmes Wasser aufs Wand, Fernheizung aufzunehmen.
Wenn die Wohnungen auch sehr karo einfach waren und wir daraus ja, wie sagte mein Vater immer, eine Bastlerwohnung war es ja, dann erst mal was gemacht haben.
Ja, war mir trotzdem als junges Ehepaar mit einem Kind, unser Sohn war 72 geboren, sehr, sehr froh, dass wir eben in so einen Großbau des Sozialismus zogen. Und da konnten sie auch sehr zufrieden sein, denn andere Familien mussten noch sehr, sehr viel länger warten. So erzählte etwa eine Frau aus Schwerin noch im Jahr 1985 einem Rundfunkreporter, warum sie sich so über ihre neue Wohnung freut.
Was ist denn jetzt der größte Fortschritt für Sie? Das Bad. Wir hatten vorher eine Küche, da hat sich bei uns so gut wie alles drin abgespielt. Da musste gewaschen werden, da mussten die Kinder gebadet werden, da mussten wir kochen. Da ist doch jetzt schon ganz anders. Die Kinder haben ihr Zimmer, wir haben das Bad. Da macht man die Tür eben zu, wenn einer badet und dann ist es doch ganz anders als vorher. Wer dann aber eine Wohnung hatte, musste sich keine Sorge mehr machen. Die Mieten waren sehr stark subventioniert.
Wir bezahlen für diese fast Fünfraumwohnung, kann man sagen, 88 Mark Miete. Also ich will nicht sagen, wir beide zusammen verdienen eine ganze Menge Geld. Und das ist fast geschenkt, die 88 Mark Miete für so eine herrliche große Wohnung. Glück und Musik, Glück und Musik, Glück und Musik sind für alle da.
Nicht nur die Mieten waren subventioniert, auch Energie, Verkehr, Kinderkleidung, die Grundnahrungsmittel. Manches war so billig, dass damit nicht einmal die Transport- und Lagerkosten gedeckt werden konnten.
Und zum Beispiel egal, wie gut oder schlecht die Ernten waren, egal wie hoch der Getreidepreis auf den Weltmärkten war, der Preis für ein Brötchen blieb für die DDR-Bürger gleichbleibend niedrig. Was, wie Erwin Mittelhus erzählt, dann auch zu Verschwendung führte. Dann gab es natürlich auch die niedrigen Brot- oder Lebensmittelpreise, sagen wir es mal, die ja bewusst klein gehalten wurden, was natürlich auch zu Missbrauch führte in der Landwirtschaft und
oder einige LPG-Bauern auch dann damit ihre Tiere förderten und das dann auch wieder verkauften für gutes Geld. Ja, das sind so kleine Dinge gewesen. Unser LPG hat 100 Gänse und ein Gänselieschen, das ist meins. Jeden Morgen ziehen sie auf die Wiese. 100 Gänse, what die 101.
Bei der Energieversorgung profitierte die DDR lange von günstigen Importen aus der Sowjetunion. Die Oder-SSR hatte in den 60er Jahren ihre Erdöl- und Erdgasvorkommen erschlossen und sie subventionierte die sozialistischen Staaten, indem sie diesen Öl und Gas unter Weltmarktpreisen lieferte. Deshalb konnten die DDR-Bürger angesichts der Ölkrise im Westen ab 1973 schon glauben, dass ihr System am Ende doch das bessere ist. Die
Ich sage jetzt mal, die Ölkrise wie in Westdeutschland, dass es Fahrverbote gab hier an Wochenenden und Sonntagsfahrverbote und Fahrzeuge hier, gerades und ungerades Kennzeichen, dann nur fahren durften, hat es bei uns nicht gegeben.
muss ich auch sagen, auch die Bevölkerung hat da eigentlich keinerlei gespürt. Und wir haben auch bei uns in der Industrie, auch in den Industriebetrieben, nach wie vor unsere Ölheizungen in Betrieb gehabt, auch für die Produktionsanlagen. Und auch eine Rezession mit steigenden Arbeitslosenzahlen erlebten die DDR-Bürger nicht. Es wurde natürlich von der Partei und auch von der Presse und im Fernsehen ausgeschlachtet, dass es den Brüdern und Schwestern auf der anderen Seite natürlich jetzt so schlecht ging.
Aber das war von Fall zu Fall. Viele hatten ja Verwandtschaft im Westen, gab ja auch Briefverkehr. Wir guckten ja auch Rostock zum Beispiel, wir konnten ja Westfernsehen auch gucken. Und man hat das sehr differenziert gesehen. Aber man muss natürlich sagen, es war natürlich für die Politik in der DDR ein willkommenes Argument zu sagen, wir sind auf einem besseren Weg gegangen.
Die beiden deutschen Staaten hatten zwar 1972 den Grundlagenvertrag unterzeichnet, durch den die Bundesrepublik die DDR de facto anerkannte, wenn auch nicht im völkerrechtlichen Sinne. Die westdeutsche Hoffnung, dass sich dadurch allmählich das Verhältnis der beiden deutschen Staaten normalisiert, wurde allerdings nicht erfüllt. Eher im Gegenteil, Honecker verschärfte den Umgangston. Manchmal fällt an uns der Frost und macht uns hart.
Erwin Mittelhus sagt, in den 80er Jahren bekam die DDR Probleme, weil die Sowjetunion aufhörte, große Mengen billiges Öl in die sozialistischen Bruderstaaten zu liefern. Die Sowjetunion erwirtschaftete 80 Prozent ihrer Deviseneinnahmen durch Rohstoffexporte. Sie begann deshalb Mitte der 70er Jahre auch die Preise für die Lieferungen in die Ostblockstaaten allmählich anzuheben.
Nach der zweiten Ölpreiskrise ab 1979 wurden die Lieferungen überdies deutlich gekürzt. Das spürte die DDR nicht nur bei der Energieversorgung, die versuchte sie durch heimische Braunkohle aufrechtzuerhalten. Die DDR verlor vielmehr auch eine attraktive Devisenquelle.
Sie hatte bisher gut verdient, weil ihre Chemiewerke aus dem billigen Öl aus der Sowjetunion Produkte herstellten, die sie dann zu den höheren Weltmarktpreisen in den Westen verkaufen konnte. Das Geschäftsmodell funktionierte so jetzt nicht mehr. Das heißt, irgendwann kamen die Folgen der Ölkrise auch in der DDR an, wenn auch vermittelt und verzögert.
Aber als Wirtschaftswissenschaftler angesichts der sich abzeichneten Probleme vorschlugen, Subventionen und Sozialleistungen zu kürzen, lehnte Honecker das aus politischen Gründen ab.
Aber es gab auch Versuche, das Dilemma zu lösen. Zum Beispiel gab es in den 70er und 80er Jahren die sogenannte Gestattungsproduktion, um die Wiesen zu erwirtschaften und gleichzeitig das Konsumangebot für die DDR-Bürger zu erweitern. Ja, dabei stellten DDR-Betriebe Produkte für westliche Unternehmen her.
Wobei ein kleiner Teil der Produktion in der DDR blieb und dort in den teuren Delikat- oder Exquisitgeschäften verkauft wurde oder sogar gegen Devisen in Intershop-Läden. Erwin Mittelhus fand das ein ziemlich gutes Modell. Dass wir auch durch diese Sache moderne Maschinen kriegten, auf denen wir dann natürlich moderne Erzeugnisse produzieren konnten. Und wir konnten mit unseren Produkten, die wir dort produziert haben, diese modernen Anlagen bezahlen.
Aber am Ende konnte das die DDR-Wirtschaft auch nicht retten. Die Verschuldung der DDR bei westlichen Banken nahm immer mehr zu. Die Milliardenkredite aus der Bundesrepublik halfen dem Regime dann Anfang der 80er Jahre. Die SED verkaufte Menschlichkeit gegen harte Westwährung.
Der Häftlingsfreikauf, über den wir in unserer Staffel über die 60er Jahre ja schon berichtet haben, ist ein besonders menschenverachtendes Geschäftsmodell, das sie immer weiter ausbaute. Musik
Bleibt die Frage, warum es so weit kommen musste. Letztlich, weil die SED-Führung die Realität nicht wahrnehmen wollte. Oder vielleicht tatsächlich der Meinung war, der politische Wille sei stärker als die wirtschaftliche Gesamtrechnung, nach dem Motto Plan schlägt Wirklichkeit ab.
Dass die Partei immer höhere Steigungsraten wollte,
als geleistet werden konnte, war normal. Da hatte man sich schon dran gewöhnt. Und so wurde natürlich bei den Planausarbeitungen schon immer ein bisschen darauf geachtet, dass man einigermaßen hinkam. Und es gab dann bei der Planausarbeitung viel Streit, wenn man die sogenannten staatlichen Aufgaben dann nicht erfüllen konnte.
Aber man hatte dann hinterher Ruhe. Wenn man natürlich das angenommen hat und hatte einen zu hohen Plan und musste laufend begründen, warum man nicht erfüllt, dann hatte man ein ganzes Jahr lang Stress.
Erwin Mittelhus hat nach der Wende noch drei Jahre als Hauptgeschäftsführer der Ostseefisch gearbeitet, hat sich dann zusammen mit seinem Sohn eine Wirtschafts- und Steuerkanzlei aufgebaut. Finanziell geht es ihm heute natürlich viel besser, sagt er. Und trotzdem seien die 20 Jahre beim Fischkombinat berufsmäßig seine schönsten Jahre gewesen. Wie hieß es bei uns immer so nett, was ist Freiheit? Freiheit ist Einsicht in die Notwendigkeit.
So habe ich es auch immer gelernt. Und ich muss sagen, ja, das haben wir dann so umgesetzt und haben das Beste, also wie gesagt, draus gemacht. Wir haben das Beste draus gemacht, sagt Erwin Mittelhus. Es gab auch diejenigen, denen die DDR diese Chance verwehrte, weil sie sich eine andere Freiheit nahm, als die SED ihnen zugestehen wollte. In einer späteren Folge, wenn es um die Ausbürgerung Wolf Biermanns geht, werden wir darüber reden. Musik
Erst einmal wollen wir aber wieder in die Bundesrepublik schauen. Die Zukunft der Bildung gehörte dort in den 70er Jahren zu den am meisten umkämpften Themen.
Denn die Diskussion über Bildung war eng verknüpft mit einer Wertediskussion zwischen Sozialdemokraten und Konservativen. Unser Zeitzeuge ist dann Eberhard Brandt, der viele Jahre an einer Gesamtschule in Niedersachsen unterrichtet hat. Schon als Schüler voll und ganz hinter diesem Schulmodell stand und mit seiner Abiturrede 1969 damals sogar einen kleinen Skandal ausgelöst hat. Aber dazu dann mehr in unserer nächsten Folge.
Christine und Dennis haben den Podcast diesmal mit uns produziert. Wie alle Folgen von Deine Geschichte, unsere Geschichte finden Sie, findet ihr sie in der ARD Audiothek. Fotos, Filme und Texte zum Podcast gibt es unter ndr.de-geschichte. Und über Lob und Kritik freuen wir uns unter der E-Mail-Adresse deinegeschichte.ndr.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ein Podcast von NDR Info.
Untertitelung des ZDF, 2020