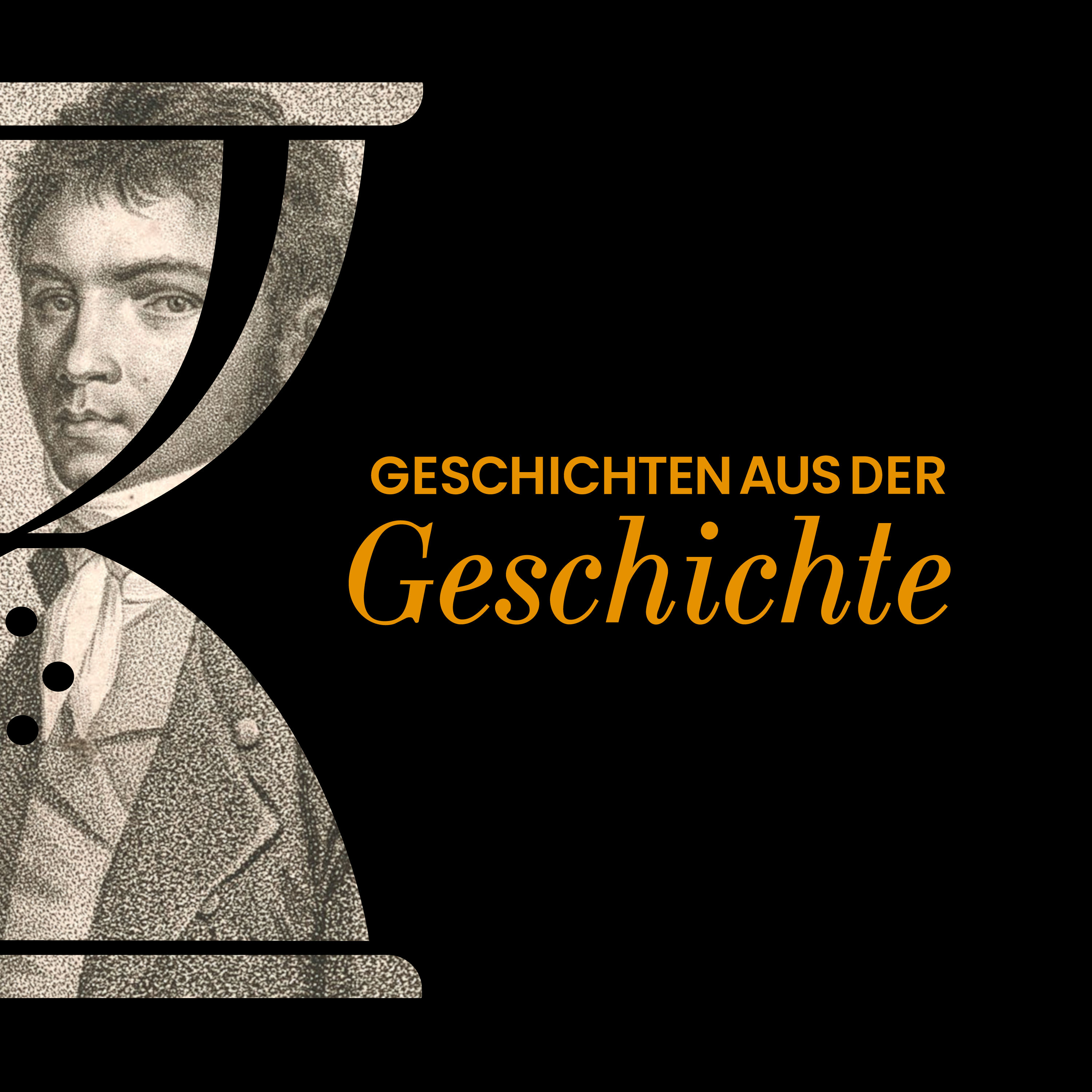
GAG510: Ludwig van Beethoven oder Wie eine Symphonie entsteht

Geschichten aus der Geschichte
Deep Dive
- Beethoven weigert sich, auf Burg Graetz für Gäste zu spielen
- Es kommt zu einer Konfrontation mit Fürst Lichnowsky
- Der Vorfall wird als Ausgangspunkt für die Erörterung von Beethovens dritter Symphonie genutzt
Shownotes Transcript
Lernt ein bisschen Geschichte, dann werdet ihr sehen, wie der Reporter sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Richard. Ja und wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Immer abwechselnd und immer so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird. Genau so ist es.
Bevor es hier jetzt aber weitergeht, kommt noch eine kleine Werbeeinschaltung. Daniel. Richard. Erinnerst du dich noch, als die einzige Art fernzusehen war, dass man einen Fernseher angesteckt hat? Dann entweder Kabel oder Sattfernsehen oder einfach...
frische Fernsehen gehabt hat oder vielleicht sogar Antenne. Und damit waren dann im Grunde alle Bedürfnisse abgedeckt. Ja. Also manchmal hat man dann natürlich jede Menge Sender gehabt, die man nicht haben wollte. Manchmal hat man einfach sehr wenige Sender gehabt, aber das war's. Und da hat sich natürlich in den letzten Jahren einiges getan. Also viele, so wie ich zum Beispiel, haben einfach gar keinen Fernsehanschluss mehr. Da läuft dann alles nur noch über das Internet.
Will ich gewisse Dinge sehen, dann abonniere ich sie einfach. Und das hat seine Vor- und Nachteile. Und ein großer Nachteil ist die Unübersichtlichkeit. Was habe ich eigentlich wo abonniert? Was kostet es? Wann wird es erneuert? Und all solche Dinge. Und du weißt, ich bin kein Excel-Typ. Ich schreibe mir solche Dinge nicht auf. Naja, da kommt unser heutiger Werbepartner ins Spiel. Der hilft nämlich dabei, hier den Überblick zu bewahren. Ist aber noch lang nicht alles.
mit der Finanzguru App. Da erhältst du den perfekten Überblick über deine gesamten Finanzen. Falls du über mehrere Konten verfügst, wir zum Beispiel haben auch ein Haushaltskonto, dann kannst du in dieser App alle zusammenfügen. Ob Girokonto, Kreditkarte oder Depot, alles wird dort verknüpft. Alle Einnahmen und Ausgaben, die werden automatisch kategorisiert und dann übersichtlich in der App aufbereitet, inklusive aller Verträge, die mit diesem Konto verknüpft sind.
Und überflüssige Verträge zum Beispiel, die können dann, wenn nötig, sogar rechtssicher per App gekündigt werden. Bietet natürlich massives Einsparungspotenzial. Und die neue Überweisungsfunktion, die erlaubt es jetzt auch, Geldsendungen direkt über die App zu schicken.
All diese Funktionen, die sind dauerhaft kostenlos. Wer noch einige mehr haben will, für 2,99 Euro pro Monat gibt es Finanzguru Plus und damit Zugang zu einer Fülle weiterer leistungsstarker Funktionen, wie zum Beispiel Budgets, Einkommensübersicht, Prognosen und Analysen. Und wer jetzt endlich auch eine bessere Übersicht über seine Finanzen, vor allem auch über diese etlichen Abonnements haben will,
Mit dem Code GESCHICHTE, alles in Großbuchstaben, gibt es Finanzguru Plus, drei Monate lang kostenlos zu testen. Link und Code gibt es natürlich wie immer auch direkt in unseren Shownotes. Das hört sich fantastisch an. Ich hasse diese Mails, wo dann kommt so, ihr Abo wurde um ein Jahr verlängert. Ja, idealerweise soll es vorher kommen. Aber ja, das sind die Tricks. Ende der Werbung. Richard.
Daniel. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber wir sind angelangt bei Folge 510. Ich weiß es. Das kommt doch nicht so überraschend für dich. 510 und weißt du noch, worum es letzte Woche ging? Ja, du hast eine wilde Geschichte erzählt, die über mehrere Kontinente ging. Europa, Nordamerika, Australien und mittendrin die irische Unabhängigkeitsbewegung.
Du hast es genannt, filmreife Flucht und es stimmt. Es ist die Geschichte einer filmreifen Flucht und viel mehr gewesen eigentlich. Also sehr, sehr spannende Geschichte, die glaube ich auch noch einiges hergibt. Da kann man noch ein bisschen was dazu machen. Ich denke auch, ja. Und vielleicht erzählst du ja heute die Fortsetzungsgeschichte dazu. Nein, heute nicht. Über die Finien-Rates. Ja, Richard, haben wir irgendwelche hausmeisterlichen Themen zu klären?
Geht's dir gut? Ja, mir geht's gut. Bin umgezogen. Das ist die erste Aufnahme aus dem neuen Studio, wenn man so will. Ja, man hört, es hört sich anders aus. Ja, da muss ein bisschen nachjustiert werden, um es zum richtigen Studio zu machen. Aber ich glaube, es geht. Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, damit du dann nachher weiter auspacken kannst, leg einfach mal los. Okay, okay. Daniel, wir springen ins Jahr 1806.
Auf einer Burg hoch über dem märischen Städtchen Graetz ist ein kleiner Kreis adeliger Gäste zum Abendessen geladen. Die Stimmung ist festlich, es gibt Wild, Wein, Konversation und mittendrin sitzt er, Ludwig van Beethoven. Zu jenem Zeitpunkt schon ein gefeierter Komponist und Pianist und eingeladen wurde er von seinem Gönner Fürst Lichnowsky.
Die Burg ist imposant, der Speisesaal ist groß, die Wände mit schweren Teppichen behängt, die so ein bisschen das Knirschen der Schuhe und das Klirren der Gläser dämpfen. Am Tisch sitzen adelige Damen, Herren mit unterschiedlichsten Orden, aber auch französische Offiziere.
Weil wir befinden uns ja mitten in den napoleonischen Kriegen und Napoleon hat längst ganz Mitteleuropa mit seinen Truppen überzogen. Und auch in Meeren logieren seine Offiziere, werden von Fürsten hofiert und sind eben deswegen an diesem Abend auch mit eingeladen.
Und nach dem Essen erhebt sich der Fürst und er wendet sich an seinen berühmten Gast und fragt halb bittend, halb fordernd, lieber Herr Beethoven, ein kleines Stück vielleicht für unsere Gäste. Und Beethoven hebt den Blick und tut nichts. Es vergehen ein paar Sekunden, er wird noch einmal gefragt und dann sagt er ziemlich laut, so dass das eigentlich alle hören,
Bin ich denn gar nichts als ihr Musikus? Stille setzt ein. Das Besteck liegt jetzt still auf den Tellern. Die Leute schauen sich gegenseitig an. Manche belustigt, andere ein bisschen verstört. Und was dann folgt, wird später in vielen Varianten erzählt.
Sicher ist, die Situation eskaliert. Der Fürst, beleidigt bis ins Mark, der geht auf Beethoven los. Und der Komponist, der ja relativ klein war, knapp 1,65 Meter, der weicht zurück. Es kommt zu einer Rangelei und dann schließlich zu einer richtigen Verfolgungsjagd durch dieses Schloss.
Beethoven flüchtet schließlich auf sein Zimmer. Lichnowsky tritt die Tür ein und da steht jetzt Beethoven mit einem Stuhl in der Hand, bereit, diesen Stuhl seinem Gönner über den Kopf zu ziehen. Er tut es dann aber doch nicht. Der Fürst Lichnowsky wird nämlich zurückgehalten von Franz Joachim Wenzel von Oppersdorf, weiteren Gast und Verehrer Beethovens. Beethoven nutzt das und packt seine Sachen, seine Noten.
Und auch sein Stolz. Er verlässt nämlich die Burg. Und zwar für immer. Und es ist das Ende einer langen Freundschaft, wenn man so will, und auch das Ende vor allem eines Gönnerverhältnisses, das Beethoven über Jahre getragen hat. Aber was genau ist da passiert?
Was bringt ein Komponisten, der diesem Fürsten einiges zu verdanken hat, dazu vor versammeltem Adel so einen Eklat zu provozieren? Warum dieser Zorn? Warum diese Szene?
Daniel, wir werden in dieser Folge über Beethoven sprechen, aber nicht generell, sondern über Beethoven und seine dritte Symphonie und was dieser Ausbruch im Schloss Graetz damit zu tun hat. Es ist nämlich genau dieser Stolz, dieser Wille zur Unabhängigkeit, dieses Ich-spiel-nicht-weil-du's-willst, das alles in dieser Symphonie steckt, die Beethoven drei Jahre vorher komponiert hat. Es ist ein Werk des
musikalisch genau das tut, was Beethoven an diesem Abend in Kretz auch persönlich tut. Es verweigert sich. Es bricht mit Erwartungen
Und das Werk feiert nämlich nicht die Macht, sondern den Einzelnen, der sich gegen sie erhebt. Und es ist ein Werk, das so eine Art Amalgam der politischen Wirren der Zeit, der Herkunft Beethovens und seiner persönlichen Schicksalsschläge ist. Und genau das werden wir uns in dieser Folge anschauen. Fantastisch, freue ich mich sehr drauf, Richard. Kommt wahrscheinlich ein bisschen bekannt vor.
Genau, der Teil kam mir bekannt vor, weil den hast du, glaube ich, bei einer Live-Show mal erzählt. Richtig. Also es ist tatsächlich so ungefähr 1000 Leute, die das jetzt hören. Die werden diese Geschichte in gewissen Zügen kennen, weil ich für die Live-Show letztes Jahr beim Here and Now habe ich das erzählt, weil ich mir gedacht habe, ich möchte mal Klarinette spielen auf der Bühne. Und habe die Klarinette mitgebracht und habe einen Teil der dritten Symphonie gespielt. Das wird es diesmal nicht spielen. Dafür hören wir professionelle Versionen dieser Symphonie.
Aber wir haben, glaube ich, das Video von dem Auftritt. Also wir können dein Klarinettenspiel, glaube ich, irgendwie posten. Niemand will es sehen. Mal schauen. Niemand will es sehen. Aber machen wir mal weiter hier. Aber ich meine, einerseits muss ich sagen, jetzt ohne die Geschichte schon zu kennen, kann ich es auch verstehen, weil wenn du dir Beethoven einlädst.
Willst du vielleicht auch, dass er sich kurz ans Klavier setzt, oder? Schauen wir. Ich meine jetzt, wenn du ihn einladen würdest, der kommt zu dir nach Hause, dann denkst du dir, wäre doch cool, wenn er auch mal kurz am Klavier spielt. Ja, es ist kompliziert, sagen wir es so. Es ist kompliziert. Aber du hast eine Gitarre bei dir zu Hause. Angenommen, du hast, keine Ahnung, Joe Satriani kommt zu dir nach Hause, dann würdest du ihm doch mal deine Gitarre in die Hand drücken, oder? Würde ich nie machen. Nicht? Nein.
Aber sprechen wir später drüber. Das ist der Kern der Sache. Wenn wir verstehen wollen, warum Beethoven in diesem Speisesaal in Graz so ausrastet und was das dann schließlich mit seiner dritten Symphonie zu tun hat, dann müssen wir dorthin zurückkehren, wo seine Geschichte beginnt und zwar nach Bonn.
Bonn ist zu jener Zeit, als Beethoven geboren wird, die Hauptstadt des Kurfürstentums Köln, auch Kurköln genannt. Vielleicht so zur Erklärung, es ist eines dieser geistlichen Fürstentümer im Heiligen Römischen Reich, regiert von einem Erzbischof, der gleichzeitig Kurfürst ist, also einer von den wenigen Fürsten, die das Recht haben, den Kaiser zu wählen. Aber, und Achtung, Mini-Exkurs,
Der Erzbischof von Köln, der regiert nicht von Köln aus. Die Stadt Köln selbst hat ihren Bischof schon im 13. Jahrhundert vor die Tür gesetzt. Er wollte frei sein, selbstständig, ohne geistlichen Fürsten über sich. Und seitdem residieren die Erzbischöfe ein paar Kilometer weiter, rein aufwärts in Bonn. Und aus diesem Umstand ergibt sich
Dann ein ziemlicher Gegensatz, das konservative, stolze Köln auf der einen Seite und das kleinere, aufgeklärtere Bonn auf der anderen. Und wie das bei geistlichen Fürstentümern üblich ist, gibt es hier keine Erbfolge. Also der nächste Erzbischof, der wird nicht geboren, sondern er wird gemacht. Oft einmal durch Intrige, Seilschaften, Adelsnetzwerke. Der bekannteste dieser Kurfürsten ist
Clemens August von Bayern, Wittelsbacher, wie die vier davor auch. Und genau bei dem arbeitet Beethovens Großvater, der auch schon ein Musiker ist, Kapellmeister, angesehenes Amt bekleidet also. Und später übernimmt dann ein neuer Kurfürst das Zepter, Maximilian Franz, der Bruder von Kaiser Josef II.,
Und mit ihm erlebt Bonn dann so eine Blütezeit. Künstlerisch, intellektuell und vor allem auch musikalisch. Die Hofkapelle wird ausgebaut. Man spielt dort Werke von Mozart und Haydn. Und vor allem weht auch der Geisteraufklärung durch die Straßen. Es ist eine kurze, aber prächtige, goldene Zeit in Bonn. Und
Am 17. Dezember 1770 wird dort Ludwig van Beethoven getauft. Geboren wurde er wahrscheinlich einen Tag vorher. Und auch wenn der Nachname van Beethoven so ein bisschen adelig klingt, das van klingt ja auch so ein bisschen wie das von, seine Familie hat mit dem Adel nichts zu tun. Also kein Adel, keine Güter, keine Wappen.
Sie sind in erster Linie eine Musikerfamilie. Sein Vater, Johann von Beethoven, der ist Tenor im Kurfürstlichen Orchester, ambitioniert, ehrgeizig und auch recht cholerisch. Und der erkennt das Talent seines Sohns recht früh und er will aus ihm ein zweites Wunderkind machen, so wie Mozart eines war.
Und das heißt natürlich üben, üben, üben. Also Disziplin, Strenge, Drill. Es gibt unterschiedlichste Berichte, dass der kleine Ludwig in der Nacht geweckt wird, um zu üben. Tobias Pfeiffer zum Beispiel, ein Sänger, Oboist und Pianist, jener Zeit er ist ein Freund der Familie, zeitlang auch Mitbewohner der Familie.
Und es gibt so diese Anekdoten, wenn er spätabends mit dem Vater Johann von Beethoven aus dem Wirtshaus zurückkam, wurde der kleine Ludwig dann wachgerüttelt und gezwungen Klavier zu spielen. Ein Feuilletonist der Kölschen Zeitung, der berichtet später, wie er gesehen hat, wie der kleine Ludwig von Beethoven im Haus der Familie Fischer auf einem Bänkchen steht, Klavier spielt und dabei weint.
Okay, langsam kriegt man eine Idee von der Anfangsszene, glaube ich. Es wird noch, wie soll ich sagen, es ergibt noch mehr Sinn. Der Vater Johann, der verfolgt natürlich einen Plan. Er will ein Wunderkind wie Mozart heranziehen, das dann auch die Familie ernähren soll. Und um das zu erreichen, da schreckt er auch vor nichts zurück. Also er beschimpft ihn, wenn er improvisiert wird.
darf er nicht, darf grundsätzlich von den geübten Sachen nicht abweichen, da setzt es dann Schläge und zwar nicht selten.
Der Hofgeiger Friedrich Egidius Neuesten, der ein Zeitgenosse Beethovens war, der soll Jahre später dann erzählen, und zwar erzählt er, dass der Pianist in Lisett Bernhard, dass Beethoven von seinem Vater so entsetzlich misshandelt worden sei, welcher ihn alle Tage geprügelt und er glaubt, dass das sonderbare Wesen, welches er an sich hatte, bloß davon herkomme. Aber trotz all dieser Härte, also trotz der Tränen und trotz dieser Prügel, das Talent...
In Beethoven, das ist unübersehbar. Und es trifft jetzt auch auf jemanden, der es tatsächlich so richtig erkennt, nämlich Christian Gottlob Nefe. Der ist ein gebildeter Komponist, Organist und ein Mann der Aufklärung. Als Ludwig ungefähr zehn Jahre alt ist, der nimmt Nefe ihn unter seine Fittiche und er führt ihn jetzt auch an Werke heran, die weit über das rausgehen, was man sonst in Bonn so hört.
Unter anderem Karl Philipp Emanuel Bach, also der Sohn von Johann Sebastian Bach und natürlich auch Johann Sebastian Bach. Also das wohltemperierte Klavier von diesem Bach, das wird Beethovens tägliche Lektüre, wenn man so will. Also Übung und Inspiration gleichzeitig.
Im Jahr 1783 wird er in einer öffentlichen Notiz dann auch zum ersten Mal erwähnt. Nicht nur, aber auch, weil eine seiner Kompositionen veröffentlicht wird. Neun Variationen für das Pianoforte über einen Marsch, verlegt in Mannheim. Es ist Beethovens erste veröffentlichte Komposition. Und auf diesem Titelblatt steht vom zehnjährigen Ludwig van Beethoven.
Was tatsächlich ein kleiner Trick ist. In Wahrheit ist er nämlich schon zwölf. Aber der Grund ist klar. Wer an Mozart denkt und das Wunderkind, der denkt an einen sechsjährigen Mozart und Beethoven, soll er eben auch als Wunderkind wahrgenommen werden. Das machen sie auf dem Titelblatt gleich noch einmal ein bisschen jünger. Aber das Bild des Genies, das wird hiermit schon geboren. Beziehungsweise das Bild wird hiermit begonnen zu malen.
Weil Bonn ist, wie ich es vorhin schon angedeutet habe, ja nicht nur Provinz, es ist ein Ort, an dem sich tatsächlich was tut. Also der Kurfürst, der gilt als liberal, aufgeschlossen, kunstfreundlich und die Stadt, die ist durchzogen von so einem Klima der Neugierde und des Fortschritts. Es gibt eine Universität, es gibt Debattierzirkel, die Leute lesen Voltaire, es wird über Freiheit, Gleichheit und Menschenrechte diskutiert. Und
Und mittendrin ist eben Beethoven, der, wie ich vorher schon gesagt habe, kein Sohn eines Adligen ist, kein Erbe mit Grundbesitz, sondern jemand, der weiß, wenn er was erreichen will, dann durch sich selbst und eben vor allem durch die Musik.
Allerdings lernt Beethoven recht früh, was es heißt, mit einem Fuß in der Welt des Adels zu stehen, aber mit der anderen immer wieder draußen zu bleiben. Also er spielt für Fürsten, er sitzt an den Klavieren der Mächtigen, aber nie als einer von ihnen. Immer als Bediensteter, als Musiker, als Attraktion. Und das nagt an ihm und wird ihn auch nie ganz loslassen. Mhm.
Beethoven will nämlich mehr. Er will nicht nur den Applaus, er will nicht nur die Gunst der Förderer, er will Anerkennung. Nicht als jemand, der, wie soll ich sagen, so gebückt ins Schloss geht, dort spielt, weil man ihm einen Dukaten in die Tasche steckt.
Also diese Spannung zwischen Herkunft und Anspruch, zwischen Stolz und der gesellschaftlichen Realität, das wird ihn sein ganzes Leben begleiten und wird sich immer wieder äußern. Manchmal mehr, manchmal weniger und irgendwann dann halt so richtig wie in diesem Speisesaal in Kretz im Jahr 1806.
Zum Verhältnis zu Mozart. Mozart ist zu dem Zeitpunkt schon älter und schon quasi so Superstar. Genau, der ist Superstar und wir werden jetzt auch gleich von ihm hören. Also nicht von ihm, aber über ihn. Wir werden deswegen von ihm hören, weil das, was ich erzählt habe über Krebs im Jahr 1806, da passiert ja noch einiges vorher. Und eine der Hauptsachen, die passiert ist, dass Beethoven, so wie viele Talente seiner Zeit,
dorthin geht, wo die Musik am lautesten klingt, wo vor ihm schon etliche Talente hingepilgert sind oder entdeckt wurden, und zwar nach Wien. Einer zum Beispiel, der vor ihm schon dort war und der kein Musiker an sich ist, sondern Librettist, war der Ponte, den ihr in GHG 460 schon erzählt habt, der nicht nur der Librettist von Mozart war. Und der war ja auch ohne Stand. Jedenfalls
Beethoven zieht nach Wien, allerdings als er nach Wien zieht, da ist es nicht das erste Mal, dass er in Wien war. Also schon im Frühjahr 1787, da ist er gerade mal 16 Jahre alt, da bricht er finanziert vom Kurfürsten persönlich auf nach Wien. Ich habe gelesen, 18 Tage dauert die Fahrt von Bonn nach Wien, muss mühsam gewesen sein.
Und der Plan ist ein Studienaufenthalt. Vielleicht Konzerte, vielleicht auch einfach nur das Eintauchen in diese Musikstadt Europas, wenn man so will. Und es
Es gibt Indizien, dass er in dieser Zeit Mozart getroffen hätte. Wird aber auch immer wieder angezweifelt. Es wird viel diskutiert. Angeblich spielt Beethoven ihm was vor und Mozart sei skeptisch gewesen, bittet ihn dann aber über ein Thema zu improvisieren und als Beethoven da loslegt, da soll Mozart leise gesagt haben, behalten Sie ihn im Auge, eines Tages wird er die Welt in Aufregung versetzen. Ob das genauso passiert ist,
Man weiß es nicht, aber die Geschichte ist gut und sie passt zu dem, was folgt. Beethoven nämlich, laut dieser Darstellung, ist von Mozart beeindruckt, aber er ist nicht ehrfürchtig. Später soll er über Mozarts Klavierspiel gesagt haben, fein, aber kein Legato, altmodisch. Und es ist jetzt auch klar, Beethoven, der ist nicht gekommen, um ehrfürchtig zu sein, sondern er ist gekommen, um zu lernen und dabei auch seinen eigenen Weg zu gehen.
Diese erste Reise nach Wien, die endet allerdings abrupt. Also nach weniger als zwei Wochen muss Beethoven zurück nach Bonn. Wahrscheinlich, weil die Mutter schwer erkrankt ist. Die stirbt dann auch noch im selben Jahr. Ich habe auch gelesen, dass es wahrscheinlich der starke Alkoholismus des Vaters war, der ihn dazu gezwungen hat, zurückzukehren, um der Familie auszuhelfen. Also dieser erste Aufenthalt in Wien, der bleibt kurz.
Recht unvollständig, aber es ist die erste Begegnung mit jener Stadt, die ihn faszinieren, aber auch herausfordern sollte. Für ihn ist es ein Ort der Möglichkeiten und deswegen im Jahr 1792
Da zieht er dann nach Wien. Allerdings ist nicht geplant, dass es ein permanentes Zuhause wird. Er wird finanziert vom Kurfürsten weiterhin und eigentlich soll er nur bei Haydn, dem berühmten Komponisten, über seinen Kopf habe ich in GHG 217 gesprochen, bei ihm soll er Komposition studieren. Mhm.
Aber, muss ich jetzt ein bisschen ausholen, vielleicht erinnerst du dich an meine Folge über den Schinderhannes. Dort habe ich schon einmal über diese Gegend gesprochen, aus der ja auch Beethoven stammt, das kurkölnische Rheinland.
Und über das, was dort zur Zeit der französischen Revolution und danach passiert. Über Besatzungen und vor allem auch über die Auflösung des Kurfürstentums, über die Verunsicherung, die diese Kriegsjahre mit sich bringen. Und wie soll ich sagen, das wird Beethovens Leben komplett verändern.
Nach seinem Studienaufenthalt hätte er nämlich zurückkehren sollen nach Bonn. Aber diese Rückkehr wird ihm jetzt verwehrt, weil nach mehrfachen Besetzungen des Rheinlands durch Frankreich im Herbst 1794 das Kurfürstentum Köln aufgelöst wird. Damit verschwindet nicht nur Beethovens Arbeitgeber, der Kurfürst, sondern auch jegliche Aussicht auf eine Karriere in Bonn. Also bleibt er in Wien.
wo ihn der eingangs erwähnte Fürst Lichnowski auch schon relativ schnell unter seine Fittiche genommen hat, als er dort angekommen war. Er stattet ihn mit einer Wohnung aus. Zuerst ist es so ein ärmliches Dachgeschoss, wie es Beethoven beschreibt. Dann wohnt er beim Fürsten im Palais selbst. Er schreibt einen Brief an seinen Freund Gerhard Wegeler und schreibt dort wirklich, dass der Fürst ihn ganz als Freund behandelt.
Aber schon kurz nach der Ankunft Beethovens in Wien, da zeigt sich so sein unangepasstes Wesen und exemplarisch dafür ist die Sache mit der Perücke. Wir kennen Beethoven ja alle mit seinem
Mit seinem wilden Haar. Das ist nicht umsonst. Weil eigentlich, kurz nachdem er in Wien ankommt, hat er einen Termin beim Perückenmacher. Weil Perücken, die gehören in Wien zum höfischen Stil. Auch sein Lehrer Haydn trägt eine.
Aber Beethoven, der lehnt solche, wie er es nennt, habituellen Albernheiten ab. Ihm ist es relativ gleichgültig, wenn sich die Wiener und Wienerinnen über sein wirres, dunkles, kaum gebändigtes Haar mokieren. Da gibt es eine Parallele zwischen dir und dem Beethoven, oder? Aber glaubst, mokieren sich viele Leute über mein wildes Haar. Die Zeiten sind vorbei.
Dass sich die Leute über seine Haare markieren, das macht nichts. Denn der Schlüssel zu Beethovens Erfolg in Wien, das ist zuerst einmal seine Klavierimprovisation. Also er brilliert mit Improvisationen. Er hat auch relativ schnell Zugang zu den höchsten Kreisen, wo er diese Dinge darbieten kann. Und es übertrifft im Grunde alles bisher Dagewesene in den adeligen Salons. Und schnell wird Beethoven so zu einem der führenden Pianoforte-Spieler seiner Zeit.
Piano Forte ist so ein Vorläufer des heutigen Hammerklaviers, aber es ist schon ein Hammerklavier. Und es ist im Fall von Beethoven ein Instrument, aus dem man alles rauskitzelt, was man rauskitzeln kann.
Und im Frühjahr 1800 tritt der damals knapp 30-jährige Beethoven zum ersten Mal mit seinen Kompositionen an die Öffentlichkeit. Er veranstaltet sein erstes eigenes Benefizkonzert im Burgtheater. Und er stellt dabei seine erste Symphonie und sein drittes Klavierkonzert zusammen mit Werken von Mozart und Haydn vor. So ein bisschen als Demonstration des großen Wiener Komponisten Dreigestirns.
Beethoven, Mozart und Haydn. Und damit festigt er jetzt schon seinen Namen als Komponist. Das ist auch ungefähr der Zeitpunkt, als Lichnowsky, sein Gönner, beginnt ihn auch tatsächlich finanziell zu unterstützen. Und zwar mit einer Appanage von 600 Gulden pro Jahr, was sehr viel ist.
Aber dann wird Beethoven abgelenkt. Und das hat mit der französischen Revolution zu tun. Einerseits ist er ja seit Bonner Zeiten von den Idealen der Aufklärung, wie soll ich sagen, durchdrungen. Er ist dort aufgewachsen und was sich hier auch zeigt, ist sein massiver Freiheitsdrang. In einem Stammbuch in Wien soll er im Jahr 1793 reingeschrieben haben, Freiheit über alles lieben und Wahrheit nie verleugnen. Das ist so sein Mantra.
Und diese Ideale, naja, die lassen sich nicht ganz so vereinbaren mit der Art und Weise, wie Musik in Wien zu jener Zeit komponiert wird oder dargeboten wird. Also in Wien, da ist die Musik noch höfisch, soll ich sagen, recht höfisch.
Ausgewogen, sie dient so der Stabilität, sie dient dem Lob des Herrschers, sie untermalt die Gespräche in den Salons, sie bekräftigt die gesellschaftliche Ordnung. Freundlich, elegant, relativ harmlos. Alles klar, proportioniert, durchdacht, recht vernünftig, keine massiven Erschütterungen.
Und dann ist da die Musik, die jetzt in Frankreich produziert wird. Im revolutionären Frankreich, da ist die Musik politisch. Sie marschiert, sie kämpft, wenn man so will. Die Musik dort ist keine Verzierung oder eine Untermalung, sondern man könnte sie schon fast als so eine Art Waffe bezeichnen.
Und in den Revolutionsjahren, da wird Musik halt auch zur Botschaft. Für Brüderlichkeit, für die Volkssouveränität, für Heldentum. Trompeten, Pauken, recht scharfe Rhythmen. Komponiert nicht für die Fürsten, sondern für das Volk. Und das ist auch was, was Napoleon Bonaparte recht früh erkennt. Wie Musik die Emotionen mobilisiert. Und er lässt sie auch gezielt einsetzen. Auf Plätzen, in Theatern, bei Staatsbegräbnissen.
Eklat Terrible, der erhabene Schrecken und Eklat Triumphal, die triumphale Wucht, wenn man so will.
Beethoven ist fasziniert. Er findet diese Art Musik, wie er schreibt, außerordentlich attraktiv. Also diese Musik bewegt und sie bewegt vor allem die Geister. Er besitzt sogar ein Heft mit Revolutionsmusik. Das ist ein Geschenk vom Schweizer Violinisten Rodolf Kreuzer, das er ihm mitgebracht hat. Dem wird übrigens später auch die sogenannte Kreuzersonate widmen, falls du dich gefragt hast, ob das dasselbe ist. Sehr gut, weiß ich das auch.
Und Beethoven, der bewundert Napoleon. Aber nicht in erster Linie in seiner Rolle als Tagespolitiker, wenn man so will, sondern als Symbol. Er ist auch jemand, der keine Krone geerbt hat, sondern er erobert sich alles.
Beethoven träumt jetzt auch von Paris, von dieser Freiheit, von dieser bürgerlichen Konzertkultur, von diesem Ruhm ohne Hofzwang. Wien, das ist für ihn oft nur, wie er es nennt, ein Unrechtsstaat mit Zensur und recht engen Verhältnissen. Er will eigentlich Musik als Ausdruck und nicht als Dienst. Und deswegen 1802, da spielt er ernsthaft mit dem Gedanken, nach Paris zu gehen.
Stattdessen beginnt er aber die Arbeit an seiner eigenen Revolutionsmusik, an einem Werk für die Geschichte, am Werk gegen das Gefällige, am Werk, das eben nicht gefallen will, sondern das überwältigen soll. Es ist aber nicht nur die Revolution, die dieses Werk prägen soll, sondern auch sein persönliches Schicksal. Im Jahr 1802 zieht sich Ludwig van Beethoven in den kleinen Wiener Vorort Heiligenstadt zurück und
wo er dann auch die ersten Skizzen für dieses Werk anfertigen wird. Heiligenstadt wird aber vor allem, wie soll ich sagen, zum Schauplatz seines inneren Umbruchs. Beethoven ist nämlich krank. Also jetzt nicht fiebrig oder körperlich geschwächt, sondern er ist gekennzeichnet von einem Leiden, das für einen Musiker und Komponisten das wahrscheinlich Schlimmste ist, was man sich vorstellen kann.
sein Gehör lässt nach. Also schon seit den späten 1790ern merkt er, dass er bei Gesprächen Mühe hat, alles zu verstehen, dass er Klänge nicht mehr klar hört, dass da ständiges Rauschen in seinem Kopf ist. Und anfangs verdrängt er es, er ignoriert es, aber in heiligen Städten ist es nicht mehr zu leugnen. Auf ärztlichen Rat zieht er sich zurück zur Ruhe, zur Erholung.
Und er schreibt was, einen Brief. Nicht an Freunde, nicht an Mäzene, sondern an seine Brüder Karl und Johann. Es ist ein Schreiben, das eigentlich ein Testament ist. Und wie soll ich sagen, es ist ein Dokument des Schmerzes, es ist ein Dokument der Verzweiflung, aber es ist auch ein Dokument der Hoffnung. Heute kennen wir das Ganze als das Heiligenstädter Testament.
Und in diesem Testament, da klagt er zum Beispiel ganz am Anfang auch, wie sehr ihn das Unverständnis seiner Mitmenschen trifft. Also es ist ja so, dass Beethoven generell als grantiger Mensch galt. Ein bisschen krummelig ständig und ein bisschen misanthrop. Und genau das spricht er in diesem Testament an. Dass die Mitmenschen ihn für unhöflich, für mürrisch halten, obwohl er einfach nur nicht versteht, was sie zu ihm sagen. Er schreibt, oh ihr Menschen, die ihr mich für feindselig, störrisch
Oder misanthropisch haltet, wie Unrecht tut ihr mir. Er schreibt auch davon, wie schwer es ist, in dieser Isolation zu leben. Auch davon, wie nah er schon dem Aufgeben war und was ihn dann schließlich davon abgehalten hat. Nur die Kunst, sie hielt mich zurück. Es schien mir unmöglich, die Welt eher zu verlassen, ehe ich das alles hervorgebracht hätte, wozu ich mich aufgelegt fühlte.
Also wie es seine Biografin Christine Eichel schreibt, es wird klar in diesem Testament, Beethoven mag vielleicht die Menschen nicht, aber er mag die Menschheit und der will er jetzt noch was geben. Er ist noch nicht fertig.
Und genau hier, so in diesem Moment des Eingeständnisses und auch dieser Klarheit, da beginnt was ganz Neues, so ein radikaler Wandel, der sich auch in seiner Musik zeigen wird. Und dieser Wandel, der beginnt jetzt Form anzunehmen und zwar in Form der dritten Symphonie. Es wird eine Symphonie werden, die nichts mehr mit dem zu tun hat, was man bis zu jenem Zeitpunkt gekannt hat. Also die alten Formen, die reichen nicht einmal aus, um das zu beschreiben, was da passiert. Also
Josef Haydn, sein Lehrer, der gilt ja als der Vater der Symphonie und er hat im Laufe seines Lebens über 100 Symphonien geschrieben. Elegant, ausgewogen, oft auch einmal so mit einem Augenzwinkern. Das ist Beethoven aber zu wenig.
Heidens Symphonien, die ähneln so architektonischen Meisterwerken. Klar gegliedert, auch mit so einem Schuss Humor, immer in sehr guter Balance. Also die Melodien fließen, die Struktur ist durchschaubar. Es ist eine Musik, die erfreut, die erhebt.
manchmal auch überrascht, aber eigentlich so gut wie nie überfordert. Beethoven, der geht jetzt einen anderen Weg. Er nimmt diese Form der Symphonie und er bricht sie auf. Er macht sie länger, tiefer, konfliktreicher. Seine Sätze, die werden dramatisch, mitreißend und er komponiert damit keine Unterhaltung, er komponiert Auseinandersetzungen.
Und inmitten all dieser inneren Kämpfe zwischen Hörverlust und Revolutionsbegeisterung, zwischen Rückzug und Wut, da steht die Figur, der diese neue Musik widmen will, nämlich Napoleon Bonaparte. Napoleon. Also er ist ein Mann, der, so wie er es sieht, genau diesen Kampf zwischen Ordnung und Freiheit, zwischen Herkunft und Aufstieg ebenfalls durchlebt hat. Also ein Held, der nicht als Held geboren wurde, sondern der sich selbst zu einem gemacht hat.
und der, wie er selbst auch, diese alten Mächte herausfordern will. Also auf dem Titelblatt seiner neuen Symphonie soll also stehen, Sinfonia Grande in titulata Bonaparte. Also Bonaparte gewidmet. Aber Napoleon, der hat eigene Pläne und die werden Beethoven nicht gefallen.
1804, da lässt sich Napoleon Bonaparte nämlich zum Kaiser der Franzosen krönen. Also mit Krone, mit Thron, mit Prunk und vor allem mit sich selbst im Mittelpunkt.
Er setzt sich ja auch selbst die Krone aufs Haupt und es ist ein Akt der Inszenierung, der Überhöhung und einer, der Beethoven sehr tief trifft. Weil was ihn ursprünglich an Napoleon fasziniert hat, der Bruch mit der alten Ordnung, das Ideal der Republik, das scheint für ihn jetzt zu verraten. Also aus diesem Revolutionär, da wird jetzt einfach ein neuer Herrscher.
Die Anekdote, die seitdem gern erzählt wird, ist folgende. Also Beethoven, der gerade die Partitur dieser neuen Sinfonie abschließt, der erfährt von der Krönung und er reagiert wütend. Er soll angeblich das Titelblatt zerrissen haben und dann ausgerufen haben, ist er auch nichts anderes, wäre ein gewöhnlicher Mensch. Nun wird er auch alle Menschenrechte mit Füßen treten, nur seinem Ehrgeiz frönen.
Ob das genau so passiert ist, schwer zu sagen. Es ist höchstwahrscheinlich eine Erfindung seines Sekretärs. Aber eine Abschrift dieses Werks vom August 1804 zeigt noch die von Beethoven ausradierte Zeile in Titulata Bonaparte. Und diese Ausradierung, die ist so heftig, dass sie zum Teil das Papier zerrissen hat.
Allerdings dürfen wir bei dieser Umbenennung und bei dieser schönen Fügung, was das tatsächlich für Beethoven bedeutet hat, dass Napoleon sich zum Kaiser gekrönt hat, dürfen wir einen anderen Aspekt auch nicht vergessen. Beethoven ist freier Komponist und er ist auf Mäzenatentum angewiesen, er ist auf Gönner angewiesen, die immer Geld dafür geben, für das, was er macht.
Wie zum Beispiel der vorhin erwähnte Lichnowsky, Fürst Lichnowsky. Und obwohl Beethovens Widmung der Symphonie, dem Napoleon Bonaparte, obwohl es in Paris zum Beispiel gut ankommen wird, er ist in Wien und in Wien, da braucht er jetzt Geld. Also ein Werk wie die dritte Symphonie, so monumental, so gewaltig, das braucht Unterstützung. Also du musst diese Sachen proben, du brauchst die Musiker dafür, du brauchst einen Raum und dafür brauchst Geld.
Und das bekommt Beethoven nicht aus Paris, sondern das kriegt er in Wien. Genauer gesagt kriegt das vom Fürsten Lobkowitz, am weiteren Gönner. Ein Musikliebhaber, reich, offen für Neues und bereit für das Recht zu zahlen, dieses Werk eine Zeit lang exklusiv aufführen zu dürfen.
Und Fürst Lobkowitz wird jetzt einmal der neue Widmungsträger dieses Werks. Und es ist nicht nur ein Namenswechsel, weil wir müssen uns ja auch vor Augen halten, der politische Wind in Wien, der weht zu ihrer Zeit sehr gegen Frankreich. Napoleon, der ist der Feind. Gegen Frankreich hat Österreich gerade kurz vorher den Zweiten Koalitionskrieg verloren.
Abgesehen davon, dass diese revolutionären Umtriebe auch vorher in Wien jetzt nicht so wahnsinnig gern gesehen wurden. Wir müssen ja auch bedenken, Maria Antoinette, die ja auch im Zuge der Revolution hingerichtet worden war, das war eine habsburgische Prinzessin.
Die erste Aufführung der dritten Symphonie, die findet dann 1804 nicht unüblich im privaten Rahmen statt und zwar direkt im Palais Lobkowitz. Also keine öffentliche Aufführung, sondern nur geladene Gäste von Lobkowitz. Ein sehr exklusives Publikum, so ein bisschen Art Probebühne für das, was da noch kommen sollte. Beethoven erhält 700 Gulden dafür, was eine ziemlich stattliche Summe ist.
Und wie ich es vorhin schon gesagt habe, Blopkowitz, der sichert sich damit die alleinigen Aufführungsrechte für dieses Werk für eine bestimmte Zeit.
Dieser Saal, relativ schmal, mit grauem Marmor, goldbemalter Decke, eigentlich gebaut für Kammermusik, also für weniger Musiker, nicht für so ein richtiges Orchester. Trotzdem drängen sich hier jetzt 25 bis 30 Musiker vor den Gästen, sind Adlige, Neugierige, die sitzen jetzt auf den rot gepolsterten Bänken, lehnen an Türrahmen,
Spazieren auch durch die Nebenräume. Es ist keine stille Andacht, sondern eher so ein höfisches Flanieren mit Hintergrundmusik. Nur, wie Sie bald merken werden, diese Musik ist alles andere als Hintergrund. Beethoven ist da auch anwesend, er probt noch, er korrigiert. Und was hier jetzt auch auffällt, er hört die Bläser kaum noch. Das ist ein frühes Zeichen dafür, dass er bald so gut wie gar nichts mehr hören wird.
Die Musiker kämpfen sich bei dieser ersten Aufführung durch diese neuartigen Klänge der dritten Symphonie. Sie verstehen es nicht, noch nicht. Es ist die wahrscheinlich seltsamste Musik, die sie jemals gespielt haben. Nach zwei weiteren privaten Aufführungen folgt dann am 7. April 1805 die öffentliche Premiere im Theater an der Wien. Es ist ein Benefizkonzert für den Geiger und Direktor des Hausorchesters Franz Klement.
Und ich habe mir den Theaterzettel rausgesucht bei Anno, Historische Zeitungen und Zeitschriften der österreichischen Nationalbibliothek. Und da sieht man auf diesem Theaterzettel, dass das Konzert in zwei Abteilungen gegliedert ist und bei der zweiten steht, eine neue große Symphonie in Dies von Herrn Ludwig van Beethoven, zugeeignet seiner durchlaucht Fürsten von Lobkowitz. Auch wird der Verfasser dieselbe selbst zu dirigieren, die Gefälligkeit haben. Das heißt,
Selbst am Dirigentenpult stehen bei der ersten öffentlichen Aufführung, das lässt er sich nicht nehmen. Obwohl ihm einige aufgrund seines schon schlechten Gehörs davon abgeraten haben. Was hat er eigentlich für Feedback bekommen bei diesen ersten nicht öffentlichen Auftritten oder Vorführungen? Lass uns über das Feedback nachher sprechen. Weil wir wissen es vor allem von der ersten öffentlichen Premiere und weniger von dem privaten.
Übrigens, falls es dir oder irgendjemandem sonst aufgefallen ist, in diesem Theaterzettel steht, dass es eine Symphonie in Discs ist. In Wirklichkeit ist es aber die dritte Symphonie in S-Dur. Ich habe das gesehen und habe gedacht, weird, und habe dann nachgelesen und natürlich bin ich nicht der Erste, dem das auffällt. Die allgemeine musikalische Zeitung wird das später richtigstellen und dezidiert darauf hinweisen, dass das auf diesem Theaterzettel falsch angekündigt worden ist. Deshalb sind so wenig kommen.
Naja, was ist es jetzt aber, was die Zuhörerinnen und Zuhörer an diesem Tag zu hören bekommen?
Ich habe es vorhin schon angedeutet, die dritte Symphonie, die später dann bekannt werden wird als die Eroica, das ist eine Symphonie wie keine andere. Sie ist im Grunde ein Manifest und sie ist auch ein Befreiungsschlag. Vor allem aber ist sie in allem zu viel, zumindest für die Leute dort. Sie ist zu lang, sie ist zu laut, sie ist zu komplex und für manche auch zu anstrengend.
Aber genau darin liegt auch ihre Größe. Also schon der erste Satz, ein Allegro con brio in S-Dur, beginnt nicht mit einer Einleitung, sondern mit zwei Akkordschlägen. Musik
Also zwei Hammerschläge, die gleich klar machen, hier passiert was anderes. Und danach entwickelt sich dann ein Satz, der im Grunde alles sprengt, was bis dahin als Sonatenhauptsatzform gegolten hat. Es werden Themen eingeführt, die werden dann wieder verworfen, sie werden transformiert. Es gibt plötzliche Modulationen, so wütende Ausbrüche, dann wieder recht seltsame.
sanfte Rückzüge. Also es ist so ein musikalischer Ritt durch Höhen und Tiefen, Triumph und Zweifel, so ein bisschen wie ein innerer Monolog eines Menschen wie Beethoven. Der zweite Satz, der berühmte Trauermarsch, der Marcha Funebre, ist ein Trauermarsch in C-Moll, der nicht nur ein langsames Zwischenspiel ist, sondern der emotionale Kern der ganzen Symphonie. Das fängt dann so an.
Also hier wird Leid tatsächlich hörbar gemacht, allerdings in diesem Trauermarsch nicht resignierend, sondern kämpfend. Also dieser Marsch, der entwickelt sich zu so einem dramatischen Klagegesang und es ist auch so ein bisschen ein Hauch von Trost da, kein Happy End, aber zumindest tiefe menschliche Tragik, die man hier durchhört.
Und dann kommt der dritte Satz, das Scherzo. Schnell, ungestüm, voller Bewegung und üblicherweise, bei so Symphonien, der dritte Satz wäre eigentlich in Menuet-Form gewesen. Nicht aber hier, da gibt es dann das. Musik
Du hörst das jetzt und denkst dir, ja, klingt für mich eigentlich ganz normal. Für die Leute damals ist das was ganz Neues. Also die Musik dieses Satzes ist voller Überraschungen, voller Wendungen. Es kommen Jagdhörner vor und das ist so ein bisschen Erinnerung an Jagdmusik und es ist der Verweis auf Natur, auch auf Freiheit.
Und dann kommt das Finale, der letzte Satz. Und das basiert auf einem Thema, das Beethoven schon früher verwendet hat, und zwar in seinem Ballett »Die Geschöpfe des Prometheus«.
Das passt auch, weil Prometheus das Feuer bringt und es ist im Grund die mythische Figur für, kann man so musikalischen Götterfrevel nennen. Also Beethoven nimmt dieses an sich schlichte Thema aus diesem früheren Werk und er variiert es jetzt durch alle möglichen Formen, manchmal fugenhaft, dann tänzerisch, manchmal sehr ausladend. Das hört sich dann teilweise so an. Musik
Musik
Also der letzte Satz ist im Grunde so die Krönung des Ganzen und es ist so ein Ausbruch an Lebenskraft, an Kreativität, aber eben auch in der Art und Weise, wie es geschrieben ist, der Menschlichkeit. Und genau darum geht es in dieser Eroika, in dieser dritten Symphonie, um den Menschen. Es geht nicht um Fürsten, es geht nicht um Götter, sondern es geht um den Menschen, in all seiner Größe, in all seinem Scheitern, aber auch vor allem in all seiner Würde.
Die Heroika ist ein Werk, das nicht gefallen will, sondern aufrütteln, herausfordern. Im Grunde ein Werk, das fragt, was ist ein Held? Ist es ein Mann mit Krone oder ist es ein General auf dem Schlachtfeld oder ist es ein Komponist, der trotz seiner zunehmenden Taubheit hier eine ganz neue Welt erfindet?
Und mit der Eroika wird klar, Beethoven will jetzt mehr, er will mehr als nur Musik, er will im Grund Weltveränderung durch Klang. Was aber sagen jetzt die Menschen dazu, die da im April 1805 zum ersten Mal dieser völligen Neuheit lauschen?
Ich würde mal schätzen, die sind von ihren Hörgewohnheiten her überfordert mit dem, was sie da hören und pfeifen ihn aus. Auspfeifen ist ein bisschen zu viel gesagt, aber sagen wir so, sie sind verblüfft, sie sind überfordert und sie sind auch ratlos.
Viele finden die Symphonie zu schwierig, zu lang, vor allem aber auch ohne erkennbare Struktur. Was auch damit zusammenhängt, es gibt keinen Programmtext, es gibt keine Erklärungen, es gibt auch keinen roten Faden, an dem sie sich festhalten können. Also ein Zuhörer soll ausgerufen haben, ich gebe noch einen Kreuzer, wenn das Ding nur aufhört. Der einzige Lichtblick für manche ist der Trauermarsch. Der ist noch am ehesten greifbar.
Das Scherzo sorgt vielleicht hin und wieder für ein Lächeln, aber das war es dann auch. Und das Finale, diese Variationen, dieses Ausbrechen aus allem Erwartbaren, das ist für die meisten einfach nur fremd. Und Beethoven selbst, der ist verärgert. Applaus war zwar da, aber zu spärlich für seinen Geschmack. Also er weigert sich sogar, diesen Applaus zu akzeptieren. Für ihn war das nämlich nichts als einfach nur ein höfisches Stimmchen.
Bravo-Werte, sondern für ihn ist es ein Meilenstein und den will er natürlich gefeiert wissen. Die ersten Rezensionen sind dann auch sehr zurückhaltend, manche auch ein bisschen bissig. Viele schreiben von Übertreibung, von Maßlosigkeit und die Musiker selbst, die tun sich damit halt auch schwer. Also die Partitur dieses Werks, die ist so komplex, die ist voller technischer Hürden.
Es gibt aber natürlich auch Ausnahmen. Also einige Komponistenkollegen, zum Beispiel Ferdinand Ries, der auch ein Schüler Beethovens war, die erkennen jetzt sofort, hier passiert was ganz Großes. Also etwas, das nicht nur die Musik verändert, sondern das Hören selbst. Im Jahr 1806 erscheint dann die Partitur auch im Druck.
Und er hält da jetzt auch den endgültigen Titel Sinfonia Eroica Composta per festeggiare il sovenire di un gran duomo. Also die Sinfonie Eroica komponiert, um das Andenken eines großen Mannes zu feiern. Dieser große Mann, fragt man sich auch, wer ist das? Also
Lobkowitz ist es eher nicht. Napoleon auch nicht mehr. Ist es vielleicht Beethoven selbst? Er feiert sich selbst. Oder es könnte natürlich auch kein spezifischer Mann an sich sein, sondern dieses Ideal des freien, heroischen Individuums. Vielleicht ist es einfach auch eine Mischung von allen, die ich gerade aufgezählt habe.
Und obwohl die anfänglichen Reaktionen auf dieses Werk zurückhaltend bis ablehnend sind, ändert sich das relativ bald. Also schon zwei Jahre später, ab 1807, also seit der Uraufführung der Öffentlichen, da kippt so diese Wahrnehmung. Also Publikum und Kritik, die beginnen jetzt auch das Werk mit.
mit zunehmender Begeisterung zu feiern. Die Allgemeine Musikalische Zeitung, das einflussreichste Musikblatt der Zeit, spricht jetzt auch von einem merkwürdigen und kolossalen Werk, einem der kunstreichsten und originellsten des Beethovens wunderbarer Geist hervorgebracht hat. Also was anfangs verstört hat, das wird jetzt langsam verstanden und auch bewundert.
Spätestens ab 1820 ist klar, die Eroika ist mehr als eine Symphonie, die ist ein Aufbruch. Und Beethoven gilt jetzt als das, was er immer sein wollte, nämlich ein Universalgenie. Die Eroika wird zum Inbegriff dieses beethovenschen Heldenideals, also des freien Menschen, der trotz aller Widrigkeiten aufsteht, sich wehrt und seinen eigenen Weg geht, auch wenn am Anfang niemand folgen will.
Und die Eroica ist auch ein Werk gegen das Verstummen, gegen das Aufgeben, auch gegen das Sichfügen, so wie er es eigentlich ja auch machen hätte können. Und mit der Eroica beginnt dann auch das, was man später den titanischen Beethoven nennen wird. Also ein Künstler, der sich selbst und die Musik neu erfindet und damit gegen die Konventionen rebelliert.
Und damit kommen wir jetzt wieder zurück, zurück auf diese Burg in Graetz im Jahr 1806, zurück zu diesem Abendessen, zu seinem Gönner, zu der Forderung seines Gönners und zu eben diesem Komponisten, der aufsteht und ruft, dass er mehr ist als einfach nur ein Musikus.
Und was an diesem Abend, in diesem Moment passiert, das ist eben mehr als nur Laune. Es ist im Grunde die Entladung seines ganzen Lebenswegs. An einer Biografie, die geprägt ist von Fremdbestimmung, von Erwartungen, vom ständigen Versuch, sich aus sozialen, finanziellen und kulturellen Abhängigkeiten zu befreien.
Also Beethoven, der Komponist des freien Menschen, soll nach dem Essen ein bisschen spielen, für Gäste, für Franzosen vor allem, ja, also für Offiziere eines Regimes, das er früher bewundert hat, das er jetzt aber verachtet.
Und es wird halt auch klar, sein Gastgeber Fürst Lichnowsky, der ist eben nicht einfach nur ein Freund, sondern er ist Teil jener Gesellschaft, die Beethoven sein Leben lang herausfordert, teilweise demütigt, aber halt auch gleichzeitig jener, dem er verdankt, dass er überhaupt komponieren kann. Also Beethoven, der will nicht unterhalten, er will nicht dankbar sein, er will gehört werden und das will er auf Augenhöhe.
Und deswegen steht er auf und schreit, deswegen wird er von Lichnowsky angegriffen, deswegen sperrt er sich in seinem Zimmer ein und deswegen verteidigt er sich mit einem Stuhl in der Hand. Das ist ein bisschen wie eine Szene aus einer Oper. Ein letzter Akt, ein Showdown, nur eben nicht auf der Bühne, sondern im echten Leben von Beethoven. Beethoven quasi als der Held seiner eigenen Oper. Und was in Gretz passiert, ist eben auch darin,
der Endpunkt einer Beziehung, nämlich zu Lichnowsky, aber es ist der Beginn einer Haltung mit weit weniger Kompromissen. Also auf die Unterstützung der Fürsten ist er weiter angewiesen. Aber der Grad, auf den er jetzt wandert, der ist weit mehr von seiner eigenen künstlerischen Unabhängigkeit geprägt als vorher. Vielleicht war genau dieser Eklat nötig, um all das, was sich in der Eroika schon angestaut hat, auch außerhalb der Musik hörbar zu machen.
Also wenn du sagst, das ist so der Moment, wo er dann auch nicht mehr Kompromisse eingeht, wo er dann auch so ein Stück weit wahrscheinlich radikaler wird. Hat es da damit zu tun, dass er zu dem Zeitpunkt auch schon fast nichts mehr hört? Ja, sicherlich auch. Das spielt er die ganze Zeit mit. Seit dem Heiligenstädter Testament. Und fließt eben auch in das genauso ein, wie es eingeflossen ist, in seine Art und Weise, die dritte Sinfonie zu komponieren. Ja.
Schlussendlich will Beethoven bei seinem Ausbruch in Kretz dann eben auch zeigen, dass auch ein Musiker kein Spielzeug ist, sondern einfach ein Mensch mit Haltung und vor allem in seinem Fall mit einer Musik, die bleibt. Tja und das, lieber Daniel, war meine Folge über die Entstehung der dritten Symphonie Beethovens und was uns das nicht nur über den Mann selbst, sondern auch über die Verstrickungen Europas mit der französischen Revolution erzählt.
Fantastisch. Vielen, vielen Dank, Richard. Sehr interessante Folge. Was mich so fasziniert ist, den Gedanken, den du vorhin kurz angedeutet hast, nämlich, dass wir, wenn wir die Musik heute hören, dieses Revolutionäre uns ein Stück weit dazu denken müssen, weil wir natürlich musikalisch ganz alles geprägt sind. Ja, also immer die Sache natürlich mit Musik, die nicht aus unserer Zeit ist. Ja.
grundsätzlich bei klassischer Musik natürlich auch schwierig. Also ist ja klassische Musik für viele oder Konzertmusik für viele einfach auch sehr unzugänglich, weil genau diese Zugänge fehlen. Lustigerweise eben können Leute auch vor den Kopf gestoßen werden zu jener Zeit durch sowas und es genauso wenig verstehen wie heutzutage jemand, der es hört ohne die
ohne die Umstände zu kennen, davon überfordert wäre oder davon überfordert ist. Ich würde es aber vielleicht sogar andersrum sagen und sagen, heutzutage ist es zugänglicher, weil diese Art von klassischer Musik ganz, ganz viel als Hintergrund verwendet wird. Für Filme, für einfach so im Hintergrund. Also man kennt ganz, ganz viele klassische Stücke, ohne dass man weiß, also ohne dass man sie kennt.
Ohne, dass man weiß, was es tatsächlich ist. Was wahrscheinlich Beethoven nicht so getaucht hat. Dass diese Sachen jetzt natürlich auch für, ich meine, keine Ahnung, die fünfte Sinfonie ist, glaube ich, der erste Satz oder auch nur die ersten paar Takte des ersten Satzes. Das ist wahrscheinlich das berühmteste Stück überhaupt, das man überall hört.
Was ja für die jetzt persönlich auch kein großes Problem dasteht, weil Musik, und das sieht man ja auch hier, die existiert ja auch nicht in einem Vakuum. Und sie kann doch nicht in einem Vakuum existieren und sie wird immer natürlich dann weiterhin in der Wahrnehmung beeinflusst von dem, was danach gekommen ist. So wie die Musik von Mozart wahrscheinlich für viele anders geklungen hat, nachdem sie dann einmal die dritte Sinfonie gehört haben.
Und sich damit auseinandergesetzt haben. Das ist genau, glaube ich, das Revolutionäre. Also, dass sich sowas beeinflusst. Und das ist das, was uns heute ja fehlt. Also, ich höre jetzt heute Beethoven nicht so viel anders, nur weil ich vorher ein Mozart-Stück gehört habe. Ja, genau. Man muss sich dann... Und das macht es natürlich auch in der, wie soll ich sagen...
In der Estimierung eines solchen Stückes schwierig, weil man muss sich schon ein bisschen damit auseinandersetzen, um die tatsächliche Größe auch zu erkennen. Aber wenn man es mal gemacht hat, dann erkennt man es. Dann lässt es einen auch nicht mehr los. Ich glaube, die emotionale Bindung ist auch insofern eine andere, weil Musik halt damals auch nicht so zugänglich war. Du musstest dir das live anhören und du hast es in dem Moment gehört.
Und wir könnten uns das Stück ja öfter anhören. Aber ich weiß, hast du dir das Stück nicht vor kurzem live angehört? Das ist ja auch der Grund, warum ich mir gedacht habe, ich muss das jetzt machen. Weil diese Woche ist...
ist ein Konzertzyklus zu Ende gegangen. Und zwar alle Beethoven-Symphonien in vier Konzerten, dirigiert von Jordi Saval und seinem Orchester. Da war ich gestern beim letzten Konzert und da ist die 8. und 9. gespielt worden. War ein Geburtstagsgeschenk für meine Mutter. Und da haben wir sie dann hier quasi nach Wien geholt, im Februar und jetzt im Juni und waren auf diesen
Vier Konzerten insgesamt und ich war so jetzt die Woche so beseelt davon, dass ich mir gedacht habe, ich muss jetzt diese Folge über die dritte Sinfonie machen. Die dritte Sinfonie hat schon im Februar gehört, diese Woche dann die erste, zweite, vierte, achte und neunte. Aber wenn, wann nicht jetzt? Ich bin jetzt mittendrin im Beethoven-Fieber. Hast du jetzt so einen Eindruck, welche Sinfonie hat dich am meisten emotional berührt?
Also am meisten habe ich mich halt auseinandergesetzt mit der dritten und die finde ich historisch halt auch so interessant. Die neunte ist halt ein Wahnsinn. Bei der neunten hast du Freude, schöner Götterfunken dabei, da war dann die einzige Symphonie, wo du dann Chor und Solisten dabei hast. Und ich meine, da ist die letzte Viertelstunde einfach, haut die einfach aus den Socken. Also es war echt sehr, sehr, sehr gut. Sehr schön. Ja, aber eine Sache wollte ich noch fragen und zwar diese Geschichte mit...
dass Beethoven unzufrieden war mit der Reaktion, weil er selber das Stück schon für revolutionär so erachtet hat. Hat er sich selber, meinst du, auch schon als so verkanntes Genie gesehen? Ja, ja, sicher. Nein, er hat sich nicht als verkannt, sondern er hat sich als Genie gesehen. Ja, genau, aber eines, das zu wenig Aufmerksamkeit bekommt dafür, dass er ein Genie ist. Kann man so sagen. Ich meine, kann er den reinschauen, aber die Indizien deuten schon darauf hin. Ich meine, ich habe jetzt auch nur gekratzt,
An der Oberfläche des Charakters von Ludwig van Beethoven. Es sind ja viele, viele, viele Bücher geschrieben worden über ihn und auch in der Art und Weise, wie seine legendäre Misanthropie und so weiter wahrgenommen wird und ob es jetzt wirklich war und auf was zurückzuführen ist. Da gibt es tatsächlich sehr viele unterschiedliche Stimmen. Also es gibt auch die, die sagen, auch zeitgenössische Berichte von Leuten oder von Freunden, die sagen, dass er eigentlich ein sehr geselliger Typ war. Aber
dass er sehr aufbrausend war und dass es sehr leidenschaftlich war. Das ist belegt. Aber ansonsten, glaube ich, er war einfach, wie soll ich sagen, er war sehr von sich überzeugt, was er eben halt auch konnte, weil er war eben ein fantastischer Komponist. Und da kann man das ruhig sein, aber dass es nicht immer einfach ist in so einer Welt, vor allem wenn du eben jemand bist, der auch immer in Abhängigkeiten steht, ist natürlich auch klar. Naja, klar. Aber es gibt ja unterschiedliche Arten von Künstlertypen,
Es gibt ja welche, die ständig von Selbstzweifeln geplagt werden. Und es gibt dann das andere Extrem, die, die sich für schon unglaublich genial halten. Ich glaube, das eine schließt das andere nie wirklich aus. Also ich glaube, in einem Moment kannst du dir denken, puh, wie jetzt ein monumentales Werk komponiert, das die Jahrhunderte überstehen wird. Und im nächsten kannst du dir denken, was mache ich hier eigentlich für einen Scheiß? Ich glaube, das ist tatsächlich auch so ein bisschen das Wesen,
des Künstlers oder Künstlerin. Irgendwo im Hinterkopf habe ich diese Anekdote im Kopf über Beethoven, dass er mal verhaftet wurde, weil er nicht erkannt wurde, weil er so strubbelig rumgelaufen ist. Ist er nicht über den Weg gelaufen? Ich habe das von Bob Dylan gehört. Vor ein paar Jahren. Aber nein, ist mir nicht unterkommen. Also jetzt nicht im Zuge meiner Recherche zu dieser Zeit.
Ich habe ja vorhin diesen Witz gemacht mit der Frisur und ihn mit deiner verglichen, aber ich bin ja nicht der Erste, der das macht, oder? Es gibt dieses eine Foto von dir, wo Leute sagen, du schaust ähnlich aus wie Beethoven, oder nicht? Kann schon sein, ja. Ach so, stimmt. Eins, das einmal in der Zeitung war, in der Presse, glaube ich. Genau, das, ja, genau. Ja, da habe ich halt auch, aber da sind sie nicht einmal so wild, aber da sind sie halt auch so halblang. Das Konzert gestern war im Konzerthaus und da steht ja so ein riesiger
Beethoven-Statue und ich habe mir jetzt tatsächlich momentan die Haarlänge, die Erde auf diesen Statuen. Aber ich meine, es ist nicht schwer, du brauchst einfach ein welliges oder gelocktes Haar und verwendest keinen Kamm und keine Bürste und dann schaust du aus. Ja, das ist nicht schwer, sagst du, aber ich scheitere schon an den Basics. Ich habe ja gesagt, du brauchst Haare. Ja, ja, eben.
Dann brauchst du erst mal diese Haare, dann ist es nicht schwer. Okay, danke für den Tipp. Gut, vielleicht noch zur Literatur, die ich jetzt hier verwendet habe. Also Christine Eichler, wie vorhin schon erwähnt, die hat geschrieben, der empfindsame Titan Ludwig von Beethoven im Spiegel, seine wichtigsten Werke. Martin Gagg, den ich auch schon einmal quasi zu Rate gezogen habe in meiner Folge über Bach, der hat auch ein Buch über Beethoven geschrieben, das war im Jahr 2003.
Dann gibt es von Oskar Sonneck so ein Buch, das schon sehr alt ist, aber da geht es darum, wie ihn seine Zeitgenossen gesehen haben. Hans-Joachim Hinrichsen hat geschrieben, Ludwig von Beethoven, Musik für eine neue Zeit. Das ist auch aus dem Jahr 2019. Und dann gibt es noch ein englischsprachiges von Jan Swofford. Das heißt Beethoven, Anguish and Triumph aus dem Jahr 2014. Was wir hier gehört haben bei den Soundbeispielen,
Das ist das tschechische nationale Symphonieorchester gewesen. Sehr gut. Und Hinweisgeber war Beethoven selber. Ja, ich selber. Also ich habe das eh auch schon einige Male, ich habe irgendwann mal angefangen, mich zu beschäftigen mit klassischer Musik, weil ich einfach gemerkt habe, ich weiß zu wenig drüber und mir, ich habe dann so das Gefühl, es gibt hier so einen Schatz an Dingen, was wir über unsere Welt aussagen und ich weiß nichts drüber und das nervt mich. Und dann habe ich angefangen,
diesen Kurs von Robert Greenberg durchzugehen, den ich glaube ich schon einmal überend habe. Der heißt How to Listen to and Appreciate Great Music. Und da geht er im Grund Konzertmusik von den Anfängern bis ins 20. Jahrhundert durch.
Und hat eben dort auch viel über Bach und über Beethoven geredet und da werde ich dann halt immer inspiriert, wenn ich dann auch so Anekdoten höre und dann, wenn ich darüber höre, was quasi wirklich so der Spiegel ist, denn diese Werke sind für diese Zeit und dann finde ich, da kann man immer gute Folgen darüber machen. Sehr gut.
Aber dann machen wir es vielleicht so, denn das Hinweisgeber ist dann einfach Jordi Saval. Jordi Saval, genau. Der war jetzt der Auslöser, dass ich jetzt diese Folge mache. Sehr gut. Weiß ich nicht, hast du der ganzen Geschichte noch was hinzuzufügen? Nein, ich würde sagen, wir gehen jetzt weiter zum Feedback-Hinweis-Blog. Ah, schade. Ich dachte, jetzt kommt noch ein kleines Stück Klarinette. Nein, ich habe die Klarinette tatsächlich noch nicht ausgepackt und eben das letzte Mal vor einem Jahr gespielt. Aber es wäre nicht schön. Sehr gut.
Gut, wer Feedback geben will zu dieser Folge oder zu anderen, kann das per E-Mail machen. Feedback at Geschichte.fm kann es auf den diversen Social Media Plattformen tun. Dort heißt es mal Geschichte.fm. Außer im Fediverse, da gibt man am besten Geschichte.social in einen Browser ein und landet dann direkt auf unserem Mastodon-Profil. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben und solche Dinge, kann das auf Apple Podcasts tun oder einfach überall, wo man Podcasts bewerten kann.
Und wer so ein bisschen Hintergrundinfos und Bilder zu Folgen sehen will und vielleicht die Folgen direkt an den Stellen kommentieren will, wo man kommentieren will, kann das bei Campfire machen. Also einfach auf joincampfire.fm gehen und sich dort anmelden und dann unserer Community beitreten.
Merch gibt es unter Geschichte.shop und es gibt zwei Möglichkeiten, diesen Podcast werbefrei zu hören. Bei Apple Podcasts gibt es den Kanal Geschichte Plus zu abonnieren und bei Steady kann man sich den Feed kaufen für 4 Euro im Monat. Da gibt es alle Infos unter Geschichte.fm.
Wir bedanken uns in dieser Woche bei Konstantin, Daniela, Ines, Michael, Jakob, Heiko, Ingrid, Björn, Tamara, Ferdinand, Julius, Melanie, Markus, Paul, Marc, Alexander, Floris, Martin, Roland, Sophie, Joelle, Helene,
Henning, Irene, Tobias, Harry, Nadja, Susanne, Nikolas und Christopher. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Und danke an Lene Kieberl fürs Schneiden dieser Folge. Tja, Richard, dann würde ich sagen, machen wir das, was wir immer machen. Genau, geben wir dem einen das letzte Wort, der es immer hat, nämlich Bruno Kreisky. Lernen wir ein bisschen Geschichte.
Lernt ein bisschen Geschichte, dann werdet ihr sehen, wie der Reporter sich damals entwickelt hat. Wie der sich damals entwickelt hat. Warte, kleines Moment. Gut. Also die Eroika wird zum Inbegriff dieses Beethoven'schens, dieses Beethoven'schens, dieses Beethoven'schen Helden, die Eroika wird zum Inbegriff des Beethoven'schen Heldenideals.