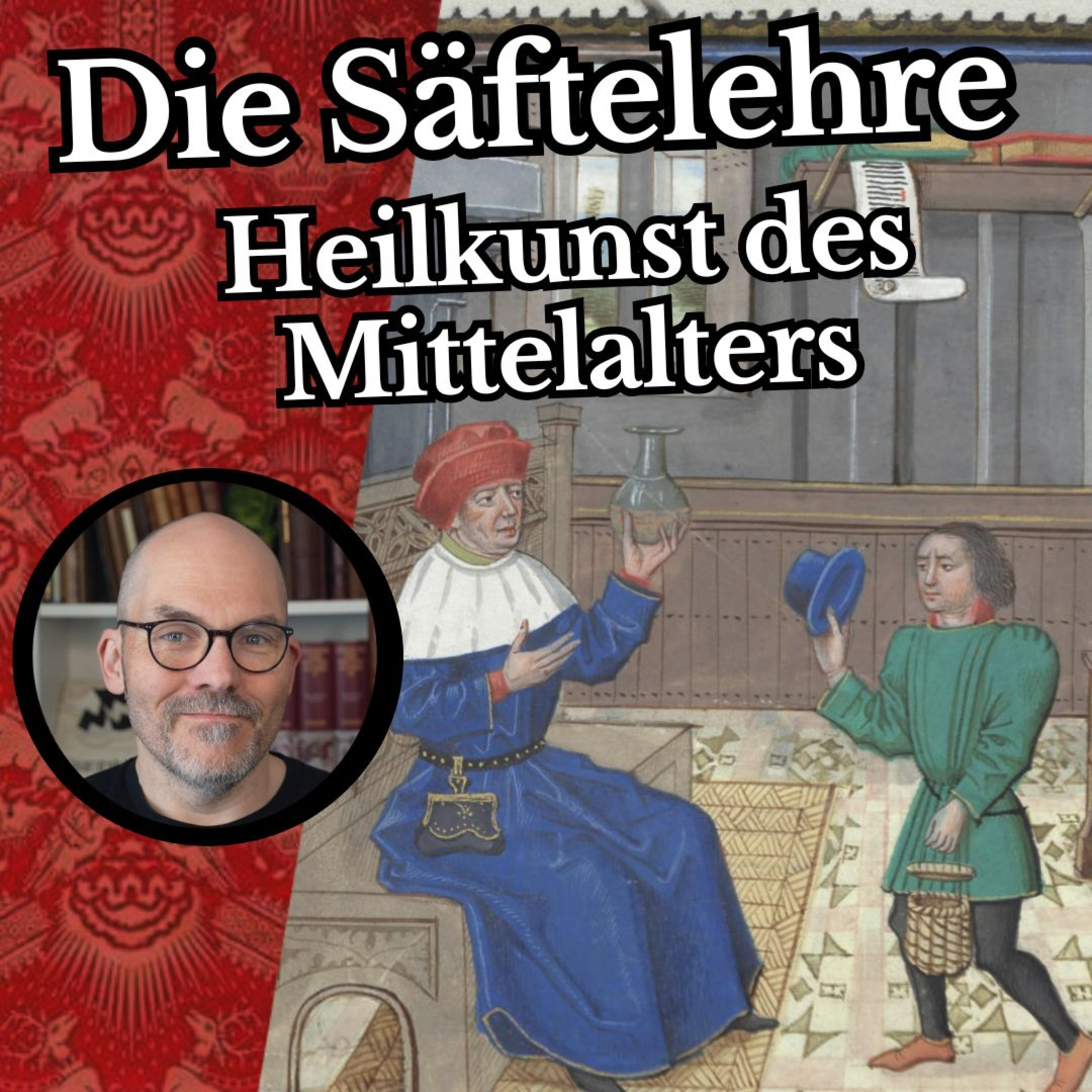
Die Säftelehre - Heilkunst des Mittelalters

Geschichtsfenster
Deep Dive
- Die Vier-Säfte-Lehre (Humoralpathologie) war die Grundlage der mittelalterlichen Gesundheitslehre.
- Sie stammt aus der Antike und wurde im Mittelalter weiterentwickelt.
- Die vier Säfte sind Blut, gelbe Galle, schwarze Galle und Schleim, die jeweils einem Element zugeordnet sind.
- Gleichgewicht der Säfte bedeutet Gesundheit (Eukrasie), Ungleichgewicht bedeutet Krankheit (Dyskrasie).
- Die Lehre umfasste Ernährung, Bewegung, Lebensführung und Prävention.
Shownotes Transcript
Herzlich willkommen bei Geschichtsfenster. Mein Name ist André und heute geht es um die Vier-Säfte-Lehre. Das ist so die grundlegende Theorie hinter der mittelalterlichen Gesundheitslehre. Heißt auch Moralpathologie oder Temperamentenlehre ist damit zumindest eng verwandt, überschneiden sich sehr stark. Und all das zusammen ist so eine Gedankenwelt zum Thema Gesundheit, Ernährung, ganz viele Dinge, die im gesamten Mittelalter verbreitet waren.
Und man denkt auch gerne mal so, im Mittelalter, die Medizin ist sehr primitiv und die haben natürlich viel falsch gemacht, das muss man sagen, aber wir reden von einer Gesellschaft, die Medizin versucht, ohne Ahnung zu haben von Mikrobiologie, von Erregern, das sind Ideen, die gibt es einfach noch gar nicht, also mussten sie ihre Beobachtung irgendwie anders begründen, die es ja nicht darauf kommt, dass da irgendwelche Mikroorganismen teilweise dran schuld sind, konnten sie auch nicht.
Im Rest der Welt auch nicht. Und da wird eben sehr gerne gesagt, die mittelalterliche Medizin sei rückständig. Im Antike wussten sie viel mehr, im Mittelalter haben sie alles vergessen. Ne, tatsächlich ist das, was sie im Mittelalter hatten, direkt aus dem Antike übernommen worden. Aber das werden wir gleich sehen. Heute geht es, wie gesagt, um die Versäftelehre. Jetzt ist er völlig verrückt geworden. Werbung für Turnschuhe. Warum? Ganz einfach, weil es gute Gründe dafür gibt.
Ihr wisst, ich mache viele historische Darstellungen. Da trage ich mittelalterliche Schuhe. Und diese Schuhe haben eine sehr flache Sohle. Das vermisse ich ganz oft im Alltag. Also ich trage natürlich auch Barfußschuhe, weil ich mich sehr daran gewöhnt habe. Und ich mag auch klassische Herrenmode. Die liebe ich immer sehr. Und so altmodische Sneaker, die trage ich ganz häufig. So diese weiße Sohle, ihr kennt das Ganze. Und aus den Gründen bin ich bei Gießwein gelandet. Die Schuhe habe ich jetzt ziemlich lange getragen. Ich bin damit gelaufen und gelaufen. Durch Regen.
Ihr könnt das sehen. Im Fitnessstudio habe ich sie benutzt, auch sehr sehr schön und danach bin ich weitergelaufen, weitergelaufen und gerannt. Ich versuche gerade Gewicht zu verlieren, klappt gut. Ich laufe 10.000 Schritte am Tag und da brauche ich einen bequemen Schuh.
Und alle Gründe sprechen dafür diese Schuhe, denn die Oberfläche ist aus Merino-Wolle. Ein Rohstoff, den hatten wir schon im Mittelalter. Ich sage mal, Wolle ist prima als Material. Erstaunlich wasserfest, also wenn sie feucht wird, es verteilt sich super, geht kaum durch. Super bequem. Ich habe noch selten so bequeme Schuhe gehabt, die schmeicheln dem Fuß einfach hinein.
Nebenbei natürlich antibakteriell, also auch mit Fußgeruch muss man da nicht viel Angst haben. Das sind alles sehr gute Gründe für diesen Schuh und tatsächlich, es passt zu dem, was ich mache. Denn ich rede immer davon, wie gut und atemsaktiv die Kleidung im Mittelalter war.
Das liegt an der Wolle, das ist genau das, ein Naturstoff, weniger Kunststoffe in diesen Schuhen, klar, die Sohle sind aus dem Kunstmaterial, aber der ganze Rest ist nachhaltig, ein nachwachsender Rohstoff in sehr guter Qualität von Kleinanbietern genommen, das Unternehmen Gießwein sitzt in Österreich, ist ein Familienunternehmen, alles Dinge, die ich persönlich sehr schätze, da sind wir noch nah am Handwerk, auch das sind Werte, die wir uns vom Mittelalter manchmal abschauen könnten.
Und von daher werde ich diesen Schuhen treu bleiben. Ich plane sogar das nächste Paar, denn die haben auch Barfußschuhe. Die Schuhe jetzt haben eine leicht erhobene Sohle. Die Barfußschuhe werde ich unbedingt nochmal ausprobieren. Die mag ich sehr, sehr gerne. Und von daher passt es auch perfekt zu diesem Thema. Es geht um Gesundheit. Diese Schuhe sind für mich gesund. Ich kann euch nur raten, schaut euch das Ganze mal an. Den Link findet ihr unten. Solche Unternehmen sollte man einfach unterstützen. Und daher, ja, ich bin nicht verrückt geworden. Es gibt einen Grund, warum dieser Artikel zu diesem Kanal passt.
Der Begriff Humoralpathologie, das Fachwort dafür, kommt von Humor. Humor, Feuchtigkeit, Körpersäfte. Und darum geht es. Das Ganze wird so um 400 v. Chr. zum ersten Mal im Corpus Hippocratium beschrieben. Das ist so eine Sammlung von etwa 60 Texten, die zum Teil von Hippokrates von Kos stammen, aber eben nicht alle. Da haben wir ein Bild aus der schelischen Weltchronik. Das ist eine mittelalterliche Idee, wie der Mann aussah. Das ist angeblich eine Büste von ihm. So sah er wohl eher aus.
Und der ist einer der Ersten, die eben diese Säftelehrer zusammenstellen. Es wird vermutet, dass sein Schüler und vermutlich auch Schwiegersohn Polyboss das Ganze zusammengestellt hat und mehrere Texte geschrieben hat. Und das ist im Mittelalter die
gängige Lehre im gesamten Mittelalter. Auch in der Antike, seit der Entstehung, also seit 400 vor Christus verbreitet, auch in der Späte Antike überall verbreitet. Und es ist wieder so ein typisches Beispiel für die Mittelalterrezeption, dass das im Mittelalter sehr oft angeführt wird, auch die negativen Seite, die falschen Ideen. In der Antike hört man eigentlich nur sehr diffus, die wussten ganz viel. Und
Was die wussten, das hört man sehr wenig. Also auch die ganzen Probleme, dass zum Beispiel auch in der Antike das Sezieren von Menschen oft verboten war, dass ganz viele Beschreibungen vom Inneren des Menschen falsch sind, weil sie nicht am Menschen beobachtet wurde, das wird dann immer gerne verschwiegen. Die grundlegende Idee dahinter ist, dass es vier Elemente gibt und diese vier Elemente auch im Körper vorkommen und zwar in Form von Säften. Da gibt es die gelbe Galle, Cholera.
Cholera klingt sehr ähnlich, aber ihr kennt es auch vom Choleriker. Vielleicht kommt daher auch der Irrtum, dass die Cholera im Mittelalter schon da war, weil den Begriff Cholera findet man in den Aufzeichnungen relativ häufig, weil es eben eine der vier Körpersäfte ist, eben die gelbe Galle und die entspricht dem Element Feuer. Die schwarze Galle, Melanchonia, die entspricht dem Element Erde. Blut, Sangios, entspricht der Luft und Schleim, das Phlegma, entspricht dem Wasser.
Gibt dann auch Theorien dazu. Blut wird in der Leber aus dem rohen Pneuma, also der Atemluft, gebildet. Die gelbe Galle stammt ebenfalls aus der Leber. Die schwarze Galle aus der Milz. Und der Schleim soll aus dem Gehirn kommen. Wozu das Gehirn wirklich da war, wussten die so noch nicht. Wie auch? Und diesen vier Elementen oder den vier Säften werden Qualitäten zugeordnet. Und zwar trocken, feucht, warm und kalt. Die gelbe Galle ist trocken und warm. Die schwarze Galle ist trocken und kalt.
Das Blut ist feucht und warm und Schleim ist feucht und kalt. Und diese Qualitäten, die man im Hinterkopf, die werden wir noch sehr häufig hören, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und die Idee ist jetzt, sind diese vier Säfte im Gleichgewicht, ist der Körper gesund, es herrscht Eukrasie im Körper, sind sie im Ungleichgewicht, wird der Körper krank, Dyskrasie.
Vor allem der antike Arzt Galen oder Galenos von Pergamon baut die Theorie dann aus, ordnet den vier Säften noch Farben, Geschmäcker, Organe, Jahreszeiten und Lebensalter zu. Vor allem verbindet er es mit der Temperamentenlehre. Habt ihr eben schon gehört, so Phlegma.
Cholera kennt man, Phlegmatiker, Choleriker kennen wir heute noch. Und damit sind wir eben bei der Temperamentlehre. Das ist auch ein ganz häufiger Begriff, ist nicht identisch mit der Säftelehre, hängt aber direkt zusammen. Und die gelbe Galle, eben der Choleriker, der soll reizbar und aufbrausend sein. Gehen wir aus dem Nürnberger Kodex Schürstab.
Die Schwarze Galle, der Melanchoniker, kennt man eher ruhig, schläfrig, nachdenklich, auch traurig. Das Blut steht für den Sanguiniker, der ist aktiv und heiter.
Und dann gibt es noch den Phlegmatiker, für den steht der Schleim. Der ist passiv und schwerfällig, aber eben, wie man hier sieht, auch eben der Kunst zugewandt. Also sie haben alle Vor- und Nachteile. Es ist nicht so, dass die irgendwie ein Temperament ganz negativ wäre. Denen werden alle Vor- und Nachteile zugeschrieben. Und bis auf den Sanguiniker, der ist heute selten, sind die Begriffe des Cholerikers, des Phlegmatikers und des Melancholikers bis heute noch verbreitet. Also das sind alles Begriffe, die man heute noch kennt.
Im 11. Jahrhundert wird das Ganze dann nochmal verfeinert und systematisiert durch einen persischen Arzt. Abidjana, der ist auch in Europa ganz, ganz bekannt, der schreibt seinen Kanon der Medizin. Eigentlich heißt es Abidjana Abu Ali al-Hussein ibn Abad ala ibn Sunnah und dieses ibn Sunnah wird dann zu Abidjana latinisiert.
Über ein bisschen Umweg, aber der gilt als einen der ganz großen Ärzte. Ist ein gutes Beispiel dafür, wie Fremdeswissen aufgenommen wird. Aber auch in Europa gibt es durchaus Entwicklungen. Der Medizin ist in Europa lange ein Standardwerk, auch an Universitäten. In der Renaissance wird er dann verdrängt, weil da herrscht tatsächlich so eine kleine Feindlichkeit gegen muslimische Ideen. Da nimmt man lieber wieder die griechischen Ideen von Galen. Sind nicht ganz so ausgefeilt, aber auf die geht man wieder zurück.
Aber in Europa passiert da sehr viel. Wir haben Klöster, in denen Medizin stattfindet. Wir haben Hospitäler in den Städten. Es gibt in Salerno eine Hochschule für Medizin. Es war ursprünglich das Hospital der Abtei in Monte Cassino. Wird eben zur Hochschule, eine der ersten nebenbei. Die Universität Montpellier ist ganz bekannt.
Es gibt Literatur zum Thema, sowohl Fachliteratur als auch volksstümliche Literatur. Es gibt so Kalender oder jadromathematische Hausbücher mit einem Kalenderteil, wo man dann auch rechnet, werden wir gleich noch dazu kommen, wie Astrologie da reingeht. Also eben hat man so ein Beispiel, dieser Kodex Schürstau aus Nürnberg von der Patricia-Familie ist genauso ein Gesundheitsbuch für den Hausgebrauch, quasi ein Gesundheitskalender. Und wie gesagt, da gibt es ganz, ganz viel Literatur, das ist echt verbreitet.
Und Abidjana sagt jetzt, der Arzt hat fünf Mittel zur Verfügung. Er hat die Ernährungstherapie, er hat also gute Luft zu verordnen, Bewegung, Ruhe und zuletzt Behandlungen wie Arzneien, ausleitende Maßnahmen und chirurgische Eintriffe. Das sind die Maßnahmen, die er hat, werden wir uns gleich alle mal angucken. Und diese Säftelehre ist ein ganzheitlicher Ansatz.
Also es gehört alles dazu, wie ich mein Leben lebe, wovon ich mir ernähre, Luft, Miasmen, also schlechte Luft soll schädlich sein. Das Ziel ist nicht zuerst den Kranken zu heilen, das ist natürlich ein Ziel, wenn er krank ist, aber das Hauptziel ist, der Mensch soll gesund bleiben. Und das kann natürlich auch eine Reaktion darauf sein, dass Beobachtung zeigt, Krankheit ist schlecht, weil Krankheiten verlaufen nicht so harmlos, es gibt keine Antibiotika.
Ich meine, wir haben heute auch schlimme Krankheiten, aber für den Menschen damals war halt eine Krankheit immer gefährlich und viele Krankheiten sind auch unheilbar, egal wie viel man reinmacht, mit den damaligen Mitteln geht nichts. Also die Idee, erstmal gesund zu bleiben, die ist eigentlich ziemlich gut. Und das war tatsächlich so der ganz, ganz große Sinn und dazu war es das Ziel, die Säfte im Gleichgewicht zu halten. Da sind ganz viele Maßnahmen drauf ausgelegt.
Und diese Säftelehre ist natürlich eine Analogielehre, so Ideen sind auch heute noch verbreitet. Also auch Homöopathie ist letztlich eine umgedrehte Analogielehre. Gleiches hilft gegen Gleiches oder hilft bei Gleichem. Hier eben diese Qualitäten heiß, trocken, feucht, kalt, das sind Dinge, die man einem Arzneimittel zuschreibt, einem Lebensmittel zuschreibt, auch allen anderen Handlungen zuschreibt und damit kann man eben auch auf die Säfte einwirken.
Und Ernährung spielt eine ganz wichtige Rolle. Die Ethik ist im Mittelalter wahnsinnig populär. Viele Leute auf dem Land zum Beispiel werden da nur von berührt worden sein. Berührt durchaus, aber jeder, der es sich leisten kann,
oder einen Arzt konsultiert, und zwar offenbar relativ verbreitet, der hält Diät. Und zwar seinem Temperament entsprechend. Der Arzt sagt, welches Temperament man hat, was ist gut für einen. Ist man zum Beispiel ein Choleriker, dann ist es sehr gut, wenn ich heiße und trockene Sachen zu mir nehme. Die unterstützen das Ganze. Aber ich kann auch mit Nahrungsmitteln zum Beispiel mein Temperament abmildern. Wenn ich zum Beispiel, wenn der, wenn der
festgestellt werden, dann kann man auch dagegen steuern. Das ist wirklich die ganz wichtige Grundidee. Hilft das Ganze nicht, dann werden Säfte auch gezielt gefördert oder sogar ausgeleitet. Dann sind wir bei den Eingriffen. Vor allem die Idee von verdorbenen Säften. Die Säfte können allesamt verdorben, zum Beispiel bei Blut. Schlechtes Blut. Da kennt man ganz berühmt aus Ausleiten den Adalas. Das ist so eine Idee dahinter.
Es gibt vor allem die Idee von Schlacke. Im Körper gibt es Dinge, die unerwünscht sind. Die gibt es bis heute. Ist heute auch nicht so richtig nachweisbar. Aber wer so Entschlackungskuren und sowas hat, das ist genau dieselbe Idee nach wie vor. Dadurch erklären sich auch Therapien, die wir immer wieder finden. Also zum Beispiel das Badehaus mit dem Schwitzbad hier zu sehen. Oder der Adalas.
Oder auch nicht zu vergessen, Einläufe, Plistier, auch eine ganz wichtige Methode, auch so Darmreinigung, auch das gibt es heute noch ganz, ganz viel. Das gehört alles in diese Ideenwelt hinein. Und nach Avicenna ist die Verdauung oder findet die Verdauung erst im Mund und im Magen statt, dann in der Leber, danach im Blut und in den Organen.
Die Reste werden als Kot und Urin ausgeschieden, allerdings nicht ganz, ein Rest bleibt im Körper und der wird durch die Poren oder als Eiter oder als Wachstum von Haar und Nägeln ausgeschieden.
Hier sieht man durchaus Beobachtung. Also da muss ja irgendwas sein, dass das passiert. Also man versucht sich auf die Welt und das, was man beobachtet, einen Reim zu machen. Aber die Idee ist tatsächlich, es bleiben Dinge zurück. Und zum Beispiel eine Darmspülung soll dagegen helfen. Die soll entschlacken. Wie gesagt, heute gar nichts anderes. Adalas unter Umständen. Und sollte so ein Saft verdorben sein, dann ist eben Ausleiten eine Möglichkeit. Auch Schwitzbäder sind ausleitende Maßnahmen und so weiter. Und dass wir hier die ganze Zeit von Schriften von Avicenna reden, der war ein Persicher Arzt.
Das zeigt, dass es auch im arabischen Raum verbreitet. Ist auch tatsächlich bis in die Neuzeit im arabischen Raum absolut üblich. Das haben wir im chinesischen Raum, also die altchinesischen Heilkünste, ich sag jetzt extra nicht traditionelle chinesische Medizin, das ist was anderes, ein Begriff, der im 20. Jahrhundert geprägt wird, umfasst auch ein bisschen was anderes, auch weil es natürlich Ähnlichkeiten gibt.
Ist ganz genauso, auch auf Elementen basierend, sie haben fünf Elemente, aber die Ähnlichkeiten sind sehr stark und auch Ayurveda in Indien ist letztlich gar nichts anderes. Auch im Detail alles unterschiedlich, aber die Grundidee dahinter, die ist überall gleich. Es sind überall dieselben Beobachtungen, die Leute haben sich überall denselben Reimen daraus gemacht, versuchen überall dieselben Ernährungsmittel und während Ayurveda und traditionelle chinesische Medizin, jetzt bewusst dieser Begriff, gerade super ausreicht,
beliebt sind im europäischen Raum. Ich glaube, Leute würden komisch gucken, wenn ich ihnen sage, befolge doch mal eine mittelalterliche Heilmethode. Probier das doch mal aus, das ist bestimmt gut für dich. Wahrscheinlich wäre es gar nicht mal schlecht, weil man darüber nachdenkt, was man so ist, aber wir würden trotzdem komisch gucken. Das Mittelalter hat da einfach nicht den Ruf zu. Und wenn wir so schon beim Thema Medizin sind, schauen wir uns die Diagnosemittel nochmal genauer an.
Kurz gesagt, Ärzte im Mittelalter diagnostizieren und verordnen. Die machen keine Eingriffe. Die Wundärzte kümmern sich um die Eingriffe.
Im kleineren Umfang auch die Bader und Barbierer, die sind für den Kleinkram zuständig, die Apotheker, die erstellen Arzneimittel im weitesten Sinne. Und die Trennung erfolgt durch den Klerikerstand. Also wir haben am Anfang Klostermedizin, wir haben Hospitäler bei den Klöstern, aber im Hochmittelalter kommt dann die Idee, dass Priester sowas nicht tun sollten. Priester sollten sich vom Blut fernhalten, damit sollten sie nichts zu tun haben, das sollen Nichtklerikale machen. Und dadurch haben wir eine Trennung, die bis ins 20. Jahrhundert anhält.
Also im englischen Sprachraum gibt es heute noch der Physician und der Surgeon, sind zwei unterschiedliche Dinge. Mittlerweile meistens an derselben Uni, historisch nicht, da war das oft getrennt. Und der Wundarzt ist der handwerklich Ausgebildete, der Arzt ist der Studierte, der ist Kleriker, der hat zumindest den niederen Bein, ist oft auch Kleriker. Die arbeiten auch zusammen, aber der Arzt macht keine Eingriffe, der Arzt diagnostiziert.
Das Äußere des Patienten, das Ertastbare des Patienten, das sind Sachen, die kann er wunderbar nutzen. Oberflächliche Körpertemperatur, Fieberthermometer hat er nicht, aber natürlich wird sowas auch geschaut. Der Puls ist ganz wichtig und die Beobachtung von Haaren und Stuhlgern. Und bei der Haarenschau, bei der Uroskopie sind wir bei dem Wichtigsten, was der mittelalterliche Arzt so macht. Das ist so das Bild für ihn.
Hier haben wir aus dem Totentanz, der Tod holt alle Stände und hier holt er eben den Arzt und der wird mit einem Urinschauglas dargestellt, dazu auch im langen Gewand, so einer Schaube als Standessymbol, Brille auf der Nase, perfekt. Und die Idee hinter der Uroskopie ist, Farbe und Konsistenz des Haarens sollen auf die Säfte zurückzuführen sein. Das Urinklas ist wie gesagt das Symbol für die Ärzte und zähflüssiger Haar steht für feucht.
Dünnflüssiger Hahn für trocken, Rötlich für warm und weißlicher Hahn für kalt.
So kann man es wieder auf die Säftelehre bringen und es gibt da durchaus Diagnosetafeln, hier ist so eine, 20 und mehr verschiedene Farben sind da zu finden, auch sehr unappetitliche Farben, weil man immer vergleichsweise irgendwas nicht in Ordnung ist, auch Schwebeteile, Bodensatz als Kriterien werden beobachtet und einige Punkte sind sogar durchaus mit modernen Erkenntnissen kompatibel.
Es gibt zum Beispiel ein Zitat, wenn auf dem Urin Fett wie ein Spinnengewebe schwimmt, bedeutet das, dass der Mensch Schwindsucht hat. Und das ist wohl tatsächlich so. Ich kann es nicht nachprüfen, ich bin kein Arzt.
Aber das soll tatsächlich richtig sein. Bekannt ist auch, was viele Leute so als Anekdote erzählen, süßlicher Hahn auf Diabetes mellicus, was honigsüßer Durchfluss bedeutet, hinweisen soll. Stimmt, ist aber so erst im 17. Jahrhundert entdeckt worden. Und Diabetes Typ 1 ist ohne Behandlung echt schwer zu überstehen. Die sind meistens tot. Also da kommt ein Arzt gar nicht dazu groß. Also das stimmt mit dem süßen Geschmack, aber im Mittelalter nicht nachweisbar.
Wobei Geschmack und Geruch auf jeden Fall, Geschmack weiß ich nicht, gehört selbstverständlich auch dazu. Die Durchführung sieht dann so aus, man soll ein Morgenurin nehmen beim ersten Harnschrei. Das Ganze wird in der Matula gesammelt, das ist diese Flasche eben. Und hier sieht man ein ganz wundervolles Bild, denn hier kommt der Patient zum Arzt, hat einen Korb in der Hand, das ist tatsächlich ein Korb für diese Flasche, der ist mehrfach nachweisbar und der Arzt schaut sich jetzt den Urin an.
Und der Arzt begutachtet das Ganze zweimal, nämlich einmal direkt und einmal nach zwei Stunden. Das Ganze soll stehen, Schwebeteiligungen sollen sich absetzen und so weiter. Und selbst die Schichten werden dann noch Körperteilen zugeordnet. Der obere Rand, der sogenannte Zirkel, soll zu Kopf und Hirn passen, dann kommt die Brust, dann der Magen, Leber, Milz und der Bodensatz wird dann zu den Nieren, Harnblase, Gebärmutter und den Geschlechtsorganen zugeordnet.
Das ist allgemein üblich, das ist eine der wichtigsten Diagnosearten des mittelalterlichen Arztes, aber auch im Mittelalter gibt es daran durchaus Kritik, äh,
Vor allen Dingen an übersteigerter Deutung. Es wird dann nicht von Urologie, sondern Uromantie gesprochen, also quasi Vorhersagen aus dem Urin oder hier eben der Affe an einem Chorgestühl, der sich offenbar selbst diagnostizieren will. Solche Persiflagen gibt es damals schon. Das kann man durchaus sehen, dass Leute schon damals auch überreagiert haben. Und als nächsten Punkt gibt es dann die Pulsdiagnose. Die ist auch wichtig, gibt es auch schon seit der Antike.
Finden man immer wieder. Im Mittelalter ist da entscheidend das Arzneibuch von Orthol von Bayerland, auch Orthol von Würzburg genannt. Das erscheint so um 1280 und da finden wir oft bildhafte Namen. Es wird von wallenem Puls gesprochen, sägenförmiger, also sägenförmiger, gazellenartiger oder ameisenartiger Puls. Im Großen und Ganzen kann man sagen, ein schneller Puls ist hitzig, ein langsamer Puls ist kalt, ein starker Puls ist feucht und ein schwacher Puls ist trocken.
Religion spielt natürlich auch ein Thema, auch wenn die Vier-Säfte-Lehre nicht wirklich einen Ansatzpunkt zur Religion hat, aber natürlich ist das Ganze untrennbar, allein schon weil ein Großteil der Medizin in Klöstern stattgefunden hat, das sind die medizinischen Zentren des frühen Hochmittelalters, die Hochschulen sind auch immer kirchlich getragen, die gesamte Pflanzenarznei, die wir in Klostergärten finden, basiert auf der Säftelehre, kommen wir gleich nochmal dazu.
Und natürlich wird das Ganze immer ergänzt durch Gebete, Hoffnung auf göttliche Hilfe. Gebete am Krankenbett sind völlig unverzichtbar. Und auch Ärzte als Heilige. Der Apostel Lukas wird als Arzt verehrt. Die Zwillinge Kosmas und Damian. Hier zu sehen sind quasi die Schutzpatronen der Ärzte und auch Sinnbild. Hier einer eben wieder mit dem Urinklass, der andere mit der Salbendose. Kann man auch sagen, der eine ist ein Arzt, der andere ist Apotheker. Das sind eher so volkstümliche Sachen, die dazugekommen sind. Auch Pilgerfahrten und Votivgaben sind ganz wichtig.
Hier haben wir den heiligen Rochus, der eben aus Montpellier kommt, Hochschule habe ich vorhin schon genannt, während der Pest selbstlos heilt, eben als Pilger dargestellt wird, aus seinem Pestmal verweist und das passt eben perfekt dazu, wenn ich eine Krankheit habe und mich bewegen kann, dann ist eine Pilgerfahrt immer angesagt, das soll immer helfen.
Und natürlich sind auch magische Handlungen immer beliebt und üblich. Auch so magische Tränke. Es gibt zum Beispiel im Wolfsberg Hausbuch Rezepte für, da ist die Säfteleere perfekt, weil wenn ich da die entsprechenden Qualitäten reinmische, dann muss das ja funktionieren. Und damit sind wir auch bei der Therapie dahinter. Wenn therapiert wird, dann ist tatsächlich die Ernährung wahnsinnig wichtig. Die Diät gilt als allerwichtigstes Werkzeug. Der Arzt ist immer auch Ernährungstherapeutin.
Alle Lebensmittel, ohne Ausnahme, werden den Temperamenten zugeordnet. Und ein wunderschönes Beispiel dafür ist das Tacuinum Sanitatis. Das ist eine Ausgabe aus dem 14. Jahrhundert aus Italien. Und da sieht man eben den Verfasser Ibn Butlan. Hier übersetzt als El-Bukhasim de Baldach. Baldach ist in dem Fall Bagdad. Und das ist ein irakischer Christ, der später auch Mönch wird. Der schreibt diese Tafeln. Im Original sind es tatsächlich so...
Merktafeln, die auch schachbrettartig aussehen in der Kalligrafie, deswegen werden sie auch Schachbretttafeln der Gesundheit genannt. Und die werden sehr früh übersetzt, sind dann eben als Tacunium Sanitatis bekannt und in der Einleitung sagt Ibn Butlan schon, es gibt sechs Dinge, die die Gesundheit eines Menschen beeinflussen. Die Luft, die uns umgibt, das, was wir essen und trinken, unsere Bewegung, das Maß, also Übermaß und Mangel an Schlaf,
Ausgewogenheit und Ungleichgewicht der Säfte. Und Emotionen wie Freude, Furcht und Angst. Das sind die Teile, die wichtig sind für den Menschen. Es gibt auch ideale Nahrungsmittel. Warm und feucht gilt immer als gut. Dem Luft-Element zugeordnet. Denn das Gegenstück, die schwarze Galle als Erde, die ist für viele Krankheiten ursächlich. Wird dafür verantwortlich gemacht. Und wenn man überlegt, Fieber und Schwitzen ist ein Beobachter, den man machen kann.
Und nicht nur die Lebensmittel haben Eigenschaften, Qualitäten, die werden wir uns gleich anschauen, auch die Zubereitungsarten können darauf Einfluss nehmen und können auch Qualitäten sogar verändern oder ausgleichen. Fisch zum Beispiel ist natürlich feucht und kalt, wenn er gebraten, gebacken oder sogar frittiert wird, dann kann er durch das Feuer gemäßigt werden, er wird neutralisiert.
Auch Durchmischung soll sehr vorteilhaft sein. Je durchmichtiger die Speisen, umso besser. Deswegen haben wir so oft gehackte Zutaten, Füllungen, Pasteten mit einer gehackten Füllung. Perfekt, weil ich alles schön klein mache. Großes Steak oder irgendwie Schweinshaxe am Stück ist in der mittelalterlichen Küche gar nicht üblich. Rindfleisch, so was, ein tolles Beispiel, ist trocken und heiß. Brate ich es, mache ich das noch stärker. Kann ich mir leisten, wenn ich ein entsprechendes Temperament habe. Bin ich eh schon Choleriker?
Lieber gekochtes Rindfleisch, damit kann ich das Ganze neutralisieren oder mit dem Salatverzehr. Wir werden gleich auch noch Beispiele haben, dass es auch Tipps gibt, wie ich das Ganze sonst verbessere. Und deswegen haben diese Bücher zu dem Thema, werde ich ein paar zeigen, immer die Angaben der Qualitäten, also heiß, kalt, trocken, feucht, aber auch den Nutzen, den Schaden und die Gegenmaßnahmen. Und da habe ich zwei Beispiele aus einer Ausgabe des Tarkunien Sanitatus aus dem 15. Jahrhundert. Einmal habe ich hier Zucker.
Und da steht, Zucker ist warm im ersten und feucht im anderen, also im zweiten Grad. Hier haben wir noch Grad. Ein erster, vierter Grad gibt es auch noch. Also Sachen sind auch unterschiedlich stark in den Qualitäten. Der weiße, lautere Zucker, also gelauter, gereinigter Zucker ist der beste.
Nutzen, er reinigt den Leib, nutzt der Brust, den Nieren und der Blase. Schaden, er bringt den Durst und bewegt die Gallen. Durst, wie dann beobachten, kann jeder zustimmen. Gegenmaßnahme, korrigiere ihn mit sauren Granatäpfeln. Granatäpfel, wieder was für die Wohlhabenden oder ähnlich saure Dinge, das kann das Ganze ausgleichen. Macht, nicht böse Geblut, gut für alle Menschen zu jeder Zeit in allen Landen.
Schweinefleisch dagegen ist kalt im ersten und feucht am Ende des anderen Grades, andere sagen sogar im dritten Grad. Optimum von verschnittenen, also kastrierten und arbeitsamem Schweinen. Wenn man sowas gegessen hat, also wirklich Schweineschweine, Schweine, die sich wirklich viel bewegt haben, der weiß, wovon die reden. Das haben wir heute im normalen Metzgerei kaum noch, aber macht einen Unterschied, wirklich.
Schweinefleisch isst gut den warmen, trockenen, also den Cholerikern und mageren Leuten, denn es nährt sehr wohl. Schade dem phlegmatischen Magen und denen, die mäßig leben. Also wer mäßig lebt, wer Diät hält, Schweinefleisch. Korrigiere es mit Gewürz. Gewürze kommen wir gleich nochmal dazu. Macht viel leichtes Geblüt. Fügt, also passt zu, den warmen Jüngeren im Herbst und in warmen Landen.
So ein Beispiel haben wir bei jedem einzelnen Lebensmittel in diesem Takumini Sanitator oder auch in anderen Büchern, gibt es auch ganze Tabellen. Ich hatte mal eine sehr schöne Übersicht, so ein Koordinatensystem habe ich leider nicht mehr gefunden, ich habe keine Ahnung, wo ich es damals hatte, war sehr, sehr schön. Und diese Schachttafeln der Gesundheit, also letztlich das selbe Buch, nur anders übersetzt, haben wir hier nochmal in der ersten Druckausgabe von 1533 und da sehen wir auch wieder, wo du es am besten findest, sein Hülf, sein Schad,
wie man Schaden abwendet. Und da haben wir zum Beispiel Fisolen. Jeder Österreicher weiß jetzt, wovon gesprochen wird. Ist allerdings nicht die heutige Gartenbohnen. Die kommt aus Amerika. Ist eher die Augen- oder die Kuhbohne. Die wurde auch schon als Fisole bezeichnet. Und da steht, sie macht Unwillen und böse Träume. Und als Gegenmaßnahme soll man sie in Salzwasser kochen mit Senf servieren. Ganz üblich. Und ich gehe jetzt mal die Kategorien durch. Es gibt im Prinzip diese vier Temperamente. Also heiß und trocken.
wären zum Beispiel Trauben oder Oliven, Maronen beispielsweise hier als Bild, sind auch heiß und trocken, Mandeln, die gelten auch als neutral, da komme ich gleich am Ende nochmal dazu, Weißkohl gehört dazu, dann haben wir Lauch, Knoblauch, Basilikum und eigentlich fast alle Kräuter sind heiß und trocken, auch Gewürze fast alle heiß und trocken, Weizen und die Produkte daraus gelten auch als heiß und trocken.
Außerdem Gerste, Weizenbrei. Gerstenbrei dagegen ist kalt und trocken. Also da sind wir was, wo sich das verändern kann. Hähnchenfleisch, Rindfleisch, gepökelter Fisch, Wein, Zucker und der Sommer allgemein. Also Sommer ist dem Ganzen als Jahreszeit zugeordnet. Kalt und trocken sind zum Beispiel Reis. Hier sieht man einen Reishändler. Saure Äpfel, Roggen und Hirse, dicke Bohnen, gereifter Käse ist kalt und trocken.
kalt und trocken und außerdem der Herbst generell. Heiß und feucht hätten wir Zwiebeln, Walnüsse, Spargel, Augen oder Kuhbohne, also die Fisolen, Klöße,
heiß und feucht, Butter, Fasan, der Frühling allgemein. Und kalt und feucht sind zum Beispiel Äpfel. Äpfel sind nur feucht, nicht kalt, aber nur feucht. Pflaumen, Pfirsiche, Birnen, Süßkirschen, Wassermelonen, Gurken, saure Milch, junger Käse, im Gegensatz zum alten Käse, Schweinefleisch, frischer Fisch, Winter. Den frischen Fisch, da habt ihr doch drauf gewartet, gibt's doch zu. Gewürze, wie gesagt, fast alle heiß und trocken.
Brot gilt vor allem als heiß, weniger als trocken. Eier, das Eigelb ist heiß und feucht, das Eiklar ist kalt und feucht, der wird getrennt. Und kastrierte Tiere zum Beispiel gelten allgemein als kälter als unkastriert. Also ein Ochse ist weniger heiß und trocken als ein Jungbulle.
Diese Ernährungslehre war unter Gebildeten in höfischer Küche völlig verbreitet. Es ist in Grundlage der Rezepte der Zeit, man hat darauf geachtet, nicht nur das Temperament des Herrn zu bedienen, sondern auch Gäste. Man hat versucht, alle Temperamente möglichst gemischt auf die Tafel zu bringen, damit jeder das essen kann, was gut für ihn ist. Es gibt aber auch neutrale Speisen, wobei die Idee, dass es neutrale Lebensmittel gibt, scheint sich nicht so zu bestätigen.
Es gibt zum Beispiel Blanc Manger, auch als Mandelsülze im Deutschen bekannt. Das ist eine ganze Bandbreite von Gerichten, ihnen ist aber allen gleich, es ist weiß. Alle Zutaten sind weiß und er gilt auch durch die Durchmischung, weil er eben sehr fein ist und diese Zutat als nahezu ideale Nahrung.
Eben auch als halbwegs neutral, tut niemandem so richtig weh. Und den gibt es in einer großen Bandbreite von süß bis pikant, von schnittfest bis fast suppenartig. Das hier ist eher ein süßer Klattervertreter, könnte man als Mandelpudding bezeichnen. Nicht im Pudding im eigentlichen Sinne, ist was anderes. Eigentlich, was wir als Pudding bezeichnen, ist ein Flammerie, aber das ist genau das. So wie wir von Karamellpudding reden, ist das eben Mandelpudding.
Und die Zutaten, die hatten wir eben zum Teil schon mal aufgenannt. Süße Milch gilt als wichtige Zutat dafür. Mandeln oder auch Mandelmilch. Vorsicht, Leute, aufregen. Mandelmilch im Mittelalter ist ein großes Ding. Gab's mal ein großes Aufregen über ein Instagram-Short, in dem jemand darüber gesprochen hat. Haben sich alle Leute aufgeregt. Das ist ja modernes Zeug. Nein, Mandelmilch ist mittelalterlich. Hühnerbrust.
Zucker, auch wenn er selbst eben nicht neutral ist, wird er oft als Mittel genannt, andere Speisen abzuschwächen oder die schlechten Eigenschaften zu verbessern. Reis gehört dazu und als Geliermittel wird oft von Hausenblase, das ist ein störartiger Fisch, dessen Schwimmblasen sind quasi Gelatine oder Rinderfüße, also kann man auch Gelatine machen, das sind so die Teile, die reingemacht werden. Und das zum Beispiel im Mahl, das man gerne einem Gast serviert, weil man keine Ahnung hat, welches Temperament er hat, also ganz, ganz verbreitet und...
Ja, die Küche des Mittelalters ist sehr, sehr stark verbunden mit der Idee von der Säftelehre. Die Leute, die ein bisschen Ahnung haben, wissen das. Und dieses Wissen tröpfelt auch tatsächlich weiter. Also auch wenn der normale Bauherr uns natürlich weniger Gedanken macht. So die Grundidee, was passt zusammen, was ist gut, welche Rezepte sollen gut sein, weil sie die negativen Eigenschaften abmildern. Das verbreitet sich natürlich mit der Zeit. Und auch die normale, selbst die bäuerliche Küche ist zumindest beeinflusst von diesen Ideen. Natürlich auch, wenn man oben abguckt, was die so essen. Ganz klar, wenn man rankommt.
Ein weiteres sehr wichtiges Therapiemittel ist natürlich auch die Badekultur. Die wird auch gerne unterschätzt, da wird auch immer gerne das Badehaus als reines Bordell abgetan. Aber wenn wir uns tatsächlich umgucken, wir haben vor allem Schwitzbäder, das ist so das Wichtigste. Wir haben aber auch Wannenbäder. Hier haben wir wieder aus dem Codex Schürstab ein privates Wannen, wahrscheinlich auch Schwitzbad mit diesem Baldachin darüber.
Das Ganze geht sogar so weit, es gibt Badereisen. Heilkräftige Bäder, da soll man hinreisen und quasi eine richtige Kur machen. Da gibt es auch Abbildungen dazu. Aber in den Badehäusern gibt es eben auch sowas wie hier, die Leibkneterei. Auch das soll natürlich helfen. Da weiß ich relativ wenig darüber, aber auch da, es ist ein Handwerk, das über Jahrhunderte ausgeübt wird. Die Bader haben ihr Wissen und wahrscheinlich gibt es da ganz ähnliche Traditionen, wie wir sie heute in anderen Kulturen kennen. Sie haben sie nur nicht so gut erhalten. Ein ganz wichtiger therapeutischer Ansatz ist dann der Adalas.
Hier schön zu sehen, man sieht sogar dieses typische Messer und heute hat der Adalas natürlich einen furchtbaren Ruf. Zum einen, weil wir wissen, bei den allermeisten Dingen hilft er nicht wirklich, er kann sogar den Patienten schwächen. Da gibt es auch jede Menge Horror-Stories. Es gibt heutzutage noch ein paar ganz wenige Erkrankungen, bei denen der Adalas noch eingesetzt wird.
Tatsächlich ist es noch nicht in der Alternativmedizin, in der richtigen Medizin ist das auch noch zu finden, aber eben sehr, sehr, sehr selten. Wir müssen natürlich darüber reden, weil es so ein typisches Sinnbild ist. Er ist nicht das angebliche Heilmittel. Er wird auch nicht so gesehen, aber es ist ein wichtiger Teil der Gesundheitslehre. Wir haben da zwei Verfahren.
Einmal die Derivation, die Ableitung, das Ausleiten verdorbenen Blutes aus dem Körper. Das wird nah an der erkrankten Stelle gemacht und es wird auch vergleichsweise viel Blut abgenommen. Das andere ist die Revolution, die Umsetzung.
Schon im Mittelalter aus Sorge, dass man bei der Derivation zu viel Blut abnimmt, kommt die Idee, dass man durch Umwälzung etwas machen kann. Also wenn schlechtes Blut da ist, dann geht man einen Punkt weit von der Erkrankungsstelle weg, lässt dort weniger Blut ab und dadurch soll das Blut im Körper in Bewegung kommen und das schlechte Blut soll durch besseres Blut ersetzt werden. So die Idee.
Durchwogen mit dem Adalasmesser haben wir eben schon gesehen, dieses kleine hakenförmige Messer. Schröpfköpfe sind üblich, also Schröpfköpfe sind in Badehäusern zum Beispiel beliebt, da gibt es trockenes oder blutiges Schröpfen, aber auch Blutigel werden schon genommen. Und der Arzt
Aschi Matthäus aus Salerno, dieser berühmten Hochschule um 1165, sagt, dass man vor dem Adalas berücksichtigen soll das Alter des Patienten, seinen Zustand, also seine Kräfte, die Fortdauer der Erkrankung, die Jahreszeit und natürlich die Sternzeichen. Und da gibt es immer wieder solche Adalas-Menschen, da sieht man eben die Sternzeichen am Körper und die bedeuten, in welchem Sternzeichen oder welchem Monat nicht zur Adala gelassen werden soll. Also da soll man es möglich vermeiden.
Hier haben wir das Ganze nochmal deutlich ausführlicher, da steht auch, ob es böse ist, ob es mittel, ob es gut ist, da sind wir auf verschiedenen Arten, also verschiedene Arten des Adalases werden gezeigt, das ist so ein Druck aus Straßburg, also diese Adalasmenschen, Adalaskalender, die sind relativ verbreitet, die waren sehr beliebt und auch der normale Mensch wollte eben wissen, ist das zu dem Zeitpunkt gut oder nicht. Es gibt sogar Beispiele von Selbsttherapie mit Adalas, nicht nachmachen, liebe Kinder, sowas tun wir nicht.
Aber auch die negativen Folgen waren schon bekannt. Es gibt zum Beispiel aus der Geschichtensammlung der sieben Weisen Meister dieses Bild. Da wird eine Frau zur Ader gelassen, allerdings quasi als Bestrafung. Die hat sich gegen ihren Mann aufgelindert und immer wieder versucht zu reizen. Er ist ruhig geblieben. Am Ende holt er den Wundarzt und ihr seht da schon, da stehen schon fünf Schalen auf dem Tisch. Und er sagt dann, es bringt sie fast um. Er sagt dann, jetzt weißt du, wie je zornig ich sein kann und soll das nicht mehr machen. Aber es zeigt eben, beide sehr versteht, ganz klare Leute wissen, zu viel Ader, das ist nicht gut. Es bringt die Frau fast um.
Als Vorteil des Adalas gegenüber Arzneimitteln wurde sogar gesagt, dass man ihn jederzeit abbrechen kann. Während ein eingenommenes Arzneimittel, da muss man gucken, was passiert, hoffen, dass alles gut geht quasi, ein Adalas kann ich sofort abbrechen. Das wird gesagt, ist ein großer Vorteil des Ganzen. Und allein schon durch die Säftelehre, wenn eben der Ausgleich wichtig ist,
Dann nehme ich nicht Ballenblut ab. Wenn jemand zu wenig Blut hat oder zu viel schwarze Galle, dann ist das nicht der richtige Ansatz. Es kann durch dieses Ausleiten die Idee von verdorbenen Säften noch sein, aber man sieht schon, es gehört zu einer Therapieidee. Ob die funktioniert oder nicht, ist egal. Es wagt nichts, dass man einfach so macht, weil man Lust drauf hat.
Es gibt auch Dinge, da wurden die Ärzte verzweifelt. Gerade wenn wir von Schießpulver reden, auch die Pest. Da wurde auch Adalas gemacht und versucht irgendwie zu helfen. Aber im Großen und Ganzen diese Idee, dass da irgendwie fünf Ärzte über den Kranken herfallen, alle zu Adalas und bis er tot ist, das sind vor allem Geschichten, die haben wir in der Neuzeit. Auch als satirische Geschichten haben wir die. Aber gab es bestimmt. Man kann aber nicht sagen, dass der Adalas einfach so ein unsinniges Ding war, das die jederzeit gemacht haben. Wie gesagt, aus heutiger Sicht, wir wissen mehr. Aber die Idee dahinter, die ist wieder nicht ganz falsch.
Und natürlich, wenn wir schon bei nicht-wissenschaftlichen Ansätzen sind, die Idee der Temperamentenlehre korreliert natürlich auch hervorragend mit der Astrologie. Auch das kann man zuordnen, wurde auch gemacht. Der Gelben Galle, also dem Feuer, werden Widder, Löwe und Schütze zugeordnet. Der Schwarzen Galle, also der Erde, der Stier, die Jungfrau, der Steinbock. Dem Blut, also der Luft, die Zwillinge, die Waage und der Wassermann. Und dem Schleim, also dem Wasser, der Krebs, den Skorpion und die Fische.
Man kann es auch umgekehrt machen, denn es gibt noch die Idee der Planetenherrscher. Dann entspricht Mars der gelben Galle, Saturn der schwarzen Galle, Jupiter dem Blut und der Mond dem Schleim.
Und wer jetzt sagt, was ist denn das, warum sind hier auf einmal antike Götter und drei davon und dann der Mond? Das sind eben die sieben Planetenherrscher, eine sehr populäre Idee im Mittelalter, also wirklich quasi die antiken Götter nochmal da, aber es sind halt auch die Planeten, die die Astronomie oder Astrologie zu der Zeit sehen konnten. Da haben wir tatsächlich Saturn, Jupiter, Mars, Venus, Merkur, Sonne und Mond. Das sind die sieben Planetenherrscher und...
Denen werden auch die Qualitäten, nicht direkt die Säfte, aber die Qualitäten zugeordnet, auch nicht gleichmäßig verteilt. Und ganz berühmt sind da eben die Bilder aus dem Wolf-Egger-Hausbuch. Hier haben wir Saturn. Der soll trocken und kalt sein. Ihm werden hier oben, sieht man direkt unter dem Reiter, Wassermann und Steinbock zugeordnet. Und darunter sieht man eben, Saturn ist kein Netter. Da sieht man den Bauern, der mit der Erde arbeitet. Da sieht man den Verbrecher im Stock-
Man sieht eine Richtstätte im Hintergrund. Das sind alles Dinge, die zum Saturn gehören. Positiver ist da der Jupiter. Der gilt als warm und feucht. Ihm sind die Fische und der Schütze zugeordnet. Und man sieht hier Gelehrsamkeit. Man sieht einen Wettbewerb von Armbrustschützen. Man sieht ein Ausreitungspaar auf der Jagd. Ein Jäger im Hintergrund. Man sieht eine Beratung. Also schon deutlich, deutlich positiver. Da passt es eben auch gut zusammen. Diese ganzen...
Jetzt nicht wirklich die Temperamente, aber zumindest so Charaktertypen und Tätigkeiten werden jetzt diesen Planetenherrschern zugeordnet, was natürlich ja mit der Astrologie wunderbar funktioniert, weil genau diese Planeten sind ja zu beobachten und wenn ihr zum Beispiel ein Sternzeichen seht, dann gibt es eben auch als Tagesherrscher, als Nachtherrscher, ich habe es jetzt als Planetenherrscher bezeichnet, weil das etwas komplizierter wird.
Mars haben wir hier, der gilt als heiß und trocken, Wider- und Skorpionsinn zugeordnet, hier sieht man eine Fede, man sieht einen Überfall auf ein Dorf, einen Raubmord an einem Pilger unten, einen Diebstahl, das sind alles Dinge, die dem Mars zugeordnet werden, heiß, trocken, Choleriker passt perfekt dazu.
Die Sonne, genau wie der Mond, hat nur ein Sternzeichen zugeordnet. In dem Fall nämlich den Löwen gilt als warm und trocken. Hier sieht man Musiker, man sieht eben Wettbewerb, so körperliche Ringen, Stockkampf, Steine werfen. Das gehört alles dazu. Die Dame Venus gilt als feucht und kalt. Hier sind Stier und Waage zugeordnet. Man sieht hier eine Badehausszene, man sieht Tanz, man sieht Musik.
Alles, was man bei Venus auch erwarten würde. Merkur ist ein wundervolles Bild. Merkur ist wechselnd warm oder kalt. Ihm sind Zwillinge und Jungfrauen zugeordnet und ganz viele Künste, Kunsthandwerke gelten ihm zugeordnet. Hier ist immer ein Silberschmied, ein Uhrmacher, ein Lehrer, der gerade einem Schüler den Hintern versohlt, ein Orgelbauer, ein Maler. Das sind alles Dinge, die passen. Und als letztes kommt die Dame Luna, der Mond. Ihr ist der Krebs zugeordnet. Sie ist kalt und feucht.
Und man sieht hier ein Bad, passt auch sehr schön, eine Mühle. Im Vordergrund sieht man eben einen, ich würde sagen, Taschenspieler in die Richtung. Aber auch Vogeljagd im Hintergrund mit Leimruten wird ihm zugeordnet.
Und da sieht man wirklich, dass diese Säftelehre, diese Temperamentlehre einen in seinem Leben in allem beeinflusst. Die kann man da sehr schön absehen. Aber auch alle anderen Bereiche sind davon berührt. Im Tacundum Sanitatis finden wir dann wieder Hinweise, was den Säften zugeordnet werden kann. Wohnräume zum Beispiel, eigene Wohnräume für Sommer und für Winter. Und aus Städten wissen wir, das gab es tatsächlich. Es gibt eine Beschreibung von Sommerräumen, die eine Wand durch ein Gitter ersetzt haben, um eine Art Lodger zu haben.
Aber auch Tätigkeiten wie hier die Jagd werden ihm zugeordnet. Reiten, kämpfen, schlafen, Geschichten erzählen. Hier steht zwar das Gespräch, aber der Konfabulator ist der Geschichtenerzähler. Leute, die sich im Winter zusammensetzen, Geschichten erzählen, das soll darauf Einfluss haben. Sechs, natürlich spazieren gehen, singen, tanzen, wie hier auf dem Bild. Das sind alles Dinge, die das Wohlbefinden beeinflussen. Selbst die Winde werden genannt. Hier ist der Wind von Mitternacht, also der Nordwind.
Hier haben wir den Südwind, den Wind von Mittag, der Westwind, der Wind von Niedergang und der Ostwind, der Wind von Aufgang. Das hat alles Einfluss. Selbst Kleidung, hier ist Wollkleidung, ob man Wolle trägt, ob man Leinen trägt, ob man Seide trägt, das soll alles Nutzen oder Schaden haben, je nach Temperament. Das soll alles helfen, diese Säfte im Ausgleich zu halten. Also ihr seht, es gibt wirklich kaum einen Lebensbereich, auf den diese Idee sich nicht bezieht.
Und wo wir es gerade wieder gesagt haben, Wolle hat seine Rolle in der Säftelehre, ist auch heute noch ein super Material. Deswegen nochmal kurze Erinnerung. Unten ist der Link zu Gießweinschuhen. Schaut euch das Ganze mal an, ich kann es wirklich empfehlen. Tolle Schuhe. Und tatsächlich, Mittelalter sowieso, da findet man die Sidi eigentlich immer. Im 16. Jahrhundert kriegt die Idee schon einen ersten Schaden. Paracelsus, einer der bekannten Ärzte, auch wenn er ganz viel Mist anderswo schreibt, greift dieses System an.
Es nimmt Schaden, überlebt aber sehr lange, bis mindestens ins 19. Jahrhundert, eigentlich bis heute in merkwürdigen esoterischen Ideen ist es immer noch da, aber im 19. Jahrhundert ist das noch völlig üblich. Es wird wirklich erst dann aus der wissenschaftlichen Ideenwelt verbannt, wenn wir Mikrobiologie haben, wenn über Erreger gesprochen wird, wenn Zellen entdeckt werden und
Zellstoffwechsel und solche Sachen verstanden werden. Solange all das nicht entdeckt ist, solange ich den Körper grob mechanischer betrachte, ist auch so eine Analogie-Idee da und solange ist auch die Säftelehre da. Das Resümee des Ganzen. Es ist ein ganzheitlicher Ansatz. Wenn man im Mittelalter über Medizin redet, sollte man sich immer...
ins Gedächtnis rufen, dass alle Lebensbereiche abdeckt. Die Idee, dass der Arzt erst kommt, wenn der Patient krank ist, wer es sich leisten kann, ist vorher beim Arzt. Der lässt sich überprüfen, der lässt sich durchchecken, der versucht gesund zu bleiben und es ist komplex. Was ich gerade erklärt habe, ist so die Übersicht, wirklich ganz, ganz grob. Es ist jahrhundertelang eine Wissenschaft. Viele, viele, viele Menschen haben mehr oder minder wissenschaftlich im Mittelalter damit gearbeitet. Es ist
Es gibt ganz, ganz viele Ideen dazu. Wer sich heute Astrologie anguckt, in Astrologie gibt es auch jede Menge pseudowissenschaftliche Ansätze, um es möglichst kompliziert klingen zu lassen. Das ist da nicht anders. Meine Version davon ist wirklich ganz, ganz, ganz simpel. Tatsächlich war es ein komplexes System.
Man darf nicht denken, dass das einfach ist. Nichts an einem mittelalterlichen Wissenssystem ist einfach. Es gibt auch Fachschriften dazu, also wirklich auch große Geister haben sich damit beschäftigt, haben Bücher dazu geschrieben. Die Wirksamkeit ist natürlich oft fraglich. In sehr, sehr vielen Dingen. Wir wissen es heute oft besser. Andererseits wissen wir gerade in der Pflanzenmedizin, auch heute ist
noch auf Pflanzen basiert. Viele dieser Pflanzenwirkstoffe können heute synthetisiert werden, aber ursprünglich sind es oft natürliche Inhaltsstoffe. Also wir sind da gar nicht so weit entfernt. Pflanzen funktionieren, die haben Wirkung. Man kann sich daran vergiften, also haben sie eine eindeutige Wirkung. Auch da darf man das Ganze nicht unterschätzen. Da war Wissen da. Und zwar nicht nur bei irgendwelchen Kräuterweibern, die dann als Hexen verfolgt wurden, sondern allgemein. Bei Ärzten, bei Apothekern und auch im normalen Hausgebrauch. Da gibt es Beispiele dafür, wie so Gewebenswürfel,
Die Hausbücher zum Beispiel bringen solches Wissen auch für Tränke, für Mittel, für Arzneien unter den normalen Leuten. Das Wolfsberger Hausbuch hat etliche medizinische Rezepte in seinem Rezeptteil. Dazu sind die da. Und ganz wichtig, wie gesagt, diese Ideen sind nicht weg. Die werden heute noch verbreitet. Die sind heute noch in anderen Systemen, die einen besseren Ruf haben. Also Ayurveda, traditionelle Chinesische Medizin und ihre ganzen Varianten. Es gibt ja tausend verschiedene Dinge, die basieren auf einem sehr, sehr ähnlichen System. Und die werden heute gar nicht verlacht.
Sagt der Meder, ja, versuch's doch mal damit. Mittelalterliche Dinge werden verlacht und werden für absurd gehalten, obwohl ganz viele Dinge auch in diesem System drin sind. Schröpfen, nicht unbedingt.
Nassschröpfen, also Bluteschröpfen, ist zum Beispiel sehr, sehr verbreitet. Da gibt es ganz, ganz viele Varianten von. Und auch heute gibt es übrigens Schröpfen nach wie vor in Finnland in der Sauna. Es gibt Saunen, da kann man sich immer noch nass schröpfen lassen. Und auch Trockenschröpfen gilt heute, glaube ich, auch als alternativmedizinisch, ist aber immer noch verbreitet. Also wir sollten, wenn wir uns angucken, was so an komischen Dingen in unserer Medizin so an den Rändern, an den esoterischen Rändern unterwegs ist, sollten wir uns wieder mal zurückhalten, ins Mittelalter zu verlachen. Denn dieses System basiert auf Beobachtung.
Die Schlüsse mögen nicht richtig sein, aber die Beobachtungen sind erstmal gar nicht falsch. Und deswegen finde ich dieses System so spannend und wer, ich mache ja gerne meine Videos auch für angewandte Anwendungen, wenn ihr irgendwie im Rollenspiel oder im Live-Rollenspiel Ärzte, Wunderzüge oder sonst was spielt oder irgendwie Gelehrte, benutzt dieses System. Es ist herrlich abstrus. Man kann auch Dinge reinmachen, man kann auf einmal Dingen eine wundervolle Wirkung zuschreiben. Es ist fantastisch, damit zu spielen. Kann ich nur empfehlen.
Wenn ihr es nicht tut, war es nicht so interessant.
Hoffe, dieses ganze Thema war jetzt nicht zu schräg. Ich finde es wirklich so fürs Verständnis dieser Zeit einen ganz, ganz wichtigen Baustein, sich mal mit der Säftelehre, der Temperamentenlehre und den Ideen des Tarquinium Sanitatis beschäftigt zu haben. Zum Tarquinium habe ich noch ein komplettes Video gemacht. Das werde ich gleich hier einblenden. Und unter dem Video findet ihr auch Links dazu. Einmal zu den Bildern des Tarquinium Sanitatis, zu den Bildern des Codex Schürstab. Es sind nicht so wahnsinnig viele zum Hausbuch. Die Links sind alle unterhalb.
unter dem Video, auch auf meiner Homepage findet man die, in der Galerie über Quellen. Das Tacumni Sanitatis ist da noch nicht drin, mal gucken, ob ich es noch ändern kann. Aber auf meiner Pinterest-Galerie, da findet ihr auch das Tacumni Sanitatis. Schaut mal rein, sind wunderschöne Bilder, ganz viele Augenöffner. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Thema und wir sehen uns nächste Woche wieder mit einem neuen Thema. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund.