
Die 70er: Der KSZE-Prozess und die DDR-Opposition (10/12)
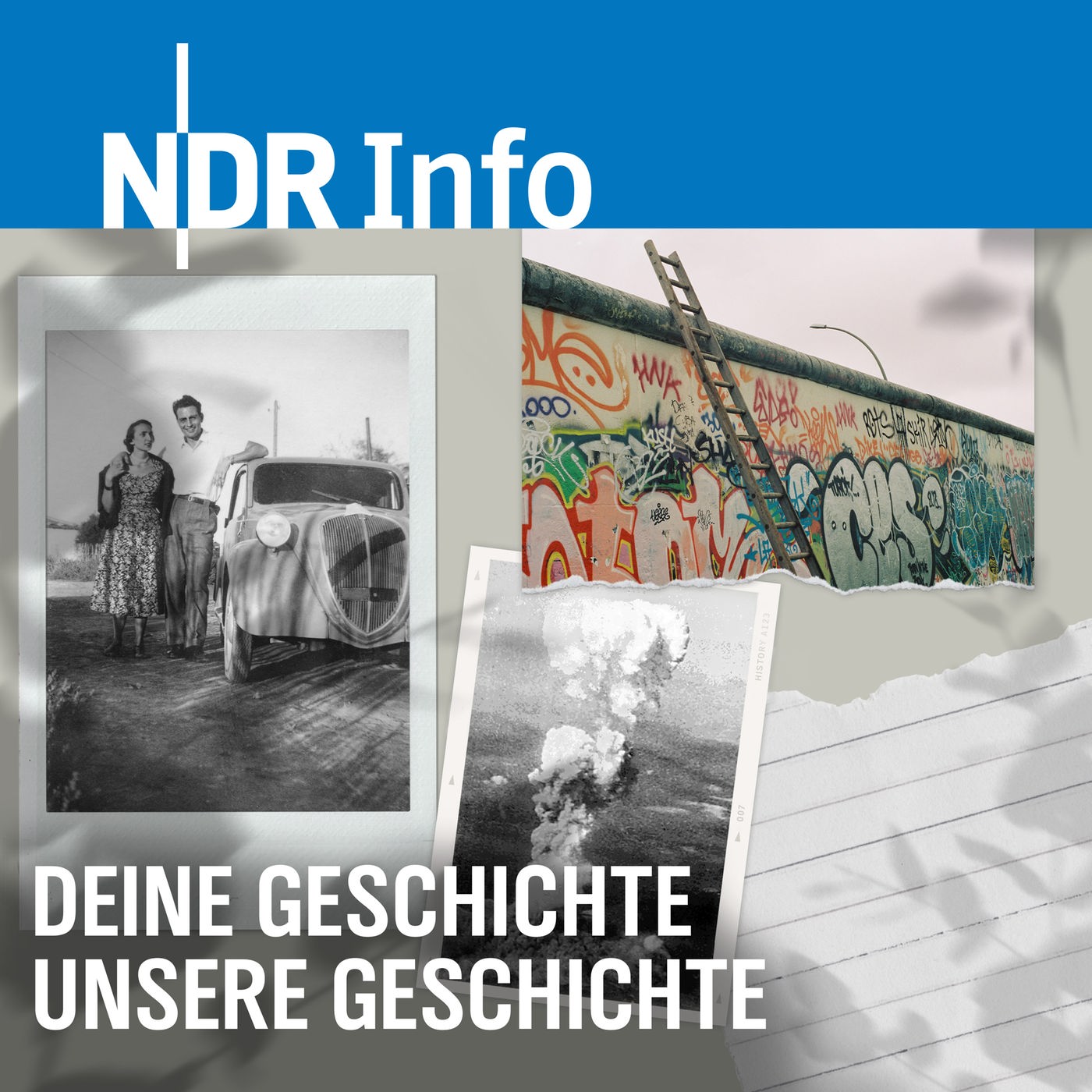
Deine Geschichte – unsere Geschichte
Deep Dive
- Unterdrückung der Meinungsfreiheit in der DDR
- Entstehung kritischer Einstellungen zum System in den 1970er Jahren
- Herausforderungen und Risiken der Opposition bei der Bildung von Diskussionsgruppen
- Reaktion der Staatssicherheit
Shownotes Transcript
Also der Staat schrieb uns unsere Meinungen vor und eigentlich auch unseren Lebensstil. Und das reichte eben aus, um uns zunehmend zu empören.
Helmut Schmidt und Erich Honecke begrüßen sich ungezwungen. Also die Einsicht wuchs, dass dieses System offenbar unreformierbar ist. Das in Helsinki versammelte Staatenforum bekräftigt die Wende vom Kalten Krieg zur Entspannung in Europa. Wenig Vertrauen darauf, dass diese menschenrechtlichen Normen in dieser Schlussakte auch ernst genommen werden. Zur Politik der friedlichen Koexistenz
gibt es keine Alternative. Also diese Demonstrationen im September, Oktober, November 1989, die habe ich in dieser Größenordnung nicht erwartet. Deine Geschichte, unsere Geschichte. Ein Podcast von NDR Info.
Deine Geschichte erzählt dein Leben. Unsere Geschichte erzählt von unser aller Leben. Ich habe Zeitzeugen gefragt. Ich habe in den Tonarchiven recherchiert. Deine Geschichte. Unsere Geschichte. Die 70er, Folge 10. KSZE-Prozess und die Opposition in der DDR. Willkommen zu einer neuen Folge unseres Geschichtspodcasts mit Ulrike Bossel und Franziska Ammler.
Schon hier auf dem Flughafen Helsinkis ist zu spüren, dass ein Ereignis von außergewöhnlichem Rang bevorsteht. Ich glaube, diese Haltung, dass man nichts verändern kann aus dieser starren Aufteilung der Welt in zwei sich antagonistisch gegenüberstehenden Blöcke,
Das war das Bewusstsein in der übergroßen Mehrheit. Etwa 50 Journalisten haben sich eingefunden, um die Ankunft Außenminister Otto Winzers festzuhalten. Wenn zigtausende oder Millionen Menschen am 1. Mai oder am
am 7. Oktober jubelnd an der Tribüne vorbeiliefen und sozusagen ihre Unterwerfung unter der Parteiführung dokumentierten, so wusste doch jeder, dass viele von denen, die in ihren Betriebsgruppen da langmarschierten,
um ihre Zustimmung zu bekunden, danach in der Kneipe saßen und politische Witze rissen und die Faust unterm Tisch balten. Dieser Vorgang jetzt unterstreicht die Tatsache, dass die DDR inzwischen aktiv am internationalen Leben beteiligt ist. Man hatte sich auch ziemlich daran gewöhnt, dass es sozusagen immer...
Diese Spaltung gibt, es gibt die private Meinung, die man nur unter Freunden äußerte, wenn überhaupt. Und es gab die offizielle Meinung, mit der man sich möglichst anpasste.
DDR-Propaganda und Wirklichkeit 1973. In Helsinki tritt die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit, die KSZE, zusammen, um diplomatische Lösungen für die schwelenden Konflikte des Kalten Krieges zu finden. Ostberlin feiert, dass die DDR auf der internationalen Bühne gleichberechtigt neben der Bundesrepublik auftreten kann.
Im Inneren begnügt sich die SED-Führung mittlerweile meist mit der Erfüllung formaler Pflichten als Ausweis ideologischer Linientreue. Die DDR-Bürger haben sich mehrheitlich eingerichtet im Staat hinter der Mauer und suchen ihr Glück im Privaten. Unter der ruhigen Oberfläche aber wuchs bei vielen die Gleichgültigkeit oder auch die Distanz zu dem Staat, in dem sie lebten. Davon hat mir die DDR-Bürgerrechtlerin Ulrike Poppe erzählt, unsere Zeitzeugin für diese Folge.
Die heute 69-Jährige war eine der führenden Vertreterinnen der Opposition, als die DDR-Diktatur 1989 schrittweise unter dem Druck ihrer Bevölkerung friedlich zusammenbrach. Bis dahin war es allerdings noch ein langer und zäher Weg, als die gebürtige Rostockerin ab Mitte der 70er Jahre mehr und mehr in oppositionellen Kreisen aktiv wurde.
Schon während ihrer Schulzeit begann sich bei Ulrike Poppe eine kritische Einstellung zum System herauszubilden. Als sie 1971 nach Berlin kam, um Kunsterziehung und Geschichte zu studieren, geriet sie über Freunde, so erzählt sie mir, in Kreise, in denen einige junge Menschen aus politischen Gründen von ihrem Studium religiert worden waren. Und?
in denen viel über Politik und über alternative Lebensweisen diskutiert worden ist. Also es war eher noch eine kulturell geprägte Protesthaltung, die aber mit der Zeit immer politischer wurde. Und in diesen Kreisen habe ich dann auch Bücher zu lesen bekommen, die...
für mich und für mein Weltbild damals sehr entscheidend waren, also zum Beispiel Bücher über den Stalinismus. Und ich stellte dann immer mehr fest, was in der Geschichtsausbildung an der Humboldt-Uni weggelassen wurde oder eben anders dargestellt wurde, als es möglicherweise wirklich war. Musik
Im Sommer 1971 löste Erich Honecker Walter Ulbricht an der Spitze der SED und damit als politische Nummer 1 in der DDR ab. Unter seiner Leitung verabschiedete der 8. Parteitag der SED den Fünf-Jahres-Plan unter der Überschrift Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik. Mit der Folge, dass mehr in soziale Leistungen und Konsumgüter investiert wurde. Das
Das Leben der DDR-Bürger wurde leichter, was allerdings nicht, wie von Honecker erhofft, mit wachsender Begeisterung für das herrschende Regime einherging. Dass auch in der DDR Jeans hergestellt wurden und junge Familien leichter eine Wohnung bekamen, reichte den Studierenden nicht, erzählt Ulrike Poppe. Also der Staat schrieb uns vor, was wir lesen dürfen, auf welchem Weg wir uns informieren dürfen, welche Länder wir bereisen dürfen, wenn überhaupt.
Er schrieb uns unsere Meinungen vor und eigentlich auch unseren Lebensstil. Und das reichte eben aus, um uns zunehmend zu empören. Ulrike Poppe und ihre Freunde wollten es nicht hinnehmen, dass sie als normale Bürgerinnen und Bürger des Staates DDR keine Möglichkeiten hatten, die Politik mitzugestalten.
Und das mündete dann darin, dass wir so kleine Diskussionsgruppen hatten, die zum Teil sehr konspirativ auch an Veränderungsmodellen gearbeitet haben.
Zum Teil waren das also auch Gruppierungen, wo man nur hineinkam, wenn man einen Bürgen hatte. Da seien dann alternative Ideen zur herrschenden Politik diskutiert und entwickelt worden. Für ganz unterschiedliche Themen. Von der Bildungspolitik über den Wohnungsbau bis hin zur Meinungs- und Informationsfreiheit, hat Ulrike Poppe erzählt.
Alles aber hinter verschlossenen Türen. Wenn die Staatssicherheit davon erfuhr und die bemühte sich ja immer mal wieder, auch inoffizielle Mitarbeiter in diese Gruppierungen einzuschleusen, dann kam es zu Verhaftungen, ohne dass wir uns dagegen wehren konnten, weil wir nicht an die Öffentlichkeit gingen oder uns trauten zu gehen. Musik
Musik
International standen die frühen 70er Jahre im Zeichen der Entspannungspolitik zwischen Ost und West. Willy Brandt hatte 1971 den Friedensnobelpreis bekommen für seine Ostpolitik der Verständigung der Bundesrepublik mit den Staaten Osteuropas. Im Juni 1972 traten die Verträge von Moskau und Warschau mit der Bundesrepublik in Kraft. Im Dezember 1972 wurde der Grundlagenvertrag zwischen der DDR und der Bundesrepublik unterzeichnet.
Danach war der Weg frei für die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, in der es nach der bilateralen Verständigung zwischen einzelnen Staaten jetzt um multilaterale Vereinbarungen über die Machtblöcke Ost und West hinweg ging.
Die Konferenz beginnt im Sommer 1973 mit einem Außenministertreffen in Helsinki. Für die Bundesrepublik bestreitet Außenminister Walter Scheel die erste Verhandlungsrunde. Zwei Aufgaben sind dabei zu lösen. Erstens müssen wir feststellen, ob wir ein gemeinsames Bild der Wirklichkeit zeichnen können.
Zweitens müssen wir gemeinsam auf dieser Grundlage Regeln für die Zusammenarbeit entwerfen und uns auf die Einhaltung dieser Regeln einigen. Scheel macht auch deutlich, mit welcher Position der Westen in die Verhandlungen geht. Wir dürfen den Menschen in unseren Ländern nicht vormachen, hier werde das neue Gebäude eines europäischen Völkerrechts errichtet.
Die Regeln wurden schon vor 28 Jahren in der Satzung der Vereinten Nationen verankert. Wir wollen ihre Respektierung in Europa sichern. Dagegen unterstreicht DDR-Außenminister Otto Winzer Es geht durchaus nicht nur darum, die in der Charta der Vereinten Nationen enthaltenen Normen der zwischenstaatlichen Beziehungen noch einmal zu bekräftigen.
Vielmehr sollten die spezifischen, historischen und aktuellen Gegebenheiten in Europa berücksichtigt werden, denn hier soll die Anwendung dieser Prinzipien gewährleistet werden. Und Finzer macht deutlich, worauf es der DDR wie allen Staaten des Ostblocks ankommt. Unter diesem Aspekt gewinnen solche Prinzipien wie die Unverletzlichkeit der Grenzen
Der Sowjetunion und den Staaten des Ostblocks geht es darum, die Grenzen und die Machtverhältnisse, wie sie sich seit dem Zweiten Weltkrieg in Europa herausgebildet haben, abzusichern. Die DDR-Führung will darüber hinaus erreichen, dass ihr Staat auch jenseits des sozialistischen Lagers endlich gleichberechtigt mit der Bundesrepublik anerkannt wird.
Dem Westen dagegen geht es darum, die Grundsätze der UN-Charta in allen ihren Teilen in ganz Europa durchzusetzen. Dazu gehört die Wahrung von Frieden und Sicherheit und das Bekenntnis zur friedlichen Beilegung von Streitigkeiten, aber auch die Achtung und Verwirklichung der Menschenrechte und Grundfreiheiten.
Was es bedeutete, wenn die Grundfreiheiten wie Meinungs- und Informationsfreiheit nicht gewährt werden, spürten Ulrike Poppe und ihre Freundin in ihren Diskussionsgruppen. Bei uns wuchs langsam die Einsicht, dass es wenig Sinn hat, unter uns diese Modelle zu diskutieren, wenn wir damit nicht irgendeine Möglichkeit erreichen, dies auch zuzulassen.
besprechbar zu machen, diskutierbar zu machen in öffentlichen Foren. Und die waren uns ja größtenteils verwehrt. Je deutlicher ihnen ihre Ohnmacht wurde, desto stärker wurde ihre Oppositionshaltung.
Und aus diesem Unmachtsgefühl heraus wuchs auch unsere Wut, dass dieses System eigentlich unreformierbar ist. Also die Einsicht wuchs, dass dieses System offenbar unreformierbar ist, wenn diejenigen, die Reformideen haben, diese nicht öffentlich machen können, geschweige denn durchsetzen.
Und je mehr wir diese Grenzen spürten, desto deutlicher kam uns vor Augen, dass in diesem System grundsätzlich was verändert werden muss, vor allen Dingen hinsichtlich der Durchsetzung von Menschenrechten.
Marshal Tito, ganz in Weiß gekleidet, ragt aus der diplomaten Grau bevorzugenden Versammlung heraus,
Man erkennt unschwer die schweren Körper des Russen Brezhnev und des Polen Gierek. Ford und Kissinger strahlen wie stets Großmachtsverantwortung aus. Helmut Schmidt und Erich Honecker begrüßen sich ungezwungen, ehe sie sich auf ihren nur durch einen schmalen Korridor getrennten Sitzen niederlassen.
In ihren Reden verweisen die anwesenden Politiker auf die historische Bedeutung des KSZE-Abkommens. Aber in der Akzentuierung werden die weiterhin unterschiedlichen Erwartungen und Standpunkte deutlich.
Erich Honecker unterstreicht die Verankerung der DDR im sozialistischen Lager, wenn er von der friedlichen Koexistenz spricht. Das war die Formel, die sowjetische Politiker geprägt hatten, um zu beschreiben, dass nicht der kriegerische Konflikt, sondern der friedliche Wettbewerb der Systeme die Konkurrenz zwischen Kommunismus und Kapitalismus entscheiden solle. Erneut erweist sich zur Politik der friedlichen Koexistenz
gibt es keine Alternative. Das in Helsinki versammelte Staatenforum bekräftigt die Wende vom Kalten Krieg zur Entspannung in Europa. Als untrennbarer Bestandteil der sozialistischen Gemeinschaft hat die Deutsche Demokratische Republik das europäische Vertragswerk mitgestaltet und damit zum erfolgreichen Verlauf der Sicherheitskonferenz beigetragen.
Den Wünschen der Sowjetunion entsprechend wird mit der Garantie der Unverletzlichkeit der Grenzen und der Achtung der Souveränität ihr Herrschaftsbereich, wie er sich seit 1945 herausgebildet hat, territorial abgesichert.
Um das zu erreichen, war Moskau bereit, die vom Westen geforderte Garantie der Menschenrechte und Grundfreiheiten zuzugestehen, ebenso wie die Vereinbarung von Kooperationen in der Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Bildung und Verbesserungen der menschlichen Kontakte mit Reisemöglichkeiten aus beruflichen und persönlichen Gründen.
Letzteres waren zunächst einmal nur Absichtserklärungen, deren Umsetzung ins Ermessen der jeweiligen Regierungen gestellt war. In der Rede von Bundeskanzler Helmut Schmidt klingt daher auch die Skepsis an, ob das alles so kommen wird, wie der Westen es sich erhoffte. Die Politiker werden daran gemessen, ob sie die moralische Stärke und ob sie die politische Kraft aufbringen, aus vernünftigen Prinzipien abzulegen.
die hier im Augenblick auf dem Papier stehen, ob sie daraus nachprüfbare Wirklichkeit machen.
Eurike Poppe erzählt, dass sie und ihre Freunde natürlich wahrnahmen, dass auch die DDR-Vertreter die Schlussakte von Helsinki unterzeichneten. Sie glaubten aber nicht, dass das für ihr Leben irgendetwas ändern würde. Jedenfalls in meinen Kreisen war wenig Vertrauen da darauf, dass diese...
insbesondere der Korb 3, also diese menschenrechtlichen Normen in dieser Schlussakte, auch ernst genommen werden durch die Staats- und Parteiführung. Schließlich hatten sie bislang andere Erfahrungen gemacht. Weil auch in der DDR-Verfassung stand einiges, was das Papier nicht wert war, auf dem es stand.
Also woran sich der Staat auch nie gehalten hat. Und so ähnlich habe ich das auch wahrgenommen mit der Helsinki-Schlussakte. Zwar war das eine Möglichkeit, sich darauf zu berufen, aber andererseits hatte ich kaum Hoffnung, dass der Staat
der Staat sich wirklich daran hält. Trotzdem veränderte sich etwas mit der Unterzeichnung der KSZE-Schlussakte, sagt sie. Es war auch ein Stück weit eine Hoffnung, weil man sich ja darauf berufen konnte. Wobei diejenigen, die sich darauf beriefen, natürlich auch immer damit rechnen mussten, dass das nicht anerkannt wird.
Das Ministerium für Staatssicherheit der DDR hatte die SED-Führung vor "Zugeständnissen bei den Menschen und Grundrechten" gewarnt, wie sie in der KSZE-Schlussakte verankert wurden.
Die Mitarbeiter des Stasi-Unterlagenarchivs, das heute Teil des Bundesarchivs ist, haben die Dokumente von damals gesichtet und zum Teil veröffentlicht. Und sie verweisen darauf, dass das MFS vor allem die Vereinbarungen über menschliche Kontakte und Informationsfreiheit fürchtete. Und sie zeigen, dass die Bedenken von Ulrike Poppe im Hinblick auf die Umsetzung der Schlussakte von Helsinki in der DDR gerechtfertigt waren.
Auf der Website des Bundesarchivs wird darauf hingewiesen, dass Stasi-Chef Erich Mielke schon wenige Tage nach Abschluss der Konferenz alle Diensteinheiten anwies, die Folgen der Unterzeichnung abzuschätzen. Und, dass die SED ihre Geheimpolizei anwies, unerwünschte Nebenwirkungen zu bekämpfen, den Bürgern der DDR also weiterhin ihre Menschenrechte vorzuenthalten.
Was dann ja auch geschah. Ulrike Poppe ist insbesondere dieser Vorfall im Kopf geblieben. Also ich erinnere mich an eine Szene, dass jemand mit einem Schild vor der neuen Wache in Berlin-Mitte stand, auf dem nur stand Helsinki Korb 3, nichts weiter. Und er stand vielleicht, ich habe das beobachtet, er stand vielleicht drei Minuten randend
aus verschiedenen Richtungen Männer auf ihn zu, sicherlich Staatssicherheitsleute, die ihm sofort die Arme nach hinten treten und
Sonst habe sich erst mal wenig geändert durch die KSZE-Schlussakte. Also die Reisefreiheit zum Beispiel wurde ja überhaupt nicht umgesetzt. Zwar gab es Lockerungen mit der Zeit, also dass man auch zu Verwandten fahren konnte auf Antrag, aber in einer Zeit, in der man sich nicht mehr so gut fühlt,
Für diese Diktatur üblichen Willkür hat man genehmigt oder nicht genehmigt, ohne dass der Einzelne die Möglichkeit hatte, eine Begründung zu erfahren, weshalb das nicht genehmigt wurde. Und genauso ist man mit allen anderen Freiheiten umgegangen, also beispielsweise im Bildungssystem umgegangen.
Wer aus einem Elternhaus kam, das als politisch unzuverlässig eingestuft wurde durch die staatlichen Organe, der durfte kein Abitur machen, ohne dass er sich dagegen wehren konnte. Also diese staatliche Willkür und diese Unmöglichkeit,
als Bürger und Bürgerinnen die eigenen Rechte einzufördern. Es gab ja keine Verwaltungsgerichtsbarkeit. Das war schon uns klar, dass jegliche rechtsstaatliche Grundlage fehlte, um das, was dort unterzeichnet wurde, in irgendeiner Weise auch einzuklagen und einzufordern. Musik
Die sozialistischen Staaten wurden durch die Unterzeichnung der KSZE-Schlussakte nicht zurechtstarten. Und das Dokument war auch kein völkerrechtlich bindender Vertrag, sondern folgte dem Prinzip einer Selbstverpflichtung.
Aber die Staats- und Regierungschefs hatten etwas unterzeichnet, worauf sich die Bevölkerung berufen konnte. Und es gab regelmäßige Folgekonferenzen zu Helsinki. Die Unterzeichnerstaaten standen unter internationaler Beobachtung. Ulrike Poppe erzählt, dass das schon einen Effekt hatte, weil die SED-Führung unter Erich Honecker sehr stark interessiert war an ihrer Außenwirkung. Also die Sucht nach internationaler Anerkennung,
sich zu repräsentieren als ein Staat, der dem Menschenrecht achtet, die hat diesen Staat auch verletzbar gemacht. Und zwar dadurch, dass wenn wir tatsächliche Menschenrechtsverletzungen öffentlich gemacht haben. Und das musste um jeden Preis verhindert werden.
Einige hätten schon damals geahnt, sagt Ulrike Poppe, dass das Regime fortan mit anderen Methoden, mit Methoden der geräuschlosen Ausschaltung arbeitete.
Erst viel später sei ihnen aber klar geworden, dass die geänderten Strategien gegenüber der Opposition im Zusammenhang zu Helsinki standen. Infolge der Unterzeichnung der Schlussakte von Helsinki, nämlich von Mitte der 70er Jahre, stammt ja auch die Order bei der Staatssicherheit, nicht mehr so viel Kritiker des Systems einfach einzusperren, sondern die Opposition im Vorfeld zu ersticken.
Und da wurde dann, ich glaube, das war 1976 zum Beispiel, die Zersetzungsstrategie entwickelt, die darauf hinlief, diejenigen, die gegen den Staat arbeiten oder die als Staatsfeinde eingestuft waren oder der staatlichen Ordnung gefährlich werden konnten nach Ansicht der Staatssicherheit,
in öffentliches Misskredit zu bringen, ihren Ruf zu schädigen, in Misserfolge zu organisieren, dass die Freunde sich von ihnen abwenden, indem man Gerüchte streut, Misstrauen zu erzeugen.
oder auch diese Menschen psychisch, seelisch zu zerstören mit sehr perfiden Maßnahmen, die dann auch bis Ende der 80er Jahre so durchgezogen wurden und wozu auch sehr viele inoffizielle Mitarbeiter mit herangezogen wurden, um solche Zerstörungen von Persönlichkeiten und von Personenzusammenhängen zu organisieren.
Und das hatte schon damit zu tun, dass man eben vermeiden wollte, dass durch politische Gefangene der Staat, der DDR-Staat in Misskredit in der öffentlichkeit, in der internationalen Öffentlichkeit gebracht wird, weil man die Kritiker eben stattdessen entweder verletzt.
als Akteure zerstört oder Aktionen im Keim erstickt, beziehungsweise versucht sie in den Westen zu treiben, zu drängen, mit auch entsprechenden Erschwernissen im Beruf oder im Alltagsleben oder Bedrohungen für die Kinder. Wir haben ja in den letzten beiden Podcast-Folgen über die Stasi und über die Biermann-Ausbürgerung schon über diese Zersetzungsstrategien gesprochen.
Auch Ulrike Poppe war davon betroffen. In den 70er Jahren erlebte sie im Zusammenhang mit Verhaftungen von Freunden zweimal Hausdurchsuchungen der Stasi. Sie wurde von der Stasi zu Vernehmungen einbestellt. Anfang der 70er Jahre gab es einen vergeblichen Anwerbeversuch der Stasi. Zur Jahreswende 1983-84 wurde sie sechs Wochen lang im Stasi-Gefängnis Berlin-Hohenschönhausen eingesperrt.
Und sie wurde überwacht. Zum Beispiel hat sie mir erzählt, wie ihre Wohnung abgehört wurde. Mein Mann hatte ein Mikrofon ausgebaut, das direkt über unserem Tisch, um den herum wir saßen in unseren Diskussionsrunden, praktisch in der Decke steckte.
Wir hatten die Wohnung ganz oben, über uns war der Trockenboden und von dort aus haben die Stasi-Leute einen Keramikstab, an dessen Spitze ein Mikrofon sich befand, hineingesteckt. Und er war ja Physiker, hat das ausgebaut und hat das auch ausprobiert. Das war ein sehr empfindliches Mikrofon. Und wir haben dabei auch festgestellt, dass das so empfindlich ist, dass man sogar
Kleinste Geräusche, also Flüstern nützt nichts, man konnte das durch das Mikrofon hören. Eine gruselige Vorstellung einfach. Ja, es war schon gruselig, weil die natürlich auch jede private Lebensäußerung, jeden Streit um den Abwasch und jedes Kindergeschrei und alles wirklich mithören und auswerten konnten.
Und wir haben trotzdem versucht, ein normales Familienleben zu leben. Aber ich glaube, so ganz aus dem Bewusstsein war das nicht zu tilgen, dass wir doch immer wieder daran denken mussten, dass jedes Wort dort mitgehört wird. Dass Oppositionelle und Bürgerrechtler sich immer weniger einschüchtern ließen, wurde zu einem Problem in den sozialistischen Staaten.
Im Sommer 1976 verbrannte sich in der DDR der Pfarrer Oskar Brüsewitz selbst aus Protest gegen das Regime.
Auch wenn das in den DDR-Medien zunächst als die Tat eines Verrückten dargestellt wurde, löste sein Tod doch eine große Solidarisierungswelle in der DDR aus. Wolf Biermann nannte die Tat bei seinem ersten öffentlichen Auftritt nach elf Jahren Berufsverbot in der Nikolaikirche in Prenzlau im September 1976 eine »Republikflucht in den Tod«.
Zwei Monate später wurde Biermann aus der DDR ausgebürgert. Darüber und über die Proteste, die daraufhin folgten, haben wir ja in unserer letzten Podcast-Folge gesprochen. Während die Stasi noch damit beschäftigt war, die Unterzeichner der Resolution gegen die Ausbürgerung Biermanns zu verfolgen, sah sie sich mit dem nächsten Unruheherd konfrontiert.
Im Januar 1977 wurde die Charta 77 veröffentlicht, in der Oppositionelle in der Tschechoslowakei unter Berufung auf die KSZE-Schlussakte die Einhaltung der Menschenrechte anmahnten und international damit Resonanz fanden.
In der DDR entstand in einem ökumenischen Arbeitskreis der christlichen Kirchen, angelehnt an die Charta 77, das Querfurter Papier, in dem die Einhaltung der Menschenrechte gefordert wurde. Ulrike Popper hat mir erzählt, dass es für sie und ihre Freunde wichtig war, zu erfahren und zu spüren, dass es auch viele andere gab, die sich wie sie durch das SED-Regime gegängelt fühlten und das nicht hinnehmen wollten. Natürlich war die Stasi eine ständige Bedrohung dafür,
Aber irgendwie, wie kann ich das beschreiben? Irgendwie waren wir trotzdem der Ansicht, dass wir die Möglichkeiten, die wir hatten, ausschöpfen müssen, um eine widerständige Haltung zu zeigen für uns selbst, für unser eigenes kulturelles Selbstverständnis.
aber auch in der Hoffnung, dass sich nach unserem Beispiel auch die oppositionelle Basis verbreitert.
Bürgerrechtler in der CSSR, Oppositionelle in Polen, Dissidenten in der Sowjetunion, sie alle beriefen sich in der zweiten Hälfte der 70er und in den 80er Jahren auf den KSZE-Prozess. In der DDR kam etwas anderes hinzu. Ausreisewillige verwiesen auf die KSZE-Schlussakte.
Denn während die Bürger der anderen sozialistischen Staaten nur die Möglichkeit hatten, sich mit ihren Regimen auseinanderzusetzen, wenn sie unzufrieden waren, gab es für die DDR-Bürger darüber hinaus die Perspektive auf ein Leben in der Bundesrepublik. Wären die Vereinbarungen von Helsinki vollständig umgesetzt worden, hätten die Bürger ein Recht auf Freizügigkeit gehabt. Das aber war für die SED-Führung undenkbar.
Die Anträge auf ständige Ausreise bedrohten die Stabilität des DDR-Regimes am Ende ebenso wie die explizite Opposition. Ulrike Poppe sagt, Erich Honecker habe die Schlussakte von Helsinki unterzeichnet, weil er sich dadurch mehr internationale Anerkennung erhoffte. Er habe sich damit aber eben auch angreifbar gemacht, wenn er das, was er unterschrieben hat, nicht einhält.
Das Regime musste also verhindern, dass die eigenen Menschenrechtsverletzungen an die Öffentlichkeit kommen. Damit habe die Opposition ein Mittel in die Hand bekommen, mit dem sie arbeiten konnte, auch wenn es nach Helsinki noch mehr als zehn Jahre gedauert hat, ehe die DDR zusammenbrach. Ja, manchmal versuche ich mich zu erinnern, was ich eigentlich für Zukunftsvorstellungen hatte, was ich erwartet hatte. Also ich habe auf jeden Fall erwartet, dass sich irgendwas verändern muss.
Aber womit ich nicht gerechnet habe, ist, dass es eigentlich sehr plötzlich zu massenhaften Protestaktionen kommt. Also diese Demonstrationen im September, Oktober, November 1989, die habe ich in dieser Größenordnung gemacht.
nicht erwartet und wenn mir das jemand drei Jahre zuvor erzählt hätte oder zehn Jahre zuvor, hätte ich es wohl nicht geglaubt, weil ich die Mehrheit der Bevölkerung immer als sehr angepasst und sehr mit großer Bereitschaft sich der Staatsführung zu unterwerfen erlebt habe. Aber dass sich irgendwas im Laufe der Zeit verändern müsse, zumal auch, weil das Leben der
der Politbüro-Mitglieder auch endlich war und alle schon sehr alt waren. Daran habe ich schon geglaubt oder ich habe vielmehr darauf gehofft. In der Bundesrepublik wurde der KSZE-Prozess primär mit außenpolitischem Interesse beobachtet. Entspannung im Kalten Krieg und mehr Sicherheit wünschten sich alle. Innenpolitisch hatte das weiter keine Bedeutung. Doch auch in der Bundesrepublik formierte sich Mitte der 70er Jahre eine neue Oppositionsbewegung.
Die Besetzung des Bauplatzes für das Atomkraftwerk Wühl im Februar 1975 gilt als die Geburtsstunde der Anti-Atomkraft-Bewegung in der Bundesrepublik. Im November 1976 kommt es dann in Brockdorf zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Atomkraftgegnern. Im März 1979 beginnt im Wendland der Widerstand gegen die geplanten Atomanlagen und Lager in Gorleben.
Atomkraft, nein danke. Das ist das Thema der nächsten Folge von Deine Geschichte, unsere Geschichte. Unsere Zeitzeugen sind dann Heinrich Voss und Christine Scheer. Beide leben nur ein paar hundert Meter entfernt vom Kernkraftwerk Brockdorf in Schleswig-Holstein und haben die Geschichte des AKW von Anfang an miterlebt. Seit fast 50 Jahren, also ein halbes Jahrhundert schon, kämpfen sie gegen die Atomenergie in Deutschland.
Sabine und Jonas haben den Podcast diesmal mit uns produziert. Ihr findet sie finden diese und alle anderen Podcast Folgen in der ARD Audiothek. Fotos, Filme und Texte zu den einzelnen Folgen gibt es unter ndr.de-geschichte. Und über Lob und Kritik freuen wir uns unter der E-Mail Adresse deinegeschichte at ndr.de Deine Geschichte in einem Wort. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ein Podcast von NDR Info.