
Die 70er: Die Ausbürgerung Wolf Biermanns und die Folgen (9/12)
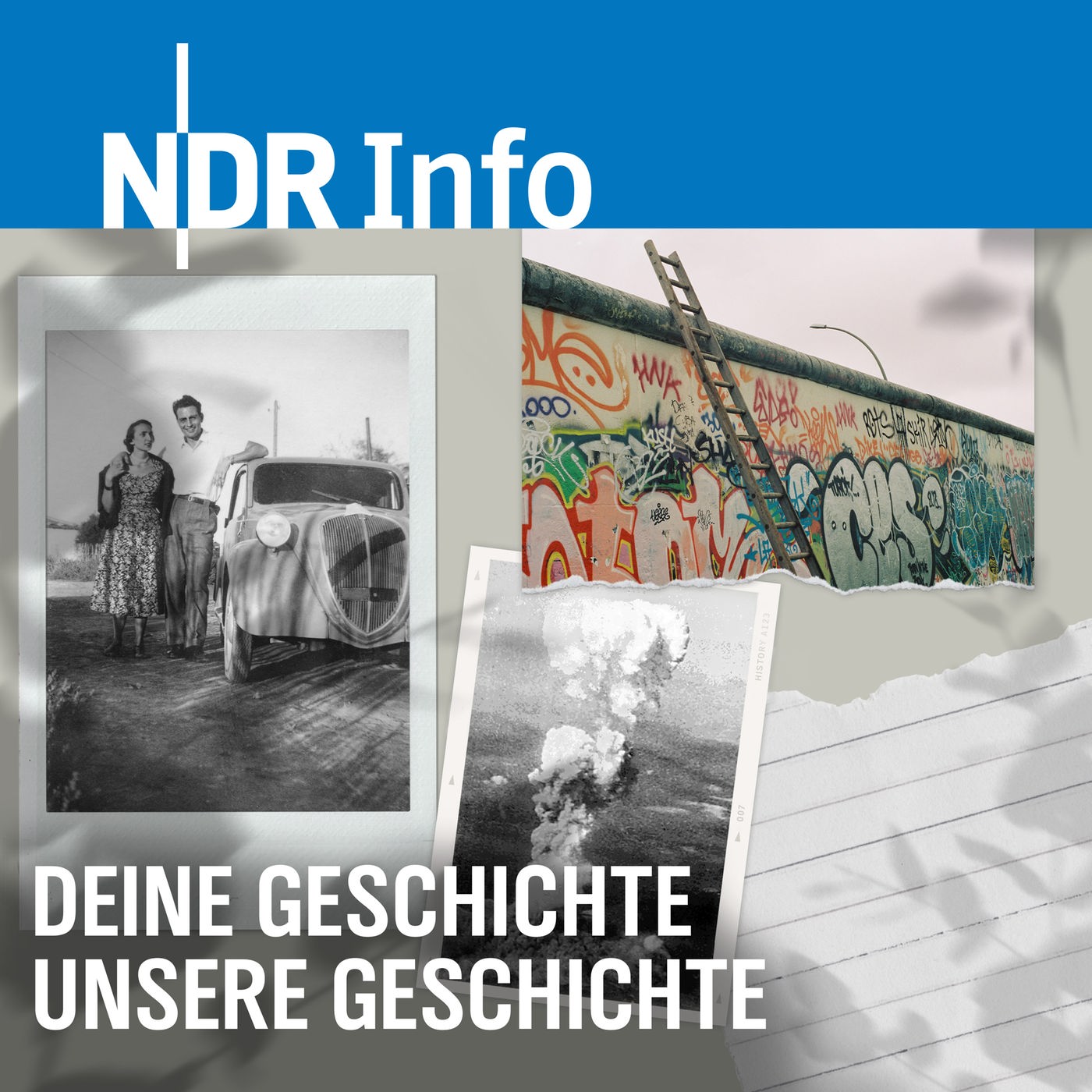
Deine Geschichte – unsere Geschichte
Deep Dive
- Wolf Biermann as a spiritual father figure to Eckhard Maas
- Biermann's songs as a form of truth-telling in the DDR
- Biermann's apartment as a meeting point for dissident artists
- Details about Biermann's life and career in the DDR
Shownotes Transcript
Wolf Biermann war ja für mich wie ein geistiger Vater. Das Recht auf weiteren Aufenthalt in der Deutschen Demokratischen Republik entzogen. Ich dachte, nun ist alles aus. Und ich sagte, wir müssen was tun, wir müssen einen Aufruf schreiben und so weiter. Wir protestieren gegen seine Ausbürgerung und bitten darum, die beschlossenen Maßnahmen zu überdenken. Und in dieser Zeit hatte ich auch große Angst. Wir sind nicht freiwillig nach West-Berlin gekommen.
Dieser Nebel der Anpassung, des Opportunismus, der war plötzlich aufgerissen. Deine Geschichte, unsere Geschichte. Ein Podcast von NDR Info. Deine Geschichte erzählt dein Leben. Unsere Geschichte erzählt von unser aller Leben. Ich habe Zeitzeugen gefragt. Ich habe in den Tonarchiven recherchiert. Deine Geschichte, unsere Geschichte. Die 70er, Folge 9. Die Ausbürgerung Wolf Biermanns und die Folgen.
Das
Die politische Bombe, das war das, womit keiner gerechnet hat. Niemand, ich auch nicht und die Herrschenden der DDR auch nicht, niemand. Also Biermann war immer großartig und der hat mich damals begeistert, also mitgebracht.
Diesen großartigen, wunderbaren Liedern, die er geschrieben hat. Diese Lieder, das war so ein Wort, das jemand so direkt mit so einer starken Sprache die Wahrheit in der DDR aussprach. Das war eigentlich unglaublich. So oder so, die Erde wird rot. Entweder lebt oder tot rot. Wir mischen uns, da bis hier rein.
So soll es sein, so soll es sein, so wird es. Wolf Biermann und sein Fan. Der Zeitzeuge unserer heutigen Folge, Eckhard Maas, ist ein Fan von Wolf Biermann. Ja, aber er ist sehr viel mehr. Er bezeichnet sich selbst als einer der treuesten Freunde und Vertreiber von Biermanns Liedern. Der Liedersänger, Publizist und Übersetzer gründete 1978 einen literarischen Salon,
im Prenzlauer Berg in Ostberlin, der sich in der DDR zu einem der wichtigsten Treffpunkte für Künstler entwickelte, die sich schon Jahre vor dem Mauerfall von der kommunistischen Ideologie lossagten oder zumindest die staatlichen Strukturen der DDR kritisierten. In der Wohnung im Prenzlauer Berg lebt er noch immer und dort habe ich ihn auch getroffen.
Die Wohnung als Bühne und Treffpunkt oppositioneller Künstler, das war auch die Wohnung von Wolf Biermann gewesen, bevor die DDR ihn 1976 ausgebürgert hat. Wie es dazu kam und warum dieses Ereignis immer wieder als der Anfang vom Ende der DDR bezeichnet wird, darum geht es in dieser Folge von Deine Geschichte, unsere Geschichte.
Manche sehe ich Fäuste ballen in der tiefen Manteltasche, kalte Kippen auf den Lippen und in den Herzen Asche. Wolf Biermann schreibt wunderbare Lieder in einer so direkten Sprache, wie sie in der damals in der DDR niemand sprach.
Niemand traute sich, eine Wahrheit so direkt auszusprechen wie Wolf Biermann. Und die Lieder waren einfach toll. Eckhard Maas kommt aus einem Pfarrhaus, in dem man dem Staat DDR gegenüber eher skeptisch eingestellt war. Er lernte Wolf Biermann 1971 persönlich kennen.
Auch wenn er als Pfarrerssohn eher weniger begeistert war von der kommunistischen Revolution, freundete er sich mit Biermann an und besuchte ihn oft in seiner Wohnung in der Chausseestraße 131 in Ostberlin. Wolf Biermann war ja für mich wie ein geistiger Vater. Ich habe von ihm unheimlich viele Dinge erfahren, die man sonst in der DDR nicht hat.
nicht erfahren konnte. Also besonders auch über die Stalinzeit, über diesen Terror der 30er-Jahre, über den Spanienkrieg, wie dort viele Kommunisten von ihren eigenen Leuten in den Rücken geschossen wurden, weil sie nicht auf der Linie waren. Und viele, viele andere Dinge habe ich dort erfahren.
Die wichtigsten Daten der Biografie von Wolf Biermann sind ja bekannt. Geboren 1936 in Hamburg, beide Eltern waren Kommunisten. Der Vater wurde von den Nationalsozialisten inhaftiert und in Auschwitz ermordet.
1953 zieht Biermann mit Billigung seiner Mutter in die DDR, um aus dem Traum vom Kommunismus Wirklichkeit werden zu lassen. Er kann in der DDR das Abitur machen und studieren. Mit 21 fängt er an, am Theater zu arbeiten und Lieder und Gedichte zu schreiben. Und er beginnt, sich mit der Obrigkeit in der DDR anzulegen.
Da er in der DDR nicht verlegt wird, veröffentlicht Biermann im Westen. 1965 erscheint im Wagenbach-Verlag die Drahtharfe, was der SED-Führung so wenig passt wie seine Texte.
Beim 11. Plenum des ZK der SED 1965, dem sogenannten Kahlschlag-Plenum, mit seinem Frontalangriff auf alle liberalen, modernen und kritischen Tendenzen in der DDR-Literatur, wird Biermann namentlich an den Pranger gestellt. Er bekommt Berufsverbot. Aber Biermann ist im Osten wie im Westen längst zu bekannt und zu beliebt, als dass die SED ihn mundtot machen könnte.
Er kann in seiner Wohnung im Prenzlauer Berg singen und Schallplattenaufnahmen machen und kann Texte und Musik im Westen erscheinen lassen.
In einem NDR-Interview aus Anlass seines 70. Geburtstags hat Wolf Biermann sehr schön davon erzählt, mit welchen Herausforderungen das verbunden war. Seine Mutter hatte ihm in Hamburg ein hochempfindliches Kondensatormikrofon besorgt, das dann allerdings nicht nur seine Gitarre und den Gesang aufnahm, sondern auch die ganzen Straßengeräusche, die durch die schlecht isolierten Fenster zu hören waren. Als ich dann merkte, dass ich das nicht rauskriege,
kam mir endlich der erlösende Gedanke, dann nehme ich das eben rein. Dann sollen sie doch alle mitspielen, meine Musikanten. Die Straßenbahn, der Hund, das Auto, das ist meine Band. Wir haben nicht so oft geübt, aber wir spielen zusammen. Es war ja auch keine Masche, wie man sagt, sondern ein Beweis für meine wirklichen Lebensumstände, unter denen ich Kunst produzieren muss. Das wär alles drüber.
Eckhard Maas hat erzählt, dass er Anfang der 70er Jahre bei einigen Plattenaufnahmen mit dabei war. Und er erinnert sich auch an Feste, die Biermann in der Chausseestraße 131 gefeiert hat und die er vorzubereiten half. Bei seinen Geburtstagsfeiern kam dann
ein großer Teil dieser DDR-Elite der Intelligenz dort zusammen. Also diese Schriftsteller wie Stefan Heimner und andere. Die Schauspieler kamen dort, Manfred Krug und viele andere vom Berliner Ensemble, die Schauspieler, aber auch seine Freunde, die er so hatte. Also das war eine wunderbare Mischung. Und es war einfach für mich wahnsinnig toll, das mitzuerleben.
Menschlich fühl ich mich verbunden mit den armen Stasi-Hunden, die bei Schnee und Regengüssen mühsam auf mich achten müssen, die ein Mikrofon einbauten, um zu hören all die lauten Lieder, Witze, leisen Flüche auf dem Klo und in der Küche, Brüder von der Sicherheit, ihr allein kennt all mein Leid.
Es war toll, sagt Eckehard Maas. Aber es sei auch allen, die zu Biermann kamen, klar gewesen: Man traf sich da bei einem Regimegegner. Wenn man ihn besuchen ging, musste man ein kleines bisschen Mut haben. Man musste an der Polizei vorbei, die vorm Haus stand. Man musste an dem Stasi-Mann vorbei, der auf dem Treppenabsatz stand. Und es konnte passieren.
Wenn man dann abends nach Hause kam, dass plötzlich hier neben der Haustür hier im Flur plötzlich ein Polizist hinter einer Ecke hervortrat und einen ziemlich deutlich anschrie. Also man machte einem deutlich, wir wissen genau, wo du warst, pass auf, du bist unter Beobachtung.
Ach, mein Herz wird doch beklommen, solltet ihr mal plötzlich kommen, kämmet ihr in eurer raschen Art, Genossen, um zu kaschen, seid zuhause bei meinem Weib, meinen Armen nach den Leib, ohne menschliches Abarmen, grad wenn wir uns umarmen oder irgendwo und wann mit dem Teufel Hafemann.
Eckhard Maas beschreibt, wie die Besucher Wolf Biermanns von der Stasi überwacht wurden. Aber das erste Objekt der Stasi-Aktivitäten in der Chaussée-Straße war natürlich Biermann selbst. Er wurde bewacht, seine Post und seine Telefonate wurden kontrolliert. Es gab Versuche, Freundschaften und Beziehungen zu zerstören. Über die Methoden der Zersetzung, mit denen die Stasi versucht hat, Regimegegner mürbe zu machen, haben wir ja in der letzten Podcast-Folge gesprochen.
Für einen Liedermacher wie Wolf Biermann war es natürlich auch frustrierend, über Jahre von seinem Publikum abgeschnitten zu sein. Im September 1976 nahm er deshalb das Angebot an, in der Nikolaikirche in Prenzlau zu spielen, obwohl er als überzeugter Kommunist Anfragen von kirchlichen Veranstaltern bis dahin immer abgelehnt hatte. Nun spürte er, dass er dort Menschen fand, die seine Kritik am herrschenden Regime teilten, aber verabschiedeten.
Was noch wichtiger war, war die Erfahrung, wieder öffentlich aufzutreten, erzählte er anschließend in einem Telefoninterview mit dem Norddeutschen Rundfunk. Und es war für mich interessant und aufregend, nach so langer Zeit wieder vor so einer großen Menge von Menschen zu singen. Das ist ja doch ein Unterschied.
Denn normalerweise singe ich ja nur vor meinen Freunden oder vor vielleicht 20, 30 Leuten, die mal so irgendwo zusammenkommen. In dieser Situation bekommt Biermann die Genehmigung zu einer Konzerttournee im Westen. Tja, ist natürlich gut gesagt, hierbleiben oder dortbleiben vielmehr. Denn das Dableiben in einem Land, das kann ja sehr Verschiedenes bedeuten.
Eckhard Maas erzählt, dass Biermann und seine Freunde sich damals Gedanken gemacht hätten, was hinter diesem Zugeständnis durch die Staatssicherheit stecken könnte. Ich muss dazu sagen, dass wir schon ein, zwei Tage vorher mit Wolf Biermann zusammengesessen hatten und wir haben darüber gesprochen. Er sagte immer, soll ich fahren, soll ich nicht fahren und so.
Und wir waren an der Meinung, Wolf, die lassen dich nicht wieder zurück. Und Wolf sagte, ich kann aber nicht mehr ein ganzes Leben lang hier in der Stube singen. Also ich bin für Besseres gemacht. Biermann fährt. Am 13. November 1976 gibt er in Köln sein erstes Konzert. Zum ersten Mal singt er dabei das Lied »Der preußische Icarus«, das er für diese Tournee komponiert hat. Da wo die Friedrichstraße sagt, den Schritt über das Wasser macht, da hängt über der Spree.
Die Weidendammerbrücke schön, kannst du da Preußens Adler sehen, wenn ich am Geländer stehe. Viereinhalb Stunden dauert das Konzert von Biermann in Köln. Er genießt es, wieder auf der großen Bühne zu stehen. Die rund 8000 Zuschauer feiern ihn. Am Geländer über der Spree. Oh, wisst ihr was, mein Finger ist jetzt ein bisschen kaputt.
Noch wie bei Icarus folgt auf die Euphorie der Absturz. Am 16. November 1976 wird im DDR-Radio mitgeteilt...
Die zuständigen Behörden der DDR haben Wolf Biermann, der 1953 aus Hamburg in die DDR übersiedelte, das Recht auf weiteren Aufenthalt in der Deutschen Demokratischen Republik entzogen. Es klingt, als habe da ein Bürger der Bundesrepublik das Gastrecht der DDR missbraucht und müsse nun eben die Konsequenzen tragen. Biermann hört die Nachricht in der Bundesrepublik im Autoradio. Das war für mich wie der Tod. Ich war zu Tode erschrocken.
Ich dachte, nun ist alles aus. Er will es nicht wahrhaben. Er will sich wehren. Sein Verlag veranstaltet eine Pressekonferenz, bei der Biermann seine Sicht der Dinge schildert. Ich besitze einen gültigen DDR-Reisepass mit einem Aus- und Wiedereinreisevisum. Ich möchte Ihnen mitteilen, dass ich diese schändliche und schädliche Ausbürgerung nicht hinnehme.
Auch die Freunde Wolf Biermanns in der DDR waren nicht bereit, diese Ausbürgerung einfach hinzunehmen. Dass die SED dazu eine Maßnahme griff, die auch die Nationalsozialisten gegen missliebige Autoren angewandt hatte, empörte viele besonders. Und Eckhard Maas erzählt, ihm sei sofort klar gewesen, das bedeute einen Einschnitt. Nicht nur in der Geschichte der DDR, sondern auch in seinem Leben. Ich griff sofort jetzt, musste ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Angst aufstehen.
oder Rücksicht auf die Familie irgendwas tun. Und dann habe ich das meiner Familie erklärt, dass ich jetzt dort hingehe in die Wohnung, dass es sein kann, dass sie mich verhaften. Ich habe meine Biermannbücher, meine Westbücher versteckt beim Nachbarn hinterm Ofen. Und dann bin ich zur Wohnung gefahren und wusste nicht, wer die Tür aufmacht. Es hätte auch sein können, dass da schon die Stasi saß und sagte, ach, wie schön, dass Sie kommen, wir warten schon auf Sie.
Aber in der Wohnung saßen seine Frauen, mit denen er damals verbunden war, seine Ehefrau Tina Biermann, dann Eva-Maria Hagen mit ihrer Tochter Nina und noch Bülahavemann, mit der er befreundet war. Und die flennten dort vor dem Fernseher. Und ich sagte, wir müssen was tun, wir müssen einen Aufruf schreiben und so weiter. Was soll aus uns noch werden? Uns droht so große Not.
Vom Himmel auf die Erden fallen sich die Engelton. Auch anderswo in Ost-Berlin treffen sich Freunde und Bekannte Biermanns und beraten, was zu tun ist.
Eine Gruppe von zwölf prominenten Autoren formuliert einen Aufruf, den sie an das SED-Parteiorgan Neues Deutschland schicken. Weil er dort nicht gedruckt wird, geben sie ihn weiter an die internationalen Nachrichtenagenturen AFP und Reuters. Darin heißt es, Biermann selbst hat nie, auch nicht in Köln, Zweifel darüber gelassen, für welchen der beiden deutschen Staaten er bei aller Kritik eintritt. Wir protestieren gegen seine Ausbürgerung und bitten darum, die beschlossenen Maßnahmen zu überdenken.
Unterzeichnet war der Aufruf von, jetzt in alphabetischer Reihenfolge, Erich Arendt, Jurek Becker, Volker Braun, Franz Fühmann, Stefan Hermlin, Stefan Heim, Sarah Kirsch, Günter Kunert, Heiner Müller, Rolf Schneider, Christa und Gerhard Wolf.
Auch der Bildhauer Fritz Krämer hatte ursprünglich unterzeichnet. Er hat seine Unterschrift später jedoch auf Druck der Stasi zurückgezogen. Aber 106 andere Künstler schlossen sich der Petition an und 450 weitere DDR-Bürger aus allen Teilen der Bevölkerung. Eckhard Maas hat mir erzählt, dass er damals zu denjenigen gehörte, die weitere Unterschriften sammelten. Und dann bin ich mit dem Fahrrad durch Berlin gefahren und zu den Künstlern.
berühmten bekannten Künstlern und Schriftstellern und Intellektuellen, die ich kannte, und habe von denen die Unterschriften gesammelt unter diese Erklärung. Was noch viel wichtiger war, ich war damals auf Wolf-Biermanns-Rat hin Student geworden der Philosophie an der Humboldt-Universität und dort war man unzufrieden darüber,
dass man nicht lesen durfte, was die führenden Autoren der DDR, die alle in der Partei waren, Volker Braun, Christian und Gerhard Wolf, Rainer Kunze, Sarah Kirsch, die waren alle in der Partei, die hatten diese Erklärung geschrieben, warum dürfen wir die nicht lesen? Das waren ja die Autoren, die überall in den Buchhandlungen lagen. Und ich hatte aber diese Erklärung und es haben dort hunderte Studenten,
diese Erklärung abgeschrieben, ehe die Stasi das mitgekriegt hat und ehe sie eingegriffen hat. Und das war also mein Beitrag sozusagen in dieser Zeit und daraufhin bin ich dann auch vom Studium relegiert worden.
Der DDR-Regimekritiker und Biermann-Freund Robert Havemann kann 1976 trotz des gegen ihn verhängten Hausarrests ein Telefoninterview geben, in dem er die Bedeutung der Reaktionen auf die Biermann-Ausbürgerung beschreibt. Bisher haben wir niemals solch eine Solidarität mit einem Menschen, dem Unrecht getan worden ist.
erlebt in einem solchen Umfang. Das ist ein Politikum ersten Landes. Das erkennt auch die SED-Führung und sie ergreift Gegenmaßnahmen. Tagelang und seitenlang erscheinen im Parteiorgan Neues Deutschland Stellungnahmen prominenter und weniger prominenter Künstler, Intellektueller und anderer DDR-Bürger, die sich gegen Biermann mit dem Regime solidarisch erklären.
Der Beschluss der Regierung der DDR, Wolf Biermann die Staatsbürgerschaft abzuerkennen, ist nur der logische Schlussstrich unter einem Verrat. Er tritt ja nicht als Dichter auf, sondern als Politiker. Und da muss ich sagen, er ist keineswegs mein Genosse, auch nicht mein Freund.
Er ist in der Art, wie er auftritt, mein Gegner. Und dass man mit einem Gegner so verfährt, ist eigentlich nun mal den Gegebenheiten entsprechend. Es ist Klassenkampf, erbarmungsloser Klassenkampf in der Welt. Und da stellt dieser Mann sich auf die andere Seite der Barrikade, nun auch buchstäblich. Unsere Republik hat eine Maßnahme getroffen, die Biermann über sich selbst verhängt hat. Wir können zur Tagesordnung übergehen.
Doch Wolf Biermann ist zu diesem Zeitpunkt schon gar nicht mehr das Problem des Regimes. Es sind die vielen, die sich mit ihm solidarisch erklären. Alle werden unter Druck gesetzt, ihre Unterschriften zurückzuziehen, doch die meisten stehen zu ihrem Wort. Auch die zwölf Schriftsteller, die den Aufruf gegen die Ausbürgerung Biermanns verfasst hatten.
Sie hätten ohnehin damit gerechnet, festgenommen zu werden, erzählte Günther Kunert rückblickend. Und unser Glück war, dass sich dann an diesem Protest so viele andere intellektuelle Künstler, Schriftsteller, Maler, Lektoren angehängt haben. Da hat sich die DDR-Führung gesagt, die Gefängnisse sind ohnehin bei uns schon so voll, die können wir nicht alle einsperren.
Allerdings wird mit den Unterzeichnern je nach Prominenz sehr unterschiedlich verfahren. Stefan Hermlin und Christa Wolf etwa erhalten Parteistrafen und werden eine Zeit lang stärker überwacht, wie Christa Wolf später berichtete.
Das war eine Zeit, in der eine erhöhte Stasi-Bespitzelung usw. da war, die doch auf die Dauer eine Bedrückung gewesen ist. Andere Unterzeichner werden sehr viel stärker unter Druck gesetzt. Manche Autoren werden im Schriftstellerverband der DDR verwarnt, andere werden ausgeschlossen, was praktisch bedeutete, dass sie nicht mehr in der DDR publizieren konnten. Ganze Familien werden von der Stasi ins Visier genommen,
Viele sehen keine andere Möglichkeit mehr als zu emigrieren. Vieles davon hat Eckhard Maas durch seine Freunde und Bekannte hautnah miterlebt. Und er stand ja auch selbst unter verschärfter Beobachtung der Staatssicherheit. Also die unmittelbaren Jahre nach der Ausbürgerung Wolf Biermanns, die waren gezeichnet. Das war eine Eiszeit sozusagen. Das war eine richtige bleiernde Zeit. Und in dieser Zeit hatte ich auch große Angst, weil ich war dann schutzlos.
Zuvor wusste ich immer, wenn mir mal was passiert, dann wird vielleicht Wolf Biermann über seine Verbindungen in den Westen mich unterstützen können. Biermann war weg, also ich hatte diesen Ziehvater verloren und suchte aber dann sofort nach neuen Autoren der älteren Generationen und habe ja dann auch nacheinander, erst habe ich Sarah Kirsch besucht, die ging dann auch in den Westen,
Sarah Kirsch gehörte zu denjenigen, die aus dem Schriftstellerverband ausgeschlossen wurden. Doch nicht das war der Grund für sie, die DDR zu verlassen, erzählte sie später, sondern dass SED und Stasi mit dem Prinzip Sippenhaft arbeiteten.
Sarah Kirsch erfuhr eher zufällig davon, weil eine Freundin ein Praktikum an der Schule ihres Sohnes absolvierte, der damals die zweite Grundschulklasse besuchte. Nein, die Schulleiterin, in dem sie alle Praktikanten mit der Schule vertraut machte, da sagte sie am Schluss, wir haben so und so viele Arbeiterkinder, so und so viele Angestelltenkinder, unsere Schulstruktur reicht von hier aus.
Bis dort und so weiter und so weiter. Und dann haben wir noch den Sohn von Frau Kirsch und mit dem wären wir auch noch fertig. Und als ich das gehört habe, habe ich gedacht, wenn ich mein Kind nicht zweizüngig erziehen muss und kann, dann bleibt mir nichts übrig, als zu gehen. Manchmal fällt auf uns der Frost und macht uns hart. Manchmal fällt auf uns hart.
Andere wurden mit Gewalt aus der DDR hinausgeworfen, so wie Jürgen Fuchs, der zusammen mit Gerolf Pannach und Christian Kunert von der Gruppe Renft ins Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen kam und nach internationalen Protesten im Sommer 1977 unter Androhung langer Haftstrafen in den Westen abgeschoben wurde. Günter Fuchs berichtete das nach seiner Ankunft. Wir sind nicht freiwillig nach West-Berlin gekommen. Über ein Dreivierteljahr hinweg
versuchten wir den widerlichen Methoden der Staatssicherheit unserer feste Absicht entgegenzusetzen, dass wir in der DDR leben wollen, um dort als Künstler mitzuhelfen, eine fortschrittliche, menschenwürdige Gesellschaft zu verwirklichen.
Eckhard Maas hat sich durch sein Engagement für Wolf Biermann eine Karriere in der DDR verbaut. Aber er machte sozusagen aus der Not eine Tugend. In der Nachfolge Biermanns sang er dessen Lieder, aber auch die Lieder russischer Oppositioneller, die er übersetzte. Und er begann zunächst sporadisch mit der Lieder, die er übersetzte.
ab 1979 dann regelmäßig, Lesungen für Autoren und Autorinnen zu organisieren, die mit dem DDR-Regime Schwierigkeiten hatten. Also diese Idee kam mir sofort nach der Ausbürgerung Biermanns, dass man wieder so eine Wohnung schaffen muss, wo Intellektuelle zusammenkommen können und frei miteinander reden können. Und ich komme ja aus einem Land,
malteschen Pfarrerhaushalt, also wo Geselligkeit immer sehr sehr wichtig war und ich habe dafür auch ein Talent, also solche Veranstaltungen zu organisieren und habe mir das dann zu eigen gemacht und wir waren noch nicht richtig eingezogen im März. Also wir hatten die Bücher noch gar nicht ausgepackt. Da fand schon die erste Veranstaltung statt, weil das erste öffentliche Konzert 1978 im März mit Liedern von Bulato Gojava, die ich übersetzt hatte, das wurde verboten
Das sollte im Museum der deutschen Geschichte stattfinden, dort in diesem FTJ-Club, den es da gab. Und dann haben wir die ganzen Leute umgelenkt in diese Wohnung und so begannen dann diese Wohnungslesungen. Seine Wohnung wurde zu einem Treffpunkt der Dichter- und Malerszene vom Prenzlauer Berg. Jüngere Autoren fanden hier ein Forum, aber auch viele der Etablierten kamen zu den Veranstaltungen.
Dann habe ich Christa und Gerhard Wolf kennengelernt, die meinen Salon ja auch unterstützt haben. Ich habe Franz Fühlmann kennengelernt, Volker Braun, Rainer Kirsch, also Elke Erb, also viele, viele Autoren, die dann doch geblieben waren. Das waren ja die Autoren, die dann doch irgendwie auch so
also mit der DDR und dieser Idee der DDR verbunden waren, dass sie hier geblieben waren. Und die habe ich dann zu meinen Salons eingeladen und die waren dann immer so ein kleines bisschen dann auch der Schutz, weil illegale Wohnungslösungen konnten ja auch von der Polizei aufgelöst werden, wie bei meinem Freund Gerd Poppe. Aber wenn Christoph Wolf hier saß, dann wusste ich, dann passiert das nicht.
Aber natürlich wurde Eckhard Maas permanent bespitzelt. In seinen Stasi-Akten konnte er nach der Wende nachlesen, dass die Stadtsicherheit sogar extra eine Wohnung im Haus gegenüber anmietete, um ihn und seine Gäste besser überwachen zu können. Und sie schleuste EMs bei ihm ein. Erst jetzt im Nachhinein, nach der Öffnung der Akten, konnte man sehen, welche Leute es wirklich waren. Und es waren einige Überraschungen dabei. Und ich gebe zu,
dass mir beim Lesen meiner Stasi-Akten die Knie schlotterten, weil ich erst dann begriff, wie hart ich an dem Stasi-Knast vorbeigeschlittert bin. Also ich war, es ging um, im Haaresbreite bin ich dran vorbeigekommen.
Und letztlich hat mein schlimmster Spitzel Sascha Andersson, der mich verraten hat, mich gleichzeitig auch gerettet. Weil er war der einzige Zeuge für meine staatsfeindliche Hetze oder wie auch immer das hieß. Und er war der Stasi so wichtig, dass sie ihn meinetwegen nicht aufdecken wollten. Also sie haben begriffen, dass wenn sie mich verhaften, dann möglicherweise ein Verdacht auf Sascha Andersson fällt. Und das hat mich letztlich dann vor dieser Stasi
Entwicklung dann bewahrt. Du lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit. Die allzu hart sind brechen, die allzu spitz sind stechen und brechen ab sogleich und brechen ab sogleich.
Aber so schwer das in den 70er Jahren auch war, nachträglich bewertet Eckhard Maas den Konflikt zwischen dem Staat und den Künstlern, der mit der Ausbürgerung Biermanns offen aufbrach, positiv. Natürlich war diese Ausbürgerung Biermanns, also für die Entwicklung der DDR, ein Glücksfall, weil endlich mal klare Fronten geschaffen wurden und dieser Nebel, der über der Gesellschaft lag, dieser Nebel, der anbrach,
des Opportunismus, der war plötzlich aufgerissen. Plötzlich waren doch eine ganze Reihe von Leuten, besonders Intellektuelle, hineingestoßen worden, sich zu bekennen. Sie wollten das gar nicht. Viele waren so, dass sie eigentlich ein gutes Auskommen hatten und die konnten ihre Stücke spielen an den Theatern. Viele waren ganz zufrieden mit ihrem kleinen Leben in der DDR und plötzlich kamen
mussten sie sich bekennen und plötzlich kam der Bruch und plötzlich waren viele gezwungen, ein völlig neues Leben zu beginnen. Und das betraf ja nicht nur die Schriftsteller, sondern auch sehr viele darstellende Künstler. Stars, die auf den Bühnen und in Filmen und im Fernsehen in der DDR für alle sichtbar waren und dann von einem auf den anderen Tag verschwanden. Manfred Krug ist ein Beispiel dafür.
Er war ein Nationalpreisträger der DDR, aber nachdem er sich mit Biermann solidarisch erklärt hatte, bekam er kein Bein mehr auf die Erde, sodass er keine andere Möglichkeit sah, als den Ausreiseantrag zu stellen. In den fünf Monaten vorher bin ich in meiner Wohnung auf- und abgerannt und hatte kein einziges Arbeitsangebot. Und am Ende dieser Zeit stand der Entschluss, den Antrag zu stellen.
Natürlich hat mir kein Mensch gesagt, du bist hier gesperrt beim Fernsehen zum Beispiel. Aber die Filme wurden abgesetzt. Filme wurden gar nicht erst gedreht. Manfred Krug konnte sich in der Bundesrepublik eine neue Karriere aufbauen. Auch anderen gelang das aber nicht allen. Für alle aber bedeutete die Immigration einen Bruch in ihrem Leben.
Wolf Biermann schilderte seine Situation 30 Jahre später aus Anlass seines 70. Geburtstags so. Es gelang mir leider nicht.
zu erklären, warum ich wieder zurück in die DDR wollte. Doch nicht, weil ich scharf auf Schläge bin. Ich bin doch kein Masochist. Oder weil ich den Maulkorb vermisse. Trotzdem wollte ich zurück, weil jeder Mensch gern dort ist, wo er das Gefühl hat, dass er etwas Nützliches für andere Menschen tun kann. Was macht denn ein Drachentöter, wenn ihm der Drache geklaut wird? Es dunkelt über Mächte.
Hier gab es auch Ungerechtigkeit und Unterdrückung und alle schlechteren Seiten des menschlichen Lebens, die es eben gibt. Aber in ganz anderer Form. In einer Form, die ich überhaupt nicht durchschaute. Die ich gar nicht erkennen konnte. Das war mein Problem, als ich ausgebürgert wurde. Ich komme von Deutschland nach Deutschland. Ich kann ganz gut Deutsch und verstehe kein Wort.
Und wenn du weg willst, musst du gehen. Ich hab schon viele Abhauen sehen aus unserem halben Land. Ich halt mich fest hier, bis mich kalt dieser verhasste Vogel kreilt und zerrt mich übern Rand.
Eckhard Maas blieb in der DDR. Er hatte keine Lust, in dem aus seiner Sicht zu konsumorientierten Westen zu leben, erzählt er. Vor allem aber sah er eine Aufgabe darin, den unangepassten Autorinnen und Liedermachern weiterhin eine Bühne zu bieten, auch wenn es nicht einfach war. Ja, dass dann diese Freunde, die engsten Freunde in den Westen gingen und man auch immer wusste, dass es jetzt ein Abschied für ewig oder für immer oder für lange Zeit war.
Das war damals sehr, sehr schmerzlich. Und ich habe dieses Lied vom preußischen Icarus mit der dritten Strophe. Und wenn du weg willst, musst du gehen. Ich habe schon viele abhauen sehen aus diesem halben Land. Ich halte mich fest, der bis mich kalt. Dieser verhasste Vogel krallt und zerrt mich über den Rand.
Das habe ich dann immer gesungen und das hatte für mich dann eine viel größere Bedeutung als für Wolf Biermann selber, der ja dann im Westen dann doch sich engagiert hat und mit anderen Themen sich beschäftigt hat. Mit den Ex-Nazis dort in dem politischen Spiel und mit den Grünen und mit der Ökobewegung, Atomkraftbewegung und so weiter und so weiter.
Eckhard Maas wurde Teil einer Oppositionsbewegung, die 1989 schließlich zum Untergang der DDR führte. Dass das möglich wurde, lag auch an internationalen Entwicklungen. Von 1973 bis 1975 tagte in Helsinki die Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, die KSZE.
In der von Warschauer Pakt und westlichen Staaten gemeinsam unterzeichneten Schlussakte wurden nicht nur die Unverletzlichkeit der Grenzen und die Nicht-Einmischung in die inneren Angelegenheiten von Staaten festgeschrieben, sondern auch die Menschenrechte, Grundfreiheiten und eine Kooperation im humanitären Bereich. Und das entwickelte dann eine von vielen ungeahnte Dynamik.
Überall in Osteuropa sahen sich Oppositionelle und Dissidenten gestärkt, weil sie sich auf das KSZE-Dokument berufen konnten. Auch in der DDR. Darum geht es in der nächsten Folge von Deine Geschichte, unsere Geschichte.
Vielen kommt dieser Name sicherlich bekannt vor. Die heute 69-Jährige war eine der führenden Vertreterinnen, als die DDR-Diktatur 1989 schrittweise unter dem Druck ihrer Bevölkerung friedlich zusammenbrach. Schon lange vor dieser Zeit hat sich die gebürtige Rostockerin verstärkt in oppositionellen Kreisen engagiert. Damals steckte die Bewegung allerdings noch in den Kinderschuhen.
Sabine und Katja haben den Podcast diesmal mit uns produziert. Ihr findet, sie finden diese und alle anderen Podcastfolgen in der ARD Audiothek. Fotos, Filme und Texte zu den einzelnen Folgen gibt es unter ndr.de-geschichte. Und über Reaktionen oder Fragen freuen wir uns unter der E-Mail-Adresse deinegeschichte.ndr.de Deine Geschichte in einem Wort, deinegeschichte.ndr.de Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ein Podcast von NDR Info.