
Die 70er: Die Neue Frauenbewegung (5/12)
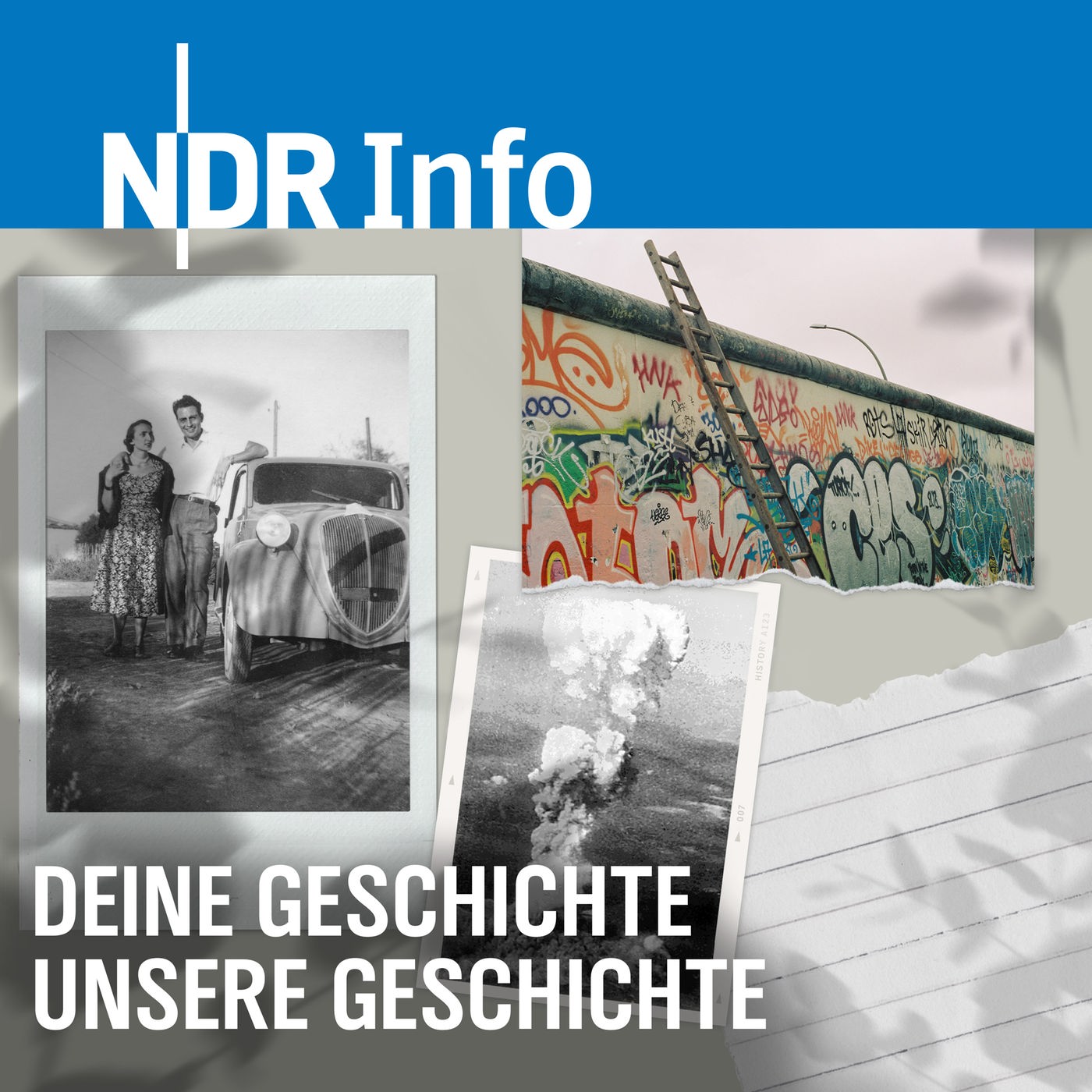
Deine Geschichte – unsere Geschichte
Deep Dive
Shownotes Transcript
Wir wurden als Scheiß im Manzen bezeichnet. Deutschland war ja als Land mit dem schweren Erbe des Faschismus eines der letzten in Europa, wo die Frauenbewegung anfing. Das war ja der Slogan der zweiten Frauenbewegung. Das Private ist politisch. Dass die Frau während des Bestehens der Ehe total rechtlos gegenüber ihrem Mann ist. That's just the way it is, when you're a woman, man's world.
Frauen dahingehend zu unterstützen, dass die Abtreibungen auch so ablaufen, dass es nicht zu gesundheitlichen Schädigungen kam. Die Polizei forderte mich auf, doch gefälligst wieder nach Hause zurückzugehen, denn der Mann hätte das Recht, das zu bestimmen. Was heute für viele junge Menschen als selbstverständlich gilt, dass das etwas ist, was durch soziale Bewegungen hart erkämpft worden ist.
Also ich habe dadurch sicherlich auch meine Stärke gezogen. Deine Geschichte, unsere Geschichte. Ein Podcast von NDR Info. Deine Geschichte erzählt dein Leben. Unsere Geschichte erzählt von unser aller Leben. Ich habe Zeitzeugen gefragt. Ich habe in den Tonarchiven recherchiert. Deine Geschichte, unsere Geschichte.
Die 70er, Folge 5, die neue Frauenbewegung. Willkommen zu einer neuen Folge unseres Geschichtspodcasts mit Ulrike Bosse und Franziska Ammler. Es geht, meine ich, um ein Problem des menschlichen Zusammenlebens, das für unsere Zukunft so bedeutungsvoll sein wird wie die Herbeiführung sozialer Gerechtigkeit oder die Aussöhnung der Völker. Es geht um einen Konflikt,
der lange im verborgenen privaten Bereich ablief, nun aber ins allgemeine Bewusstsein gehoben worden ist und da er bisher nicht auf evolutionäre Weise befriedigend gelöst wurde, drängt er plötzlich zu einer revolutionären Lösung. Nicht, noch nicht bei uns, aber in einer Reihe anderer Länder.
Das sagte der Publizist Axel Eckebrecht im Jahr 1970 in einer seiner Kolumnen. Wenig später bahnte sich aber auch in der Bundesrepublik an, was er die Revolution der Frauen nannte. Es war ein ganz tolles Gefühl natürlich, jetzt plötzlich eine Stimme zu haben. Eine Stimme mit vielen anderen Frauen und in der Öffentlichkeit auftreten zu können. Musik
Und ich glaube, dass es für viele von uns bedeutet hat, gerade die Frauen, die etwas älter waren als ich, für die war das, glaube ich, nochmal ein sehr starker Anschub, auch ihr Selbstbewusstsein zu stärken. Und auch für mich war das so. Also ich habe dadurch sicherlich auch meine Stärke gezogen, zum Beispiel auch in Bezug auf meine eigene Biografie und in Bezug auf meine berufliche Entwicklung.
Unsere Zeitzeugin Angelika Henschel war eine derjenigen, die sich an dieser Revolution, wie Axel Egebrecht die neue Frauenbewegung nannte, beteiligt hat. Sie ist eine wirklich beeindruckende Frau, heute 65 Jahre alt, Professorin an der Leuphana-Universität in Lüneburg. Getroffen habe ich sie in ihrem Arbeitszimmer in ihrer Heimatstadt Lübeck.
Dort hat sie sich schon in ihrer Schulzeit für andere Frauen eingesetzt und die Thematik hat sie bis heute nicht mehr losgelassen, wie sie mir erzählt hat. Ein Forschungsschwerpunkt von ihr ist nach wie vor Gewalt in Geschlechterverhältnissen. Als Beginn der neuen Frauenbewegung in Deutschland gilt der Tomatenwurf von Sigrid Rüger beim Kongress des Sozialistischen Studentenbunds des SDS am 13. September 1968.
In der Studentenbewegung war viel von Emanzipation und Befreiung die Rede, aber es waren Männer, die das große Wort führten. Von den Frauen erwarteten die revolutionär gesinnten Männer genau wie ihre bürgerlichen Geschlechtsgenossen, dass sie sich um Haushalt und Kinder kümmerten. Aber Pädagogen?
Wie gehen politische Aktivität und Kinderbetreuung zusammen? Vor dem Hintergrund dieses Konflikts hatte sich in West-Berlin der Aktionsrat zur Befreiung der Frau gegründet. Als seine Vertreterin hielt Helke Sander beim SDS-Kongress in Frankfurt am Main eine Rede, in der sie die Ausbeutung der Frau im privaten Bereich anprangerte. Doch die SDS-Männer waren nicht bereit, darüber zu diskutieren.
Woraufhin die Romanistik-Studentin Sigrid Rüger Tomaten auf die Bühne warf, um den Anliegen der Frauen Aufmerksamkeit zu verschaffen. Die Frauen merkten, dass es nicht genügte, dass die erste Frauenbewegung das Wahlrecht erkämpft hatte. Und dass es auch nicht genügte, dass im Grundgesetz stand, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Es ging darum, was das letztlich in ihrem Alltag bedeutete, auch für Angelika Henschel. When you're a woman in a man's world.
Das war ja der Slogan der zweiten Frauenbewegung. Das Private ist politisch und von daher wurden zu Beginn die privaten Verhältnisse in den Blick genommen. Zuerst in den Wohnzimmern, in denen man sich traf, später dann in Frauenzentren, die man errichtete. Und durch die Erzählungen der Frauen wurde deutlich, dass sie sich in vielen Teilen der Gesellschaft noch ausgegrenzt diskriminiert fühlen und eben nicht gleichberechtigt fühlen.
Und das ist vielleicht etwas, was man sich heute so nicht mehr vorstellen kann. Aber damals war das eine Erfahrung von vielen Frauen, die älter waren als ich. Denn ich war die Jüngste damals, die mitmachte sozusagen in der Gruppe der Frauen. Und ja, das hat sehr geprägt. I say it's white, he says it's black.
Viele Frauen haben berichtet über Auseinandersetzungen in ihrer häuslichen Sphäre, auch mit dem eigenen Partner. Es kam zu ersten Trennungen, zu Scheidungen, das war Thema. Aber es war auch Thema vor allem das, was zunehmend dann auch durch die zweite Frauenbewegung in die Öffentlichkeit gebracht wurde, nämlich die Thematik nicht nur Gewalt in Geschlechterverhältnissen, sondern vor allem auch das Thema Selbstbestimmung über eigene Sexualität und Reproduktion.
Und damit rückte der Paragraf 218 in den Blick, der ja bis heute ein Thema der Frauenbewegung ist und schon in der ersten Frauenbewegung Thema war. Am 5. April 1971 sorgt das Nachrichtenmagazin Nouvelle Observateur für Schlagzeilen weit über die Grenzen Frankreichs hinaus.
343 Frauen, darunter Prominente wie die Schriftstellerin Simone de Beauvoir oder die Schauspielerin Catherine Deneuve, bekennen, ich habe abgetrieben. Und sie fordern dieses Recht für jede Frau.
Zwei Monate später erscheint ein vergleichbarer Artikel von 374 deutschen Frauen im Magazin Stern. Auch hier mit prominenten Unterzeichnerinnen wie den Schauspielerinnen Romy Schneider oder Senta Berger. Die Kernaussage hier, ich bin gegen den Paragrafen 218 und für Wunschkinder. An das Cover kann ich mich noch erinnern und ich weiß, dass es...
aber dann auch erst mal wieder weg war für mich. Da war ich noch ein Tick zu jung. Organisiert hatte die Sternaktion die Journalistin Alice Schwarzer. Ich habe damals in Paris gelebt und ich komme eigentlich aus der französischen Frauenbewegung. Ich habe da gearbeitet als Korrespondentin und die Französinnen haben das gemacht, diese Aktion.
Ich habe also einen Funken geworfen. Die Frauenbewegung wäre auf jeden Fall gekommen, auch nach Deutschland. Deutschland war ja als Land mit dem schweren Erbe des Faschismus eines der letzten in Europa, wo die Frauenbewegung anfing. Aber das hätte auch angefangen. Nur ich habe diese Sache importiert und dadurch ist das losgetreten worden, wenn Sie so wollen.
Wer das Abtreibungsverbot des Paragrafen 218 missachtete, dem drohten damals bis zu fünf Jahre Gefängnis. Aber die Sternaktion blieb für die meisten beteiligten Frauen folgenlos. Hier zeigt sich die Kraft des Kollektivs, das die einzelnen Frauen schützte.
Einen guten Monat nach dem Stern-Artikel wurde die Kampagne überdies fortgesetzt mit 3000 Selbstanzeigen, wobei gar nicht alle daran beteiligten Frauen tatsächlich abgetrieben hatten. Außerdem wurden 86.000 Solidaritätsunterschriften an den Bundesjustizminister übergeben. Und es kam zu Massendemonstrationen mit dem Slogan »Mein Bauch gehört mir«.
Die Angst, ungewollt schwanger zu werden, hat natürlich auch Angelika Henschel und ihre Mitstreiterin beschäftigt. Denn Empfängnisverhütung war damals nicht so einfach. Vor allem auch deshalb, weil es klar war, dass es ein Problem ist, das dann sozusagen ja immer nur die Frauen haben.
Und wir müssen uns auch klar machen, dass in Bezug auf die Verhütung die Pille zum Beispiel ja, die Einführung der Pille Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre vor allem erst, also zumindest im Westen, nur den Frauen zugänglich war, die verheiratet waren. Andere Frauen haben ja im Westen, das war anders in der ehemaligen DDR, gar keinen Zugang zur Pille gehabt.
Und das bedeutete, man sollte eben keinen Sex vor der Ehe haben. Das war natürlich die Idee, die dahinter stand, dass das nicht mehr klappte nach den 68ern und dem Aufbruch und der Zunahme auch der freien Sexualität und der Selbstbestimmung von Frauen, die ja immer mehr zunahmen, auch über ihren Körper und ihre eigene Sexualität, war klar.
In der DDR wurde im März 1972 für Abtreibungen eine Fristenlösung bis zur 12. Woche eingeführt. Für die Zeit danach galt dort eine Indikationslösung aus medizinischen oder schwerwiegenden Gründen. Auch in der Bundesrepublik galt eine Reform des Paragrafen 218 längst als überfällig. Nachdem sich lange nichts getan hatte, wurde sie durch die Aktionen der Frauen vorangetrieben.
Am 18. Juni 1972 verabschiedete die sozialliberale Koalition eine Fristenlösung, die nach einer Beratung Straffreiheit für Schwangerschaftsabbruch bis zur 12. Woche vorsah. Nach einer Klage von CDU, CSU-Abgeordneten und Landesregierungen erklärte das Bundesverfassungsgericht dieses Gesetz aber für verfassungswidrig.
Bundesjustizminister Hans-Jochen Vogel von der SPD äußerte sich anschließend enttäuscht, auch wenn er erklärte, dass die Bundesregierung das Urteil und seine Begründung selbstverständlich respektiere.
Dessen unbeschadet hält sie jedoch die von ihr zur Rechtfertigung der Verfassungsmäßigkeit der Fristen- und Beratungsregelung vorgetragenen Argumente, nämlich, dass über die Schutzwürdigkeit auch des ungeborenen Lebens kein Streit bestehe, dass dieser Schutz auf dem Wege der Beratung an der sozialen Hilfen mit dem Willen der schwangeren Frau besser verwirklicht werden könne, als auf dem Wege einer Strafdrohung vom ersten Tage an gegen den Willen der Frau,
dass jede Gesetzesänderung dazu führe, dass im Einzelfall bisher gewährter Schutz entfalle, in anderen Fällen jedoch bisher schutzlos gelassenes Leben geschützt werde und die Fristenregelung insgesamt die Zahl der Abbrüche nicht erhöhen, sondern auf längere Sicht sogar senken würde, dass sie die Zahl der illegalen Abbrüche und die mit diesen verbundenen Gefahren für Leben und Gesundheit der Frauen fühlbar vermindern würde,
Und dass diese Regelung mit ähnlichen Reformen in Österreich, England, Schweden, Dänemark, Frankreich und den USA und folglich auch mit der europäischen Rechtsentwicklung im Einklang stünde und verändert für stichhaltig und schlüssig.
Gleichwohl musste entsprechend den Vorgaben des Gerichts ein neues Gesetz formuliert werden. Im Juni 1976 wurde ein Indikationenmodell verabschiedet. Bundesjustizminister Hans-Jochen Vogel drückte sich da in schönstem Juristendeutsch etwas schwer verständlich aus. In der Sache entspricht es dem, was Angelika Henschel erzählt. Die Frauen wollten, dass der Paragraf 218 abgeschafft wird und nachgegeben,
Und nach dem Spruch des Bundesverfassungsgerichts war das Thema für sie durchaus nicht einfach erledigt. Das hätten sie auch in ihrer Frauengruppe gemerkt. Also ab Mitte der 70er Jahre, muss ich sagen. Und da hat uns das sehr stark beschäftigt, diese Thematik.
Weil wir dann auch in der Gruppe natürlich Frauen hatten, die selbst Abtreibungen haben vornehmen lassen und auch noch berichteten, unter welchen schrecklichen Bedingungen das alles vonstatten ging. Wir hatten eine Ärztin in der Gruppe, die versucht hat, Frauen dahingehend zu unterstützen, dass die Abtreibungen auch so ablaufen, dass es nicht zu gesundheitlichen Schädigungen kamen.
Wir haben dann mitbekommen, dass die ersten Busse nach Holland fuhren, nach Großbritannien, nach London, um den Frauen, die hier in der Bundesrepublik nicht die Möglichkeit hatten, Abtreibung legal durchführen zu lassen, durch die Frauengruppen bundesweit dann über diese Busse und die Aktionen geholfen, sozusagen diesen Weg zu gehen und Abtreibung vornehmen zu lassen im Ausland, weil das hier nicht möglich war.
Der Kampf gegen den Paragrafen 218 war ein großes Thema der Frauenbewegung. Ein anderes, das bis dahin kaum öffentlich thematisiert worden war, war Gewalt gegen Frauen. Viele der Frauen aus ihrer Frauengruppe seien damit in ihrem beruflichen Alltag konfrontiert worden, erzählt Angelika Henschel. Also sie arbeiten zum Beispiel in der Klinik und hatten immer mal wieder mit Frauen zu tun, die misshandelt worden waren und in der Klinik gelandet waren und verletzt.
All diese Erfahrungen, die Thema waren in der Frauengruppe, neben dem Lesen von Literatur in der Zeit, haben uns beschäftigt und haben eben dazu geführt, dass wir irgendwann auch an einen Punkt gekommen sind, wo wir gesagt haben, das reicht nicht, darüber zu reden, sondern wir wollen etwas tun. Und wir wollen versuchen, die Situation für Frauen zu
auch in der Stadt, in der ich lebe, also in Lübeck, zu verändern. Dass Frauen damals kaum eine Chance hatten, sich gegen innerfamiliäre Gewalt zu wehren, wird in den Aussagen aus einer NDR-Sendung aus dem Jahre 1975 deutlich. In der Bundesrepublik fing die öffentliche Debatte darüber da gerade erst an.
Wie wenig Verständnis die Frauen für ihre Situation fanden, zeigt die Aussage einer Katharina aus dem gutbürgerlichen Westberliner Stadtteil Dahlem über die Reaktionen einer Nachbarin, der sie ihr Leid klagte. Da war deren Reaktion, dass sie sich totgelacht hat und gesagt hat, Mensch, darüber regst du dich auf? Das passiert doch jeder Frau mal und fügt dich doch ein bisschen.
Das damals geltende Recht bot den Frauen keinen Schutz, wie die Rechtsanwältin Alexandra Goy in der Sendung erläuterte. Im Ergebnis ist meines Erachtens dann festzustellen, dass die Frau im Verhältnis zu ihrem Ehemann, das heißt also während des Bestehens der Ehe, total rechtlos gegenüber ihrem Mann ist. Das Einzige, wie sie sich dem Problem entziehen kann, ist eben das der Flucht.
Keine öffentliche oder staatliche Behörde wird ihr dabei behilflich sein. Im Gegenteil, die wird ihr noch einen Stein in den Weg legen. Diese Erfahrung musste auch Katharina aus Berlin-Dahlem machen, die im Unterschied zu vielen Frauen damals eine qualifizierte Ausbildung hatte und sich heimlich eine Arbeitsstelle in Westdeutschland suchte, um der Ehehölle zu entkommen. Ich habe dann diese Arbeit bekommen, habe mein damals wenige Monate altes Kind genommen.
und wollte nach Westdeutschland fliegen. Und auf dem Flugplatz wurde ich schon in Empfang genommen von meinem damaligen Mann und der Polizei, die mir das Kind abnahm. Und die Polizei forderte mich auf,
auf meinen Protest hin, doch gefälligst wieder nach Hause zurück zu gehen, denn der Mann hätte das Recht, das zu bestimmen und sie müssten mir leider das Kind wegnehmen. Ich habe so verzweifelt gebettelt und habe gesagt, ich werde geschlagen und ich kann das nicht und ich halte das nicht mehr aus und habe nur die Axt abgezogen.
Eine Chance zu entkommen oder womöglich gar durchzusetzen, dass der Mann ausziehen muss, damit Frau und Kinder weiterhin ein Dach über dem Kopf haben, das gab es nur, wenn die Frauen Zeugen für die Gewalttätigkeit ihres Mannes hatten oder diese durch Verletzungen dokumentieren konnten.
Was aber auch nicht so einfach war, wie eine Frau namens Sigrid in der Radiosendung von 1975 erzählte. Außerdem habe ich auch schon von anderen Leuten gehört, dass glattweg der Arzt gesagt hat, sie sind wohl die Treppe runtergefallen, anstatt dass jemand sie geschlagen hat. Die Frau wird wirklich unglaublich.
Diese Erfahrung musste auch Katharina mit ihrem gutbürgerlichen Mann machen, als sie ein Attest über ihre Verletzungen vorlegte. Und dann ist was ganz Gespenstisches passiert. Der Anwalt meines Mannes hat, nachdem das Attest vorgelegt wurde, die Behandlung.
Und hat gesagt, ja, ja, der Arzt hat zwar diese Verletzung festgestellt, aber wer beweist denn, dass diese Frau nicht bei lesbischen Spielen sich diese Verletzung zugezogen hat. Und das war natürlich der Hammer.
So etwas kann ich mir zum Glück heute gar nicht mehr vorstellen. Aber es sind Beispiele wie diese, durch die man wirklich nachvollziehen kann, warum sich Angelika Henschel und andere Frauen engagiert haben, um etwas zu verändern. Zumal die Erfahrungen mit Gewalt in der eigenen Ehe damals offenbar tatsächlich nicht nur das Schicksal einiger weniger Frauen waren. Ich erinnere Szenen, wenn wir zum Beispiel in den 70er Jahren waren,
mit unseren Tischen in der Innenstadt standen, um auf die Thematik aufmerksam zu machen. Wie viele alte Frauen an die Tische gekommen sind und zu uns gesagt haben, wenn ich damals schon die Möglichkeit gehabt hätte, irgendwo hin zu fliehen, Schutz zu erhalten, wie ihr das jetzt hier macht mit eurem Frauenhaus. Ich wäre weg gewesen. Und so habe ich jetzt bis ins hohe Alter die Gewalt meines Mannes erfahren müssen.
All solche Dinge, die kann man sich heute nicht mehr so ohne weiteres vorstellen, denke ich. Aber das waren sehr einschneidende Erlebnisse, die uns sehr einerseits betroffen gemacht haben, natürlich solche Erzählungen, auf der anderen Seite aber sehr gestärkt haben in Bezug auf die Veränderungsprozesse, die wir damit durch anstoßen wollten und durch unseren Kampf und die Errichtung von unterschiedlichsten Beratungsstellen, Frauenhäusern und so weiter.
In den USA und einigen westeuropäischen Ländern gab es schon Frauenhäuser, in die sich Frauen mit ihren Kindern flüchten konnten. Das erste Frauenhaus der Bundesrepublik wurde 1976 in Berlin eröffnet.
Ein Jahr später, 1977, hat Angelika Henschel zusammen mit anderen Frauen den Verein Frauen helfen Frauen Lübeck gegründet. 1978 wurde dann das erste Frauenhaus in Lübeck eröffnet, das allererste in Schleswig-Holstein überhaupt übrigens. Angelika Henschel war da gerade mal 20 Jahre alt.
Dass sie sich trotz dieses jungen Alters schon für und mit anderen Frauen engagiert hat, begründet sie auch mit eigenen Erfahrungen. Es ist nicht das erste Mal gewesen, dass ich damit in Kontakt gekommen bin, weil meine eigene Geschichte auch ein Stück weit eine Gewaltgeschichte ist.
Und von daher war mir das auch von meiner persönlichen Biografie hier nicht fremd, die Auseinandersetzung mit der Thematik Gewalt. Wobei sie dann doch auf meine Frage hin ins Nachdenken kommt, wie sie damals in so jungen Jahren eigentlich fertig wurde mit allem, was sie erlebt, gesehen und gehört hat.
Sie habe nicht viel gegrübelt, sondern einfach gemacht, sagt sie, angetrieben von dieser Aufbruchsstimmung, die damals herrschte. Ich weiß nicht, es ist mir damals als junge Frau, denn ich bin ja als ehrenamtliche Mitarbeiterin im Frauenhaus dann auch permanent konfrontiert gewesen mit auch zum Teil sehr erschreckenden, gewaltförmigen Erlebnissen, die die Frauen und ihre Kinder erlebt hatten und die sie schilderten und wo sie Unterstützung brauchten.
Aber durch diesen Zusammenhalt und durch die Vorstellung, dass wenn wir jetzt hier gute Arbeit machen, wir nicht nur den Frauen ganz konkret helfen im Sinne von unmittelbarer sozialarbeiterischer Tätigkeit, sondern damit auch weiterhin in die Öffentlichkeit gehen mit dieser Thematik und versuchen, die gesamtgesellschaftlichen Verhältnisse zu verändern, um mehr Geschlechtergerechtigkeit zu erreichen,
All das waren Themen, die einen auch so beflügelt haben und angespornt haben, sich einzusetzen, tätig zu werden. Und vielleicht hat man deshalb es auch gut verkraftet, mit diesen Geschichten klarzukommen. Wobei das natürlich kein leichter Kampf war, dass sie mit dem Thema Gewalt gegen Frauen in die Öffentlichkeit ging, sei in Lübeck gar nicht gern gesehen worden, erinnert sie sich. Da ist uns auch viel passiert.
Ja, das ist ein sehr interessantes Thema.
Und wir bräuchten uns nicht einbilden, dass sie ein solches Unterfangen wie ein Frauenhaus finanziell unterstützen würde.
Es hat dann noch bis 1997 gedauert, bis Vergewaltigung in der Ehe als Verbrechen klassifiziert wurde. Dass es aber so kam, verbucht Angelika Henschel als Erfolg der Frauenbewegung. Auch, dass bei Scheidungen das Schuldprinzip aufgehoben wurde. Denn bis dahin war es Frauen ja gar nicht möglich, ohne weiteres sich scheiden zu lassen, weil sie fürchten mussten, dass sie sich nicht mehr verheiratet haben.
Denn der Gesetzgeber hatte ja auch bis in den Anfang der 70er Jahre hinein das Schuldprinzip sozusagen bei den Scheidungen auch immer wieder durchgeführt. Und das hatte bedeutet für Frauen, dass sie zum Teil das Sorgerecht für ihre Kinder verloren haben oder eben auch keine Unterhaltszahlung erhielten, wenn sie die Scheidung einreichten mussten.
All das waren Themen, mit denen wir unmittelbar konfrontiert waren, auch in den Frauengruppen, in denen ich tätig war, weil das die Frauen selbst betraf. Also von daher war es wirklich so, das Private wurde politisch und wurde zum Thema gemacht.
Ganz allmählich veränderten sich die Verhältnisse. Die Bildung der Frauen wurde besser, die Frauen heirateten später, mehr Frauen wurden berufstätig, wobei die mangelnden Angebote zur Kinderbetreuung der Berufstätigkeit von Müttern dann sehr schnell wieder Grenzen setzten.
Da hinkte die Bundesrepublik der DDR um Jahrzehnte hinterher. Die Frauen in der DDR sahen sich sehr viel eher als gleichberechtigt, was allerdings nichts daran änderte, dass auch dort die Frauen trotz Berufstätigkeit einen Großteil der Familienarbeit verrichteten und die Politik in erster Linie von alten Männern bestimmt wurde.
Eine Neufassung des Paragrafen 218, der Kampf gegen Gewalt in der Ehe, ein modernes Scheidungsrecht, das waren, wie wir gehört haben, wichtige Themen für die neue Frauenbewegung in der Bundesrepublik. Aber sicher ebenso wichtig und vielleicht sogar noch tiefgreifender war die Veränderung des Selbstbilds der Frau.
Die Frauen definierten sich nicht mehr primär über ihre Beziehung zu Männern. Sie interessierten sich für die Geschichte der Frauen. Sie lasen Literatur, die sich mit der Rolle der Frau auseinandersetzte. Die Vorbilder kamen aus den USA oder Frankreich. Betty Friedan, Weiblichkeitswahn, Kate Millett, Sexus und Herrschaft oder Simone de Beauvoir, das andere Geschlecht.
Angelika Henschel erzählt, dass sie in ihrer Frauengruppe neben theoretischen Schriften auch sehr viel Frauenliteratur gelesen hätten.
Dann in dieser Reihe mit regelmäßigen Veröffentlichungen »Frauen« hat zu Wort kommen lassen mit ihren Geschichten, auch in Romanform in der Zeit.
Und zur intellektuellen Auseinandersetzung sei dann wieder die Praxis gekommen. Wir haben dann gleichzeitig neben der Vereinsgründung und der Eröffnung des Frauenhauses auch hier in Lübeck noch die sogenannte Alternative gegründet. Also das heißt, ein Riesenhaus in der Altstadt, das dann auch renovierungsbedürftig war, das wir angemietet haben, das wir untervermietet haben als Verein, dann an andere Gruppierungen, sodass dort dann viele Frauengruppen zum Beispiel sich treffen konnten.
dass es zu einem Frauenzentrum wurde, in dem verschiedene Themen behandelt wurden, aber auch die Jugendkultur in der Zeit. Musik
Was Angelika Henschel aus Lübeck berichtet, passierte auch an vielen anderen Orten in der Bundesrepublik. Es bildete sich eine feministische Gegenkultur heraus. Mit den Frauenzentren, mit Frauenbuchläden und Frauencafés. Im Januar 1977 erschien erstmals das von Alice Schwarzer herausgebrachte feministische Magazin »Emma«.
Frauen mit sehr unterschiedlichen Interessen engagierten sich. 1977 gab es bei der ersten Berliner Frauenkonferenz erstmals den Versuch einer Verständigung zwischen autonomen Frauengruppen und traditionellen Frauenverbänden, etwa in den Parteien oder Gewerkschaften. Auch die Lesbenbewegung bildete sich Anfang der 70er Jahre und wurde in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts in der Frauenbewegung sichtbarer.
Was dies für sie bedeutet hat, schilderte eine der Frauen in einer Radiosendung aus dem Jahr 1974 so. Für mich war lesbisch zu sein eine Bedrohung. Das war etwas, worüber man nicht sprach, was gar nicht öffentlich werden durfte, wo man also ständig ein schlechtes Gewissen darüber hatte, wo man sich ganz schlecht und mies vorkam. Und jetzt also den Sprung zu machen, zum ersten Mal in der Gruppe darüber zu sprechen,
Und zwar Anfeindungen zu erfahren,
aber doch auch Bestätigung und die Bildung einer Gruppe zu erleben und dann plötzlich darüber sprechen zu lernen, wie man eben über alle Dinge ganz normal sprechen kann und also diese Befreiung zu erleben, das ist fast ein nicht beschreibbarer Prozess, den man da macht. Und wenn eine Frau eine Frau liebt, soll sie sie lieben, wenn sie sie liebt.
Angelika Henschel hat mir erzählt, dass es Männer in ihrem Umfeld gegeben habe, die sie unterstützt haben, etwa bei der Renovierung des Frauenhauses.
Sie hätte aber auch eine ganze Menge Anfeindungen erlebt, vor allem draußen auf der Straße. Ja, wir wurden als scheiß Emanzen bezeichnet, um diesen Aufdruck mal zu benutzen, die auf die Straße gehen, weil sie keinen abgekriegt haben, keinen Mann abgekriegt haben. All solche Äußerungen mussten wir uns damals anhören und beobachten.
Das wird sich heute nicht so ohne weiteres getraut, wobei es natürlich auch innerhalb unserer Gesellschaft nach wie vor viel Frauenverachtung gibt und sich auch gerade die Maskulinistenbewegung wieder sehr stark macht, um Frauen weiterhin zu Opfern werden zu lassen und zu Opfern zu machen.
Und sie herabzuwürdigen. Und nach wie vor sitzen weniger Frauen in den Parlamenten und in den Führungsetagen der großen Unternehmen. Nach wie vor verdienen Frauen weniger als Männer. Nach wie vor gibt es in vielen Familien eine Arbeitsteilung zulastender Frauen. Auch das Thema Gewalt ist weiterhin aktuell. Laut einer Studie wird jede vierte Frau in einer Partnerschaft Opfer von Übergriffen. Frauenhäuser bieten zu wenig Plätze und sind nach wie vor unterfinanziert.
Dabei ist seit dem Kampf von Frauen wie Angelika Henschel viel, sehr viel Zeit vergangen. Sie selbst sagt, dass sie nicht erwartet hätte, dass manche Anliegen von damals jetzt noch immer ein Thema sein würden. Man muss sich ja klar machen, dass viele der heutigen Initiativen von Frauen und auch jungen Frauen, also zum Beispiel die ganze MeToo-Debatte,
dass das Debatten sind, die wir schon in den 70er Jahren geführt hatten. Wir hatten nur nicht die Medien zur Verfügung, um eine solche Öffentlichkeit zu erzeugen, wie das heute der Fall ist. Und natürlich hätten wir uns nicht vorstellen können in den 70er Jahren, dass das
im Jahr 2022 alles immer noch so diskutiert werden muss, dass wir heute darüber sprechen, wie sich sexuelle Belästigung nach wie vor im Arbeitsleben ergibt, sexuelle Belästigung auf der Straße, wie auch immer. All das hatten wir natürlich erhofft durch die Öffentlichkeitsarbeit, die wir gemacht haben zu dieser gesamten Thematik, durch die politischen Kämpfe, die wir geführt haben, dass sich das irgendwann erledigt haben könnte.
Aber sie sieht eben auch das, was erreicht wurde an gesellschaftlicher Emanzipation. Eben nicht nur durch die Studentenbewegung, sondern auch durch die zweite Frauenbewegung. Das wäre alles nicht möglich gewesen ohne den Kampf der Frauen. Und deshalb ist es mir auch zum Beispiel bis heute ein großes Anliegen, im Rahmen meiner Veranstaltung und im Rahmen meiner Lehre auch an der Universität deutlich zu machen, dass das nichts ist, was immer da war, sondern dass das etwas ist, was durch soziale Bewegungen hart erkämpft worden ist.
was heute für viele junge Menschen als selbstverständlich gilt, was vorhanden ist. Zum Beispiel, dass Frauen einer Erwerbstätigkeit nachgehen, ganz selbstverständlich, dass sie akademische Abschlüsse haben, dass sie in Bezug auf die Thematik Gewalt und Selbstbestimmung über ihren Körper heutzutage andere Möglichkeiten haben, als es damals der Fall war.
Das Leben der Frauen hat sich verändert durch die Frauenbewegung ab den 70er Jahren. Nicht weniger verändert hat sich seit damals das Leben der homosexuellen Männer. Denn auch die begannen in den 70er Jahren, sich zu organisieren und Gleichberechtigung einzufordern. Um die Anfänge der Schwulenbewegung geht es in der nächsten Folge von Deine Geschichte, unsere Geschichte. Musik
Unser Zeitzeuge ist dann Thomas Grossmann, der sich damals als junger Mann eben nicht mehr verstecken, sondern ganz offen seine Sexualität ausleben wollte mit allem, was dazugehört. Und so wurde er damals aktiv in der Hamburger Schwulenbewegung.
Christine und Jonas haben den Podcast diesmal mit uns produziert. Alle Podcast-Folgen finden Sie, findet ihr in der ARD Audiothek. Und Fotos, Filme und Texte zu den einzelnen Folgen gibt es unter ndr.de-geschichte. Über Lob und Kritik freuen wir uns unter der E-Mail-Adresse deinegeschichte.ndr.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.