
Die 70er: Die RAF (7/12)
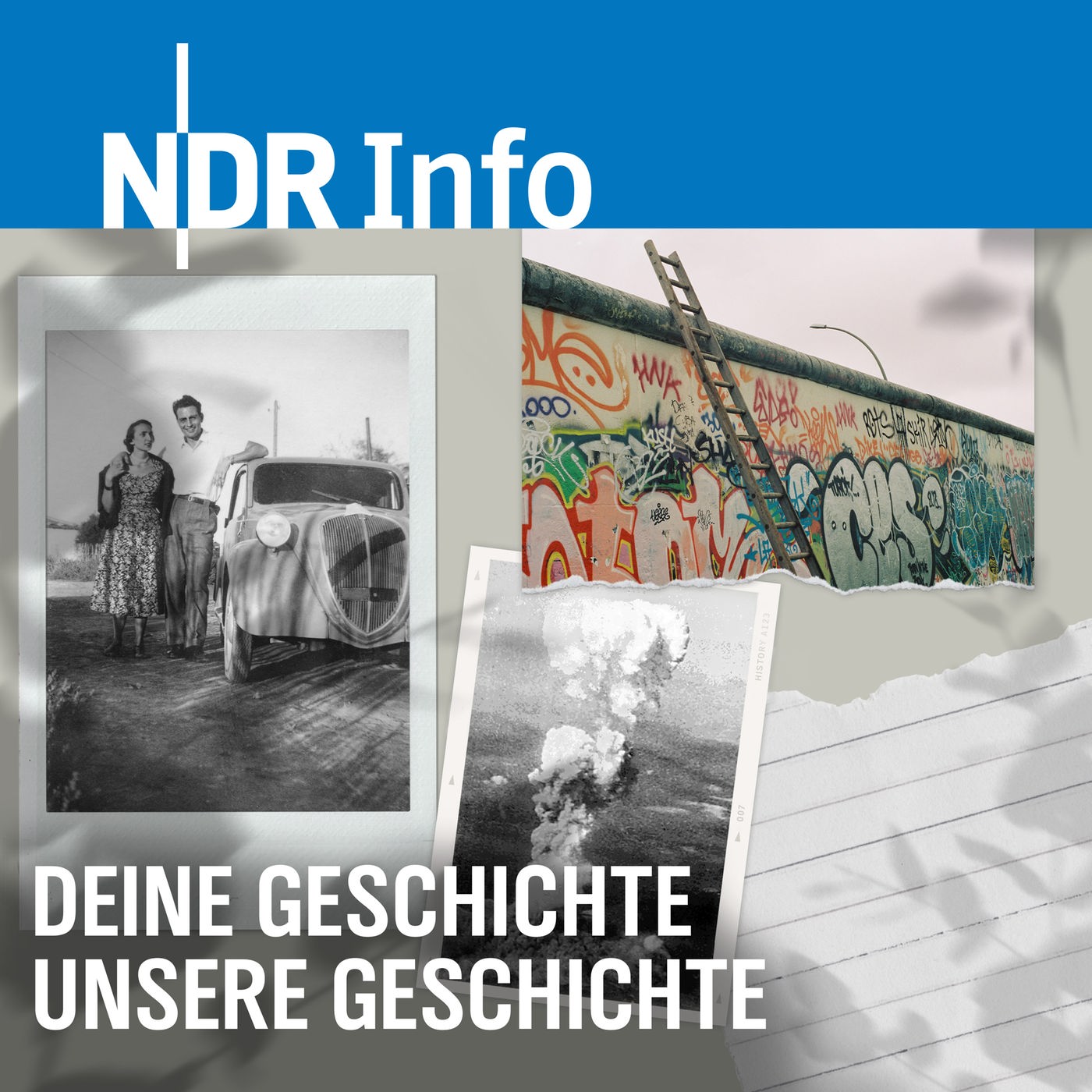
Deine Geschichte – unsere Geschichte
Deep Dive
- Ulrike Meinhofs Spiegel-Interview als Wendepunkt
- Erste Morde der RAF
- Rechtfertigung der Gewalt durch die RAF
Shownotes Transcript
Und da wurde diskutiert, ob man auch Gewalt ausüben sollte. Wir sind engagiert für diejenigen, die sich versuchen zu befreien von Terror und Gewalt. Für mich war der erste Schritt dieses Interview von Ulrike Meinhof mit dem Spiegel, in dem sie diesen berühmten Satz losgelassen hat, dass Polizeibeamte keine Menschen sind, sondern Bullen. Kommen Sie heraus, Ihre Chance ist null.
In den Zellen hat das Gegenteil von Isolationsfolter geherrscht. Das ist Folter, Exakt-Folter. Ja, Buback war für mich der erste Anschlag, wo man eine Einzelperson gezielt hingerichtet hat. Von Herrn Schleyer fehlt zurzeit noch jede Spur. Es habe innerhalb der RAF sogar einen Spezialbegriff dafür gegeben, für diese Todesnacht in Stammheim, nämlich eine Suicide-Action-Aktion.
Deine Geschichte, unsere Geschichte. Ein Podcast von NDR Info. Deine Geschichte erzählt dein Leben. Unsere Geschichte erzählt von unser aller Leben. Ich habe Zeitzeugen gefragt. Ich habe in den Tonarchiven recherchiert. Deine Geschichte. Unsere Geschichte. Die 70er, Folge 7, die RAF. Willkommen zu einer neuen Folge unseres Geschichtspodcasts mit Ulrike Bosse und Franziska Ammler.
Das war vielleicht gerade für mich eines der Hauptprobleme, mit denen ich konfrontiert war. Warum die Motivation? Denn das waren ja fast durchgängig Leute in meinem Alter, die eine ähnliche Motivation
Schul- und Studiumsbildung hatten und für mich eben anders als meine Weiche, dass ich mich zur Gewaltfreiheit entschieden hatte, eben zur Gewalt sich durchgerungen hatten. Also trotz gleicher Ausgangsbasis, dass dieser Staat Fehler gemacht hat, die man ihm angreifen muss, ich durch Demonstrationen und Unterschriftenleistungen, die eben dann versucht haben, zu dem
Der Zeitzeuge für unsere Folge über die Rote Armee Fraktion, die RAF, ist Klaus Flieger. Der heute 75-jährige Jurist war einer der engagiertesten Verfolger der RAF und der in der Zeit der Rote Armee Fraktion, der RAF,
Er war unmittelbar beteiligt an zahlreichen Ermittlungen, etwa zu Schleierentführungen und anderen RAF-Anschlägen sowie zur Todesnacht von Stammheim. Flieger selbst spricht von einem terroristischen Berufsleben. 38 Jahre war er im aktiven Dienst der Justiz des Bundes und des Landes Baden-Württemberg. Zunächst als Richter, dann als Staatsanwalt. Er lebt noch immer in der Nähe von Stuttgart, wo ich ihn besucht habe.
Die RAF hielt die Bundesrepublik in den 70er Jahren in Atem, war aber auch danach noch aktiv. Erst 1998 löste sich die RAF offiziell auf. Durch ihre Terrorakte kamen 34 Menschen ums Leben. Die Terroristen forderten den Rechtsstaat in der Bundesrepublik heraus. Aber ihre These, dass sich hinter der demokratischen Fassade ein autoritäres Regime verberge, bewahrheitete sich nicht.
Heute urteilen die meisten Experten, dass der demokratische Rechtsstaat bei ihrer Verfolgung bis an die Grenzen des Möglichen gegangen sei, dass aber die demokratischen Regularien intakt blieben. Entstanden ist der deutsche Linksterrorismus im Kontext der Studentenbewegung der späten 60er Jahre.
Seit der Ermordung Benno Ohnesorgs 1967 und dem Attentat auf Rudi Dutschke 1968 wurde in Teilen der Studentenbewegung die Diskussion darüber geführt, ob Gewalt ein legitimes Mittel der Auseinandersetzung sei. Von einer Stadt-Gereja war die Rede in Ableitung von südamerikanischen Gereja-Gruppen, deren bewaffneten Kampf man als legitim anerkannte.
Ulrike Meinhof war Anfang der 60er Jahre Chefredakteurin der linken Zeitschrift Konkret. Sie war Ehefrau von deren Herausgeber Klaus Rainer Röhl und Mutter von Zwillingen.
Sie schrieb politisch und sozial engagierte Artikel, genoss aber auch das Leben in der Hamburger intellektuellen Szene. Was sie antrieb, beschrieb sie 1968 so. Wir sind engagiert für diejenigen, die sich versuchen zu befreien von Terror und Gewalt. Und wenn ihr anderes Mittel als das des Krieges ihnen nicht übrig bleibt, dann sind wir für ihren Krieg.
und sind gegen diejenigen, die ihren Terror eskalieren, bis hin zur Anwendung von Nuklearwaffen, was gegenwärtig im Zug auf Vietnam diskutiert wird.
Wie die Gründungsmitglieder der RAF, Ulrike Meinhof, Andreas Bader und Gudrun Ensslin und wie viele andere jungen Leute in jener Zeit, demonstrierte auch Klaus Flieger Ende der 60er Jahre, zu Beginn seines Jurastudiums, gegen den Vietnamkrieg. Schon damals, erzählte er mir, habe er die Sorge gehabt, dass es in der Bundesrepublik eine terroristische Entwicklung geben könnte. Denn wir Studenten der 68er-Generation, wir sind schon auf die Barrikaden gegangen, weil
in diesem Land so jedenfalls aus unserer Sicht einige schief lief. Das waren die Notstandsgesetze, das war der radikale Erlass und das war für uns insbesondere der Vietnamkrieg, wo wir an der Seite der Amerikaner auch tätig gewesen sind. Und da bin auch ich in Tübingen, wo ich studiert habe, auf die Straße gegangen und habe demonstriert.
Und bei uns wurde auch in Tübingen darüber diskutiert, ob man mehr machen müsse. Denn wir haben gemerkt, mit den Demonstrationen haben wir nichts bewirkt. Wir liefen gegen eine Wand sozusagen. Und da wurde diskutiert, ob man auch Gewalt ausüben sollte. Also Steine gegen Schaufenster oder Steine gar gegen Polizeibeamte. Und da habe ich gemerkt, dass ich...
da eine Weichenstellung ergibt, wo sich die Spreu vom Weizen trennt. Im April 1968 verübt eine Gruppe aus dem Umfeld der Westberliner Studentenbewegung Brandanschläge auf Frankfurter Kaufhäuser. Als Andreas Bader und Gudrun Entlin deshalb wenig später vor Gericht stehen, lernt Ulrike Meinhof sie kennen. Und sie ist offenbar fasziniert von ihrem Aktivismus.
Am 14. Mai 1970 wird Andreas Bader von Ulrike Meinhof und weiteren Komplizen während eines Ausgangs aus der Haft befreit. Dieser Tag gilt gemeinhin als Gründungstag der RAF oder der Bader-Meinhof-Gruppe, wie die Terrorgruppe damals noch genannt wird.
In einem Spiegel-Interview rechtfertigt, die inzwischen auch steckbrieflich gesuchte Ulrike Meinhof, die Befreiung von Andreas Bader und macht mit einem Bekenntnis zur Gewalt gegen Polizisten als Vertreter der staatlichen Ordnung deutlich, dass sie die Grenzen des rechtsstaatlich legitimen Protests hinter sich gelassen haben. In einem vom Spiegel veröffentlichten Auszug dieses Interviews heißt es da folgendes.
Dieses Interview markiert für Klaus Flieger einen Wendepunkt. Auch weil spätere Erkenntnisse gezeigt hätten, dass es sich dabei nicht nur um rhetorische Flosken gehandelt habe.
Für mich war der erste Schritt dieses Interview von Ulrike Meinhof mit dem Spiegel, in dem sie diesen berühmten Satz losgelassen hat, dass Polizeibeamte keine Menschen sind, sondern Bullen und natürlich kann geschossen werden und
Es ist dann auch geschossen worden. Später haben wir aus Papieren herausgelesen, dass es kein Kann war, sondern ein Befehl, Schießbefehl. Die Formulierung in anderen Papieren war dahingehend, dass...
Polizeibeamte, die euch laufen lassen, die könnt ihr auch laufen lassen, aber die Polizeibeamten, die euch festnehmen wollen, da müsst ihr euch mit Schüssen wehren und diejenigen, die das nicht gemacht hatten, sich sozusagen haben festnehmen lassen, ohne zu schießen, die mussten nachher eine Selbstkritik schreiben, weil sie gegen diesen Schießbefehl verstoßen haben. Das war der erste für mich Schuss,
Schlimme Schritt Richtung Gewalt gegen Personen, dass man eben plötzlich Tode hat. Trotzdem unterscheidet er aber noch zwischen Worten und Taten. Der große Schritt, der für mich wirklich noch größer Schritt war, aber dann das Jahr 72, als im Mai innerhalb kürzester Zeit eine ganze Serie von Sprengstoffanschlägen verübt worden ist, gezielt um Menschen umzubringen.
Das erste Mordopfer der RAF war im Oktober 1971 der Hamburger Polizist Norbert Schmidt. Er wurde erschossen beim Versuch, Mitglieder der RAF festzunehmen.
Mehrere Tote und Verletzte gab es dann im Mai 1972 bei Anschlägen auf die Hauptquartiere der US-Armee in Heidelberg und Frankfurt am Main, auf den Springer Verlag und mehrere Polizeistationen. Kurz darauf werden die RAF-Führungsfiguren festgenommen. Werfen Sie die Pistolen in den Ruf und kommen Sie heraus. In den frühen Morgenstunden des 1. Juni werden in Frankfurt am Main Andreas Bader, Holger Mainz und Jan Karl Raspe gestellt.
Ich bin in der Situation, dass Sie uns zu nicht wissen können, was wir nicht wollen. Wir haben gesucht, wir haben alles. Andreas Bader und Holger Mainz verschanzen sich in einer Garage. Es kommt zu einem Schusswechsel, bei dem Andreas Bader am Gesäß verletzt wird. Sie haben es verspielt. Sie sind in Ihre Kleidungsstücke ausgekommen. Sie eintrennen raus.
Holger Mainz befolgt die Anweisungen. Schließlich Andreas Bader wird verletzt aus der Garage geholt. Gudrun Ensslin wird eine Woche später in einer Hamburger Boutique festgenommen. Ulrike Meinhof am 15. Juni in Hannover. Tags darauf informiert Kriminaldirektor Hans-Joachim Budde die Öffentlichkeit.
Aufgrund eines telefonischen Hinweises wurden gestern in der Walzroder Straße in Langenhagen eine männliche Person in einer Telefonzelle und eine weibliche Person in einer in der Nähe dieser Telefonzelle gelegenen Wohnung vorläufig festgenommen. Beide leisteten dabei Widerstand, die Frau besonders heftig. Durch eine Röntgenaufnahme des Schädels
Klaus Flieger sagt, ihn habe damals wirklich erschüttert, dass Teile der Öffentlichkeit Sympathien für die RAF-Terroristen hatten. Das war der zweite Akt, der für mich fast der schlimmste war.
dass man diese RAF-Leute nicht als pure Verbrecher angesehen hat, sondern als Personen, die ein berechtigtes Anliegen haben, gegen diesen Staat vorzugehen. Und es gab einen recht ordentlich großen Ansatz, nicht nur unter den Studenten, sondern in der breiten Bevölkerung, hauptsächlich auch unter intellektuellen
die unter dem Begriff Sympathisanten gefallen sind, die teilweise ihre Wohnungen zur Verfügung gestellt haben für die untergetauchten RF-Leute und sozusagen deren Kampf auf diese Art und Weise unterstützt haben. Und das war für mich eine Sorge, dass das, was die RF nämlich erreichen wollte, die Gesellschaft zu einem Umschwung zu bewegen, dass das schon bis zu einem gewissen Grad gelungen war und
Man musste befürchten, dass dieser Status, diese Anschläge und die Unterstützung in ordentlichen Bevölkerungsteilen in Zwanken vielleicht gar ins Umstürzen kommen könnte. Allerdings meint er, der Staat habe sich anfangs auch nicht richtig verhalten. Das war etwas, was ich später dann auch unter dem Begriff der Staat hat überreagiert, schon damals als Student so bewertet habe. Man hat...
die RAF samt ihrer Anschläge fast auf den Sockel des Kriegsgegners gestellt, indem man mit Gesetzen, mit Maßnahmen, mit Polizeikontrollen fast auf dem Weg war, Polizeistaat zu werden. Und das war ja genau das Ziel der RAF. Man ist ihnen sozusagen auf den Leim gegangen, dass man sich so verhalten hat, wie es ein Polizeistaat etwa machen würde.
Und das hat lange Zeit gedauert, nicht nur der Staat insgesamt, sondern wir auch als Justiz, dass wir gemerkt haben, wir müssen die Leute auf das reduzieren, was sie strafrechtlich sind, Verbrecher.
Den RAF-Häftlingen und ihren Anwälten gelang es durch Aktionen und wirksame Medienarbeit, Teile der Öffentlichkeit für sich einzunehmen. Immer wieder traten die Gefangenen zum Beispiel in Hungerstreik, um gegen ihre Haftbedingungen zu protestieren. Am härtesten und in der Öffentlichkeit wirksamsten war dabei wohl der Vorwurf, sie würden durch Isolation gefoltert.
Holger Mainz starb am 9. November 1974 an den Folgen des Hungerstreiks in der JVA Wittlich und wurde von Teilen der linken Szene danach als Märtyrer betrachtet. Misstrauisch fragte die Öffentlichkeit nach. Der Hamburger Justizsenator Ulrich Klug schilderte die Zwangsernährung der in der Hansestadt inhaftierten Terroristen. Die Ärzte vollziehen die Zwangsernährung nach den ärztlichen Regeln.
die es da gibt. Es wird auf diese Art und Weise den Hungerstreikenden eine Nahrung von 1600 Kalorien zur Verfügung gestellt und es wird durch die Einführung der Ernährungssonde in den Magen sichergestellt, dass diese 1600 Kalorien auch aufgenommen werden.
Und das geschieht. Die betreffenden Inhaftierten protestieren zwar, sie sind nicht einverstanden, aber es ist möglich, diese Ernährung so vorzunehmen, dass das in menschenwürdiger Form geschieht. So ist jedenfalls die Hamburger Begründung.
Sowie Klaus Flieger, das mir gegenüber geschildert hat, ist das mit der menschenwürdigen Form der Zwangsernährung, von der der Senator da spricht, schon eine recht fragwürdige Aussage. Das ist jetzt vielleicht auch eine Brutalität. Jedenfalls stehe ich dazu, wenn jemand sich umbringen will per Hungerstreik, dann muss man ihn lassen. Man hat damals mit Zwangsernährung gearbeitet, das ist fast unmenschlich gewesen für alle Beteiligten.
Wenn man dem Häftlingen mit Gewalt einen dicken Schlauch zwischen die Zähne schiebt, der sich dagegen wehrt. Das ist schlimm für den Häftling, das ist schlimm für diejenigen, die es machen müssen. Ich habe damals schon gesagt, warum macht ihr denn das? Wir haben als Juristen das gelernt, dass jeder Recht darauf hat, sich umzubringen. Und dass man nur dann eingreifen muss, wenn er nicht mehr Herr seiner Sinne ist.
Und deshalb gibt es erst seit Mitte der 80er Jahre die Regel, dass man bei hungernden Selbstmordkandidaten in der Haft erst dann eingreifen muss, wenn die nicht mehr Herr ihrer Sinne sind. Dann kommt eine Fürsorgepflicht, er könnte sich sie am Schluss nochmal anders überlegt haben und doch noch leben wollen. Das ist die juristische Konstruktion, Ausspruch und Hochseilakt juristischer Art. Aber so ist die Regelung heute.
Klaus Flieger sagt, dass die Gefangenen und ihre Anwälte mit dem Vorwurf über die Haftbedingungen die Öffentlichkeit im Übrigen ziemlich hinters Licht geführt hatten. Über die Haftbedingungen in Stuttgart-Stammheim, wo Bader, Ensslin und Meinhof einsaßen und wo ab 1975 ja auch der Prozess gegen die RAF geführt wurde, konnte er sich damals selbst ein Bild machen. In den Zellen hat das Gegenteil von Isolationsfolter geherrscht.
Privilegien unvorstellbarer Art. Ich war Haftrichterin, habe das deshalb hautnah von den Wachtmeistern erzählt bekommen, dass man Dinge denen erlaubt hat, die sie durch ihre Hungerstreiks sich schlicht und einfach ertrotzt haben. Zum Beispiel, dass Männlein und Weiblein zusammen in einem Gefängnis eingesperrt werden, gibt es normalerweise nicht mit offenen Türen.
Mitgefangene, die ihre Prozessstrategie absprechen konnten, widerspricht allem, was wir sonst im Vollzug haben, wo man Mittäter trennt, ganz gezielt. Also, aber weiß ich von Richterkollegen des Bade-Meinhof-Prozesses, mit denen ich Fußball gespielt habe,
dass die gesagt haben, wir haben nachgegeben, weil noch schlimmer wäre es gewesen, wenn wir tote Gefangene gehabt hätten, die durch einen Hungerstreik zu Tode gekommen sind. Was er da erzählt, das entspricht den Informationen, die ein Reporter des SWR 1974 über die Haftbedingungen in Baden-Württemberg berichtete. Schon damals hatte die Justiz ja den Vorwurf der Isolationsfolter zurückgewiesen. Die
Den Häftlingen seien stattdessen vor geraumer Zeit zahlreiche Sondervergünstigungen eingeräumt worden, die sie bisher aber nicht beansprucht hätten. So sei von ihnen der gemeinsame Hofgang mit anderen Häftlingen mit der Begründung abgelehnt worden. Auf diese Weise werde nur versucht, sie mit Justizspitzeln zusammenzubringen. Aber auch der Besuch von Bastel- und Hobbyräumen sei abgelehnt worden.
Für Gudrun Ensslin und Ulrike Meinhof sei sogar eine Tischtennisplatte aufgestellt worden. Die Anwälte der RAF wiesen allerdings darauf hin, dass in den verschiedenen Haftanstalten, in den verschiedenen Bundesländern, in denen die Terroristen untergebracht waren, sehr unterschiedliche Haftbedingungen herrschten.
Und warum Gefangene nach der geltenden Rechtsordnung zulässige Formen der Isolation als Folter bezeichneten, das wird in einer Auseinandersetzung zwischen Ulrike Meinhof und dem im RAF-Prozess in Stammheim vorsitzenden Richter Theodor Prinzing deutlich, von der es noch einen Tonbandmitschnitt gibt. Es gibt in der Isolation exakt zwei Möglichkeiten. Entweder...
Frau Meinhof, es ist kein Zusammenhang mehr zum Ablehnungsantrag zu sehen. Entweder sie bringt einen Gefangenen zum Schweigen, das heißt man stirbt daran, oder sie bringt einen zum Reden und das ist das Geständnis und der Verrat. Das ist Folter, Exaktfolter.
Das Problem des Linksterrorismus in der Bundesrepublik war mit der Festnahme der Gründergeneration der RAF nicht erledigt. Die zweite Generation der RAF und vergleichbare Gruppierungen versuchten immer wieder, die Inhaftierten freizupressen und forderten die Staatsgewalt in der Bundesrepublik heraus.
Am 27. Februar 1975 wird der Berliner CDU-Vorsitzende Peter Lorenz entführt. Es gelingt, fünf Gesinnungsgenossen freizupressen. Lorenz wird anschließend freigelassen. Aus Sicht von Klaus Flieger hat der Staat im Fall Lorenz einen klaren Fehler gemacht. Rückblickend war die Reaktion im Entführungsfall Lorenz falsch gemacht.
Ein Staat, der sich einmal erpressen lässt, provoziert geradezu durch seine Rücksichtnahme auf die Forderungen, dass er erpressbar ist und provoziert damit weitere Geiselnahmen. Schon im April 1975 schlugen die Terroristen erneut zu. Sie überfielen die Deutsche Botschaft in Stockholm, um 26 RAF-Mitglieder, darunter Bader und Meinhof, freizupressen.
Diesmal weigert sich die Bundesregierung. Zwei Diplomaten werden erschossen und das Gebäude in Brand gesetzt. Bundeskanzler Helmut Schmidt erklärt anschließend, Jeder von den Beteiligten hatte vorher sein Gewissen geprüft und jeder hatte das Risiko eines Scheiterns abgewogen gegen die unübersehbaren Risiken, die eine Freilassung von 26 der gefährlichsten Terroristen für uns alle und für unseren Staat bedeutet hätte.
Am 21. Mai 1975 begann der RAF-Prozess in Stuttgart-Stammheim gegen die RAF-Gründer Bader, Meinhof, Ensslin und Raspe. Die Anklagepunkte lauteten Mord, versuchter Mord, Banküberfälle, Sprengstoffanschläge, also klare Verbrechen. Während die Angeklagten sich als politische Gefangene betrachteten und sich als Opfer eines deutschen Polizeistaats darstellten.
Wie unterschiedlich die Dinge damals gesehen und beurteilt wurden, zeigt zum Beispiel auch das Verhalten einiger RAF-Anwälte. Die drei Wahlverteidiger im Baader-Meinhof-Verfahren, Klaus Croissant, Kurt Gronewoldt und Christian Ströbele, der spätere Grünpolitiker, entwickelten ein Infosystem zwischen den RAF-Häftlingen. Gegen sie wurde noch 1975 ein Strafverfahren eingeleitet, wegen Unterstützung einer terroristischen Gruppierung.
Für Klaus Flieger als Staatsanwalt wurde das ein entscheidender Schritt in die RAF-Thematik. Ich bin gefragt worden und wohl wissend, dass das mit einer gewissen Gefährdung verbunden ist, hat meine Frau genauso wie ich gesagt,
wir werden schon nicht so wichtig sein, wir schlagen das Angebot nicht aus. Und dadurch bin ich in diese Thematik hineingerutscht als relativ junger Mann, dass ich dann in diesem spektakulären, auch weltweit aufsehenerregenden Prozess gegen Croissant, der aus Frankreich ausgeliefert worden war, wo er politisches Asyl hatte bekommen wollen, und der wurde dann in diesem Prozess zu zweieinhalb Jahren ausgeliefert.
Freiheitsstrafe verurteilt. Das war sozusagen mein Einstieg in die RF und das hat mich dann nicht mehr losgelassen. Auch Gronewold und Ströbele wurden verurteilt und verloren vorübergehend ihre Anwaltszulassungen.
Christian Ströbele hat die Verurteilung bis zuletzt als ungerecht empfunden. Er sei nie auf die Idee gekommen, dass man die Gefangenen als kriminelle Vereinigung sehen konnte. Das sei als Rechtskonstruktion damals neu gewesen. Und er habe die Herstellung der Kommunikation der Gefangenen untereinander und mit den Anwälten nicht als gesetzeswidrigen oder kriminellen Akt gesehen. Ulrike Meinhof beging in der Haftanstalt im Mai 1976 Selbstmord.
Für Bader, Ensslin und Raspe endete der Stammheimer Prozess am 28. April 1977 mit Schuldspruch und Verurteilung zu lebenslanger Haft. Daran änderte auch die Ermordung von Bundesanwalt Siegfried Buback mit zwei Begleitern am 7. April durch ein RAF-Kommando nichts. Ja, Buback war für mich der erste Anschlag, wo man eine Einzelperson gezielt hingerichtet hat, mit den beiden Begleitern noch dazu.
Natürlich als Justizeingehöriger, der ich damals schon war, beeindruckend, dass man da den obersten Ankläger in Deutschland schlicht und einfach auf offener Straße ermordet, ein Zeichen setzt. Das war eine vollkommen neue Qualität von Justiz.
Gewalttat, wie man es bis dahin nicht gekannt hat und hat dementsprechend auch in der breiten Öffentlichkeit den Mädchenaufsehen erregt. Und das war der Beginn eigentlich dessen, was wir unter dem deutschen Herbst verstehen. Am 30. Juli 1977 wird der Vorstandsprecher der Dresdner Bank Jürgen Ponto ermordet. Er soll eigentlich entführt werden, wehrt sich aber und wird erschossen.
Am 25. August findet ein misslungener Raketenwerferanschlag auf die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe statt. Der laut Klaus Flieger nur scheiterte, weil die Täter vergessen hatten, den Wecker aufzuziehen, der die Zündung auslösen sollte. Am 5. September 1977 wird Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer entführt. Der Kölner Polizeipräsident Jürgen Hosse informiert die Öffentlichkeit.
Um 17.28 Uhr wurde in Köln-Braunsfeld, in der Vödig-Schmidt-Straße, der BDI-Präsident Dr. Schleyer, der sich in Begleitung von drei Beamten des Landeskriminalamtes Stuttgart befand und sein Fahrer von bewaffneten Terroristen aufgelauert,
Die drei Beamten des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg und der Fahrer sind, soweit wie wir zurzeit unterrichtet sind, ihren Verletzungen, den Schussverletzungen erlegen. Von Herrn Schleyer fehlt zurzeit noch jede Spur. Anders als bei der Entführung von Peter Lorenz 1975 erfüllt der Staat diesmal die Forderungen der Terroristen nicht.
Woraufhin der Konflikt von den Terroristen eskaliert wird und zugleich die internationale Vernetzung der RAF deutlich wird. Am 13. Oktober wird die Lufthansa-Maschine Landshut mit 82 Passagieren und 5 Besatzungsmitgliedern an Bord durch einen Kommando der Volksfront zur Befreiung Palästinas entführt. Sie fordern die Freilassung von neun politischen Gefangenen in der Bundesrepublik und zwei in der Türkei.
Über Zwischenstationen in Rom, Zypern und Bahrain lotsen die Entführer die Landshut nach Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten.
Die Entführer der Lufthansa-Maschine haben ihre Drohung, das Flugzeug in die Luft zu sprengen, falls ihrer Forderung nicht nachgegeben werde, noch einmal heute Vormittag bekräftigt. Der Pilot der Maschine hat sich in einem beschwörenden Appell direkt an Bundeskanzler Helmut Schmidt gewandt und erklärt, für uns hängt alles von ihrer Entscheidung ab. Sie sind unsere einzige und letzte Hoffnung.
Staatssekretär Hans-Jürgen Wischneski wird als Unterhändler nach Dubai entsandt. In Bonn tagt der Krisenstab. Es gibt in Bonn zur Stunde keinerlei Anhaltspunkte darüber, wie sich die Regierung entscheiden wird. Die Entführer erhoffen sich Zuflucht im Jemen. In Aden erhalten sie keine Landeerlaubnis. Das Flugzeug muss auf einer Sandpiste notlanden.
Die Bundesregierung, die Partei und Fraktionsvorsitzenden des Deutschen Bundestages und die Ministerpräsidenten der vier betroffenen Bundesländer sind sich der Tatsache durchaus bewusst, dass die Situation unvermindert ernst ist.
Weil Pilot Schumann von einer Inspektion der Triebwerke zu spät zurückkommt, er hatte vergeblich versucht, das jemenitische Militär zum Eingreifen zu bewegen, erschießen ihn die Geiselnehmer. Das Ziel der Bundesregierung ist und bleibt, das Leben der Geiseln zu retten, die sich in der Gewalt von Leuten befinden, die durch den Mord in Aden in der vergangenen Nacht bewiesen haben, wessen sie fähig sind.
Die Lufthansa-Maschine fliegt, gesteuert von Co-Pilot Jürgen Vitor, weiter nach Somalia. Eine bedrückende Stille liegt seit Stunden über den Vorgängen um die entführte Lufthansa-Maschine. Trotz pausenloser Bemühungen ist kein Lebenszeichen mehr, von ihr über Funk aufzufangen. Ob die Funkgeräte ausgesetzt haben oder ob die Terroristen einen Schweigevorhang über ihre Absichten gesenkt haben, kann von hier aus bestimmt nicht beurteilt werden.
In Bonn versammeln sich die Angehörigen der Geiseln. Sie waren zum Kanzleramt gekommen, in Angst, in Schrecken, im verzweifelten Bemühen, die Bundesregierung zu Hilfeleistungen zu bewegen. Ein Kind trug ein Schild um den Hals. Ich will meine Mutti wieder haben. Weiß Gott, das ist bewegend. Zum Schein verhandelt die Bundesregierung über die Freilassung der RAF-Gefangenen sowie eine geforderte Lösegeldzahlung.
Sie kann einen Aufschub des gestellten Ultimatums erreichen, Israel-Korrespondent Zvi Schnabel, der die Entwicklung von Tel Aviv aus beobachtet, berichtet. Es häufen sich jedoch immer wieder die Berichte, dass eine Lufthansa-Maschine mit einer Antiterroreinheit irgendwo im Nahen Osten auf ihre Stunde Null wartet.
Der Krisenstab der Lufthansa schildert die Aktion so.
Um 0.05 Uhr wird gemeldet, Türen offen. Um 0.06 Uhr Schüsse fallen. 0.07 Uhr, die ersten Passagiere steigen aus. 0.08 Uhr, vereinzeltes Feuer. 0.09 Uhr, die ersten Passagiere laufen von der Maschine weg. 0.10 Uhr, weitere Passagiere verlassen die 737 über Notrutschen. Keine Panik, geordnete Evakuierung. 0.11 Uhr, die Passagiere werden vom Flugzeug weggeführt.
Das erste kurze Telefonat zwischen Bundeskanzler Helmut Schmidt in Bonn und Staatssekretär Hans-Jürgen Wischniewski in Mogadischu gibt Regierungssprecher Klaus Bölling so wieder. Der Kanzler nahm den Hörer auf und sagte, Schmidt hier, ich höre. Und Wischniewski meldete sich von dort mit den Worten, die Arbeit ist erledigt, drei tote Terroristen, ein GSG-9-Mann verletzt.
Verletzt, keine weiteren Erkenntnisse, jetzt fahren die Kraftwagen. Alle Geiseln kamen heil nach Hause, aber das war nicht klar, als der Einsatzbefehl für die Stürmung des Flugzeugs gegeben wurde.
Regierungssprecher Bölling begründete die Entscheidung der Bundesregierung damals, dass die Entführung von Peter Lorenz gezeigt hätte, dass freigelassene Terroristen zurückkämen. Wir haben so gehandelt, weil wir die Gesamtheit der Bürger zu schützen verpflichtet waren. Indem wir uns so entschieden haben...
waren und sind wir sicher, dass wir auch zum Schutz des Lebens des Einzelnen das Richtige getan haben. Aus diesem Grund werden auch die Forderungen der Entführer von Hans Martin Schleyer nicht erfüllt. Er wird am 18. Oktober ermordet, seine Leiche wird am nächsten Tag gefunden.
Klaus Flieger meint, die Bundesregierung habe gar keine andere Wahl gehabt, als so zu handeln, wie sie es getan hat. Der Staat dürfe sich nicht erpressen lassen. Die Konsequenz nach Schleyer, so erfreulich muss man sagen, seit wir haben keine einzige vergleichbare Geiselnahme mehr in Deutschland, weil der Staat gezeigt hat, darauf herzustellen.
reagiert er nicht. Das ist wichtig, eine Weichenstellung, ein für alle Mal und damit die Verhinderung weiterer Entführungen. Brutal für Schleyer, ganz klar, wäre auch brutal gewesen für die Landshutinsassen, denn für die hätte das Gleiche gegolten. Aber ich weiß und wir alle wissen, dass wie schwierig die Entscheidung war und interessant ist, dass man die damals in einer großen Schulterschlussaktion verfolgt.
zwischen Regierung Helmut Schmidt und der Opposition um Helmut Kohl gemeinsam getroffen hat. Dass man in dieser schwierigen Situation für den Staat keine politischen Kämpfe ausgeführt hat, sondern gemeinsam entschieden hat, wir geben nicht nach. Das ist eine tolle Leistung damals gewesen. Eine ganz wichtige Weichenstellung für uns und natürlich mit dem mehr als erfreulichen Ergebnis der Landshutbefreiung in Mogadischu.
ist in einem Maß gut gegangen, wie man es nicht erwarten konnte unbedingt. Es hätte auch in der Landshut Tote zu Hauf geben können. In der Nacht vom 17. auf den 18. Oktober begingen die RAF-Gründer in ihren Zellen in Stuttgart-Stammheim Selbstmord. Offenbar, nachdem sie die Nachrichten von der Befreiung der Geiseln in Mogadischu gehört hatten, berichtete ein Reporter am Morgen des 18. Oktober.
Als gesichert gilt aber, dass sowohl Andreas Badach als auch Jan Karl Raspe sich erschossen haben und zwar mit einer Pistole Kaliber 65, dass sich Gudrun Ensslin am Fenster erhängt hat, wie Weiland Ulrike Meinhof vor eineinhalb Jahren und dass Irmgard Möller einen Selbstmordversuch unternommen hat. Sie befindet sich aber inzwischen außer Lebensgefahr.
Die Leichen der Toten werden voraussichtlich heute noch obduziert, und zwar von einem internationalen Ärztegremium, das das baden-württembergische Justizministerium inzwischen gebeten hat.
Die Frage, wie waren diese Selbstmorde möglich, beschäftigte die deutsche Öffentlichkeit allerdings noch länger. Und trotz des internationalen Gutachtergremiums wurden die Selbstmorde immer wieder infrage gestellt. Klaus Flieger war damals für die Aufklärung der Tode von Stammheim mit zuständig, als Teil einer sechsköpfigen Ermittlergruppe.
Interessanterweise durften die Anwälte bei dieser Obduktion dabei sein und bei der ersten Beurteilung. Und alle vier Rechtsmediziner, die beiden aus Österreich und der Schweiz und die beiden Deutschen, kamen übereinstimmend zum selben Ergebnis, eindeutig Selbstmord.
Über die Hintergründe dieser Selbstmorde hat Klaus Flieger dann Jahre später noch etwas erfahren. Bei einer meiner Vernehmungen hat eines der RAF-Mitglieder später, das war in den 90er Jahren, zum Ausdruck gebracht, dass es innerhalb der RAF selbstverständlich war, dass die Stammheimer sich selber umgebracht haben. Das war also für mich eine ganz wichtige Aussage dazu,
insbesondere weil die Frau Helbing, von der ich es zum ersten Mal gehört habe, eine RAF-Angehörige, auch mir erklärte, es habe innerhalb der RAF sogar einen Spezialbegriff dafür gegeben für diese Todesnacht in Stammheim, nämlich eine Suicide Action, also eine Selbstmordaktion,
bei der man den eigenen Tod nochmal instrumentalisiert gegen diesen Staat, in dem man den Eindruck erweckt, ermordet worden zu sein. Deshalb bei Andreas Bader auch der Schuss in den Nacken, was nach den Gerichtsmedizinern ohne weiteres möglich ist, dass man den selber sich setzen kann.
Das war für mich die große Wende. Für ihn gibt es also an den Selbstmorden keinen Zweifel. Allerdings räumt er ein, dass nicht jeder Verdacht auf eine Mitverantwortung des Staates ausgeräumt werden kann. Es gibt eine Variante, die Stefan Aust aufgebracht hat im Spiegel, über die man streiten kann. Er hält es für möglich, dass in der Todesnacht die Zellen abgehört worden sind.
und die Beamten nicht eingegriffen haben, sozusagen den Selbstmord haben gewähren lassen. Das ist strafrechtlich fast so schlimm wie die aktive Tötung, denn obwohl es ja schreckliche Täter sind, die gegen diesen Staat vorgegangen sind, haben wir denen gegenüber, gerade auch als Gefängnisanstalt, eine Fürsorgepflicht und müssen solche Selbstmorde verhindern. Wir haben das intensiv überprüft und haben dafür keine Anhaltspunkte gefunden.
Aber man kann so eine Theorie nicht vollständig widerlegen. Deshalb wird es dieses Gericht möglicherweise immer wieder geben.
Vieles, was in den Kontext der Geschichte der RAF gehört, haben wir nicht erwähnt. Die massiven Reaktionen des Staates in den 70er Jahren etwa, die manchmal den Eindruck aufkommen ließen, die Bundesrepublik befinde sich im Ausnahmezustand. Verkehrskontrollen, Hausdurchsuchungen, Aufwagenverdacht in Datenerhebungen oder die weitere Geschichte der RAF bis zu ihrer Auflösung.
Und es bleiben jede Menge offene Fragen. Warum sind intelligente und engagierte junge Menschen in der Bundesrepublik den Weg der Gewalt gegangen? Was wollten sie erreichen? Wer hat welche Rolle in der RAF gespielt? Hatte die real existierende Bundesrepublik etwas zu tun mit dem Bild oder Zerrbild vom Staat, das die Terroristen hatten?
Auf all das können wir in so einer Podcast-Folge nicht angemessen eingehen. Es gibt aber viele Studien, Bücher und Filme, die sich mit der RAF beschäftigt haben. Und es gilt, was für alle unsere Podcast-Folgen gilt, wir möchten zusammen mit unseren Zeitzeugen erinnern an ein Stück Zeitgeschichte und möchten neugierig machen auf das, was in den Geschichtsbüchern steht und was andere Beteiligte oder einfach auch Eltern, Großeltern, Bekannte dazu zu erzählen haben.
Klaus Flieger hat sich beruflich auch nach dem Herbst 1977 mit der Terrorthematik beschäftigt. Besonders wichtig war für ihn aber, wie er mir erzählt hat, das Auflösungsschreiben der RAF 1998. In dieser Auflösungserklärung Neuen Zeiten, wo alles Mögliche drinsteht, taucht ein Satz auf, auf den wir alle stolz sein können als Staat, als Rechtsstaat, als Demokratie, ja wir alle.
Da steht drin, wir haben nach 28 Jahren die RAF beendet. Die gibt es jetzt nicht mehr. Und dann kommt der Satz, der mir wichtig war. Dieses Ergebnis zeigt, dass wir auf diesem Weg nicht durchkommen konnten. Wenn Terroristen der Qualität RAF sagen, dieser Staat ist so stark als Rechtsstaat, als Demokratie, dass wir dagegen mit Terrormitteln nicht ankämpfen können erfolgreich, dann ist das unverantwortlich.
Ein Element, wo man nur sagen kann, wir können stolz darauf sein als Staat, dass wir den RAF-Terrorismus bekämpft haben. Der Terrorismus der RAF hatte nicht nur Verbindungen zu einem weltweiten Kampf gegen den Imperialismus, wie die Terroristen für sich in Anspruch nahmen, sondern er war auch eingebettet in die Logik des Kalten Krieges. Vieles wurde erst nach der Wende bekannt, etwa wie die DDR ehemalige RAF-Mitglieder bei sich aufgenommen und unterstützt hat.
Doch wir wollen uns in der nächsten Folge unseres Podcasts mit einem DDR-internen Thema beschäftigen, der Rolle der Stasi bei der Stabilisierung der Deutschen Demokratischen Republik. Unser Zeitzeuge ist dann Eckhard Hübener. Der heute 69-Jährige wuchs in einer mecklenburgischen Pastorenfamilie auf und machte schon früh Erfahrung mit der Stasi. Erst schnitt man ihm den direkten Weg zum Abitur ab und später verwehrte man ihm sein Wunschstudium.
Er selbst hat Widerstand geübt mit dem Ziel, in Freiheit zu leben und viel Leid erfahren. Es folgten Bespitzlungen, 42 IMs zählte er nach seinem Blick in die Stasi-Akten, Hausdurchsuchungen und später sogar Stasi-Knast. Heute berät er selbst Betroffene von Systemunrecht in der DDR. Und bei vielen seiner Geschichten konnte ich, Jahrgang 1987, kaum glauben, dass es so etwas wirklich gegeben hat.
Alex und Jacqueline haben den Podcast diesmal mit uns produziert und ihr findet diese, sie finden alle Folgen des Podcasts in der ARD Audiothek. Fotos, Filme und Texte zu den einzelnen Folgen gibt es unter ndr.de-geschichte. Und über Lob und Kritik freuen wir uns unter der E-Mail-Adresse deinegeschichte in einem Wort at ndr.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ein Podcast von NDR Info.
Untertitelung des ZDF, 2020