
Die 70er: Streit um die Bildung (4/12)
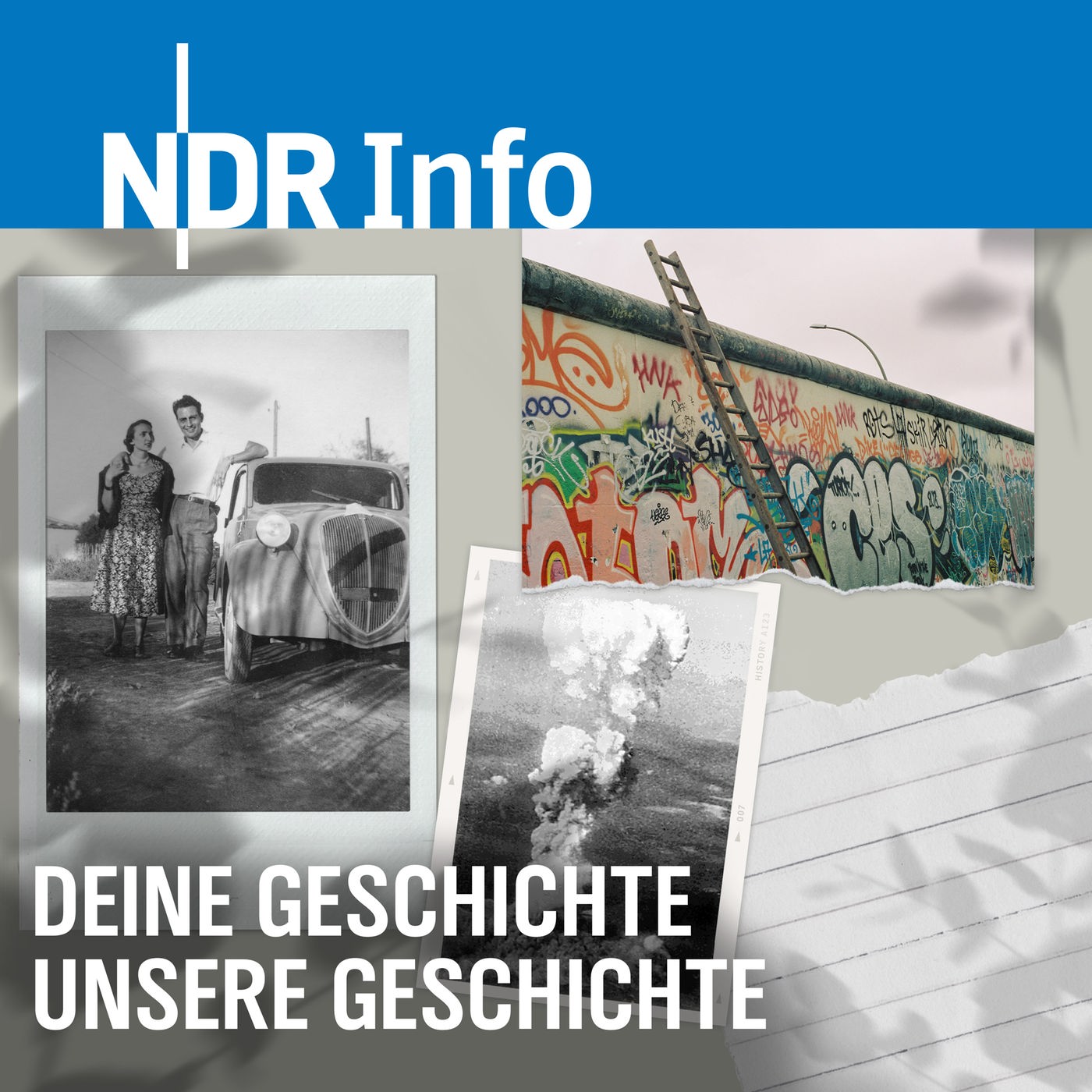
Deine Geschichte – unsere Geschichte
Deep Dive
- 15% of a year group attended Gymnasium in the 60s
- Debates about social equality and educational opportunities
- The role of Gesamtschulen in promoting social change
- Shifting political landscape and the role of different parties
Shownotes Transcript
Als ich das Gymnasium besucht habe in den 60er Jahren, da waren ungefähr 15 Prozent eines Jahrgangs, die auf das Gymnasium kamen. Die Bildungsreform ist natürlich eine politisch sehr schwierige Aufgabe. Und ich habe mir gedacht, Schule muss anders werden. Wir sind für diese eine Gesamtschule gezwungen.
innerhalb derer man unterschiedliche Begabungen fördern und entwickeln kann. Diese Vorstellung, dass also Kinder gleiche Chancen haben, hat viele motiviert. Darüber hinaus wollen wir, dass die Schulen nicht mehr länger als ein Hebel zur gesellschaftspolitischen Veränderung missbraucht werden. Und gesellschaftlich, denke ich, hat es einiges verändert. Deine Geschichte. Unsere Geschichte. Ein Podcast von NDR Info.
Deine Geschichte erzählt dein Leben. Unsere Geschichte erzählt von unser aller Leben. Ich habe Zeitzeugen gefragt. Ich habe in den Tonarchiven recherchiert. Deine Geschichte. Unsere Geschichte. Die 70er, Folge 4. Streit um die Bildung. Willkommen zu einer neuen Folge unseres Geschichtspodcasts mit Ulrike Bosse und Franziska Ammler. Ich denke, dass in einer Demokratie, in einer demokratischen Gesellschaft...
die soziale Gleichheit, die Gleichheit der Bildungsmöglichkeiten gegeben werden muss und dass alles, was diese Möglichkeiten einschränkt, die Demokratie, die Entwicklung der Gesellschaft beschädigt. Und das Festhalten an Vorrechten, an Privilegien,
Das schließt eben andere immer in ihrer Entwicklung automatisch aus. Man kann nicht beides haben. Man hört es, der Zeitzeuge unserer heutigen Folge, Eberhard Brandt, ist noch immer ein engagierter Pädagoge. Den mittlerweile 71-Jährigen habe ich an seinem jetzigen Wohnort in Hamburg getroffen. Er stammt aber aus Niedersachsen, ist in Wolfsburg zur Schule gegangen und dort hat er nach seinem Studium in Marburg auch als Lehrer gearbeitet.
Außerdem war er viele Jahre lang Landesvorsitzender der GEW Niedersachsen. Aufstieg durch Bildung, das war es, was Sozialdemokraten in den 70er Jahren forderten und umsetzen wollten, im Interesse einer breiten Gesellschaftsschicht, die bis dahin von höherer Bildung ausgeschlossen war. Bildungspolitik war für die SPD ein Instrument für mehr soziale Chancengleichheit.
Konservative hielten dagegen, dass Bildungspolitik nicht missbraucht werden dürfe, um gesellschaftspolitische Ziele zu erreichen und dass die Qualität der höheren Bildung leiden werde, wenn sie vielen, ja zu vielen, zugänglich gemacht werden sollte.
Auch heute engagieren sich ja die Eltern und den Länderparlamenten wird über Bildung gestritten, von Fragen der Rechtschreibung bis zur Digitalisierung im Unterricht. Damals aber ging es um grundsätzliche inhaltliche Fragen und um Strukturentscheidungen. Was müssen Jugendliche lernen und in welchen Schulen sollen sie das tun? Im traditionellen dreigliedrigen Schulsystem oder in der integrierten Gesamtschule?
Die Bildungspolitik gehörte in den 70er Jahren zu den am stärksten diskutierten und umstrittenen Themen nach den Ostverträgen. Warum?
Das beschrieb Klaus von Donanyi als damals frisch ernannte Bundesminister für Bildung und Wissenschaft im Herbst 1972 so. Die Bildungsreform ist natürlich eine politisch sehr schwierige Aufgabe. Bildung reicht in alle Bereiche der Gesellschaft, berührt vielfältige Interessen und in Zeiten, in denen sich die Gesellschaft sehr schnell wandelt, daher die Werte der Gesellschaft vielfach in Zweifel geraten und im Kern der Bildung stecken die Werte der Gesellschaft,
muss auch die Bildungspolitik selbst mitten in den politischen Streit geraten. Angefangen hatte es mit dem Sputnik-Schock Ende der 50er Jahre. Im Oktober 1957 hatte die Sowjetunion den ersten Erdsatelliten, Sputnik I, erfolgreich ins All geschossen. Der Westen merkte, dass er dem Sozialismus durchaus nicht, wie angenommen, in allem und jedem überlegen war und das angreifbar war, wer technologisch zurückbleibt.
US-Präsident Eisenhower ließ daher das amerikanische Bildungssystem reformieren, damit künftig mehr Menschen die Chance auf gute Bildung bekämen. Und die meisten westlichen Staaten zogen nach.
In der Bundesrepublik spitzte sich die Diskussion unter anderem zu durch den von dem Philosophen und Pädagogen Georg Picht 1964 geprägten Begriff der Bildungskatastrophe, weil Westdeutschland den Nachbarstaaten in Sachen Bildung weit hinterherhinke. 1965 dann formulierte der Soziologe Ralf Dahndorf Forderungen nach einer aktiven Bildungspolitik unter der Überschrift Bildung ist Bürgerrecht.
Quer durch die Parteien waren sich die Politiker einig, dass in die Bildung investiert werden sollte. Und überall im Land wurden neue Hochschulen und Universitäten gegründet. Die Bildungsausgaben in Westdeutschland stiegen zwischen 1965 und 1973 von 15,7 auf fast 45 Milliarden D-Mark.
Eberhard Brandt erinnert sich, dass das Thema Bildung damals in den Medien quasi omnipräsent war, egal ob in den Tageszeitungen oder im Fernsehen. Einige Schlagzeilen hat er sogar bis heute nicht vergessen. Ja, also ganz stark war eben die Aussage von Picht von der drohenden Bildungskatastrophe. Also das wurde hoch und runter dekliniert. Uns fehlen die Akademiker. Deutschland wird sich ökonomisch nicht entwickeln, wenn wir nicht mehr Akademiker haben. Das war eine massive Schlagzeile.
Und dann die Auseinandersetzung bei der Bildung einer neuen Bundesregierung, wo Willy Brandt mit der FDP eine Koalition einging. Die FDP hat gesagt: "Wir brauchen Bildungsreform." Da gab es öffentliche Diskussionsforen. Im Fernsehen wurden die Debatten übertragen: "Wir brauchen Bildungsreform." Und die FDP sagte damals: "Wir brauchen die offene Schule."
Das war eine Gesamtschule, die hatten noch einen anderen Namen dafür. Das war plötzlich überall zu lesen und zu hören. Und die Bilder habe ich noch fast vor Augen. Die heftigen Diskussionen, an die sich Eberhard Brandt erinnert, waren ein Zeichen für die breite gesellschaftliche Debatte, die um die Bildungsreform geführt wurde. Und die Gesamtschule, um die wurde besonders heftig gestritten.
Der Ausgangspunkt war auch für Eberhard Brandt ein anderer. Er erzählt, dass das Gymnasium seiner Schulzeit noch eine sehr elitäre Bildungseinrichtung war. Als ich das Gymnasium besucht habe in den 60er Jahren, da waren ungefähr 15 Prozent eines Jahrgangs, die auf das Gymnasium kamen.
Als die Zahl der Gymnasiasten anstieg, hat der Philologenverband und haben konservative Elternverbände gesagt, nur sechs Prozent, höchstens sieben Prozent sind begabt genug, das Gymnasium zu schaffen. Also wenn mehr das Abitur machen, dann sinkt das Niveau. Die haben also eine statische Bildungstheorie vertreten und sagten, die, die oben sind in der Gesellschaft, die sind deswegen oben, weil sie intelligenter sind, die anderen sind einfach dümmer und zwar von Geburt. Musik
Wobei es nicht nur die viel zitierten Arbeiterkinder waren, die im deutschen Bildungssystem benachteiligt waren. Wer auf dem Land lebte, hatte weniger Chancen, eine weiterführende Schule zu besuchen als ein Stadtkind, Katholiken weniger als Protestanten und Frauen weniger als Männer. Auch heute reden wir noch über schlechtere Chancen auf eine weiterführende Bildung, etwa für Kinder mit Migrationshintergrund oder aus bestimmten benachteiligten Stadtteilen.
Aber die Zahlen zeigen, dass die Bildungsexpansion der 60er Jahre schon etwas verändert hat.
1970 haben 11,4 Prozent eines Jahrgangs Abitur oder Fachabitur gemacht, 1990 waren es 33,8 Prozent. Und die Studentenzahlen stiegen von 510.000 im Jahr 1970 auf über eine Million im Jahr 1980 und 1,52 Millionen im Jahr 1990.
Allerdings muss es, so wie Eberhard Brandt es schildert, für Kinder, die nicht aus Akademikerfamilien kamen, anfangs ganz schön schwer gewesen sein, sich in den weiterführenden Schulen durchzusetzen. Da habe es so etwas wie einen sozialen Ausleseprozess gegeben. Früher, von denen, die anfingen, kam nur ein Drittel durch. Zwei Drittel wurden, wie man damals sagte, abgesägt.
Manche waren dann froh, dass sie es bis zur 10. Klasse geschafft hatten. Und wir haben aber gemerkt, mit welchen Mechanismen einige der Lehrkräfte gearbeitet haben, um unliebsame Schüler auch richtig fertig zu machen. Also was war das zum Beispiel? Wie hat sich das bemerkbar gemacht? Die wurden scharf abgefragt. Und dann konnte man ihnen nachweisen, dass sie schlechte Noten hatten. Oder die haben aus dem Klassenbuch vorgelesen, was ist der Vater von Beruf? Das hieß dann VW-Arbeiter, na, was willst du hier?
Bei mir trauten sich das die Lehrer nicht. Meine Eltern waren beide Naturwissenschaftler, hatten ein Diplom. Mein Vater eine gute Stellung beim Volkswagenwerk. Und da war es so, mich ließen sie in Ruhe, die anderen wurden gepiesackt. Und das hat mich wahnsinnig gestört. Weil Sie halt Akademikerkind waren. Genau. Akademikerkinder wurden eben anders angesehen, anders behandelt. Und wer nicht aus diesem Stand kam, der wurde erkennbar schlechter angesprochen.
Also so, dass denen deutlich war, ich bin hier nicht erwünscht. Das kann man auch durch nonverbale Kommunikation deutlich machen.
Auch wenn er selbst nicht betroffen war, machte Eberhard Brandt dieses, ja man kann ja fast schon sagen, vergiftete Klima im Klassenzimmer ganz schön zu schaffen. Auch weil er von seiner Mutter, die Selbstlehrerin war, einen ganz anderen Umgang mit Schülern kannte und das damals als sehr unfair empfand, wie da einige seiner Mitschüler behandelt wurden. Diese Erniedrigung war für mich direkt spürbar und die hat mich gestärkt.
Die war auch ein Motiv, warum ich mir gesagt habe, Schule muss anders funktionieren, als sie damals funktionierte. Sein politisches Denken und Engagement kommt natürlich nicht von ungefähr. Er hat mir erzählt, dass er früh durch sein Elternhaus politisiert worden ist und ihm deshalb schnell klar geworden sei, dass er etwas verändern wolle, aber es sei auch eine allgemeine Entwicklung gewesen. Das kippt praktisch von Jahrgang zu Jahrgang.
Und in meinem Jahrgang, wo ich dann auch die Abiturientenrede gehalten habe am Theodor-Heuss-Gymnasium in Wolfsburg, war es so, dass da plötzlich die Mehrheit linksorientiert war. Vorher gingen alle Jungs geschlossen als Offiziere zur Bundeswehr. In unserem Jahrgang haben fast alle verweigert. Also da kippte die Stimmung. Es gab dann auch ein paar Rechtsorientierte, aber die Kimmung kippte generell, kann man sagen. Musik
Der Ruf nach Veränderung, den die Studentenbewegung in der zweiten Hälfte der 60er Jahre auf die Straßen getragen hatte, erreichte dann auch die Schulen. Und wie Eberhard Brandt es schildert, waren die Abiturienten nicht mehr bereit, einfach starr althergebrachten Ritualen zu folgen, sondern sie sprachen aus, was sie dachten, womit er bei seiner Abiturrede dann allerdings doch noch für einen kleinen Eklat sorgte.
Mein Abitur war 1969 und da habe ich dann eine Rede gehalten, in der ich als Sprecher der Abiturienten, ich war vorher Schülervertreter gewesen,
Da habe ich mich für Reformen des Gymnasiums ausgesprochen, für die gymnasiale reformierte Oberstufe, die wir schon an unserer Schule auch eingeführt hatten. Und habe die Errichtung von Gesamtschulen gefordert und habe gesagt, bei einigen Lehrern können wir uns bedanken, weil die waren sehr förderlich. Und bei anderen müssen wir sagen, da schweigen wir lieber drüber. Und da knallten die Türen und einige rannten böse raus. Da hatten sich einige Lehrer offenbar noch nicht daran gewöhnt, dass Schüler Abiturienten zumal ihre Autorität auch mal anzweifelten.
Dabei hatten sich an vielen Schulen längst nach dem Vorbild der Universitäten unabhängige Schülervertretungen gebildet, in denen die älteren Schüler darüber diskutierten, wie Schule sich verändern sollte. Und auch spontane Aktionen gab es an den Schulen wie an den Universitäten. So berichtete ein Schuldirektor 1969 in einer NDR-Sendung. Es wurde unsere Schule beschmiert wie alle anderen Schulen auch. Die Luise-Schule als Universität.
Untertanenfabrik oder alle Lehrer sind Papiertiger oder Vögeln ist besser als Turnen, die übliche Schmiererei, die an jeder Schule einmal erscheint. Nun gut, Herr Dr. Schmecht, wie haben Sie auf diese Schmierereien reagiert? Was haben Sie veranlasst?
Wir haben dafür gesorgt, dass sie möglichst schnell beseitigt wurde und haben über das Bezirksamt Strafanzeige erstattet. Mit der Meinung, es würde sich ja irgendjemand finden lassen, der dafür verantwortlich ist. Wir legten dabei weniger Wert darauf, dass wirklich bestraft wird, als dass man die Betreffenden mal belehrt darüber, was so etwas kostet und was nun letzten Endes dabei herauskommt.
Die Sendung, in der der Direktor des Hamburger Luisengymnasiums 1969 so, ja doch relativ gelassen, über die Schmierereien an seiner Schule berichtete, trug den Titel Klassenkampf im Lehrerzimmer und bemühte sich, sowohl konservative als auch progressive Lehrer zu Wort kommen zu lassen, mit klarer Sympathie der Reporter für die progressive Seite.
Für diese beschreibt ein jüngerer Studienrat, wie er ohne Nennung des Namens genannt wird, seine Position, die zu einer Generalabrechnung mit der Schule in ihrer gegenwärtigen Form gerät. Ich glaube, dass zum Beispiel ein Großteil der Fächer, die wir heute treiben,
keine eigentliche Motivation finden können. Wir gehen von einem Bildungsbegriff aus, und ich würde sagen sowohl die Älteren wie auch die meisten jüngeren Kollegen, der aus der Tradition stammt, der sich aber von heute aus, von einem systematischen Denken von heute aus, nicht mehr rechtfertigen lässt. Und wir müssen daran gehen, die ganze Didaktik der Schule neu zu überdenken.
Und er beschreibt auch konkret, wo er ein grundlegendes Problem sieht. Vielleicht ist ein Hauptmangel überhaupt unserer ganzen pädagogischen Ausbildung, dass wir nach wie vor wohl in einer ganz großen Mehrheit am Frontalunterricht festhalten und das uns als die fast einzig
praktisch mögliche Unterrichtsform erscheint, dass wir kaum in der Lage sind, andere Unterrichtsformen einzuführen und das heißt, dass wir notwendigerweise die mögliche Selbsttätigkeit der Schüler auf ein Mindestmaß beschränken und damit also viele Probleme im Frontalunterricht mit einer Klasse von 20, 30 oder mehr Schülern, viele Probleme auftreten, die unnötige Schwierigkeiten machen und die auf das Ziel hin, nämlich den
den Schüler zum selbstständig über bestimmte Dinge nachdenkenden Menschen zu erzielen, auf dieses Ziel hin nicht sinnvoll bezogen werden können.
Der junge Lehrer wendet sich gegen den Frontalunterricht. Etwas anderes gab es damals eigentlich kaum. Entscheidend aber ist der Schluss seiner Aussage, wo er als Ziel des Unterrichts nennt, Schüler zu selbstständig nachdenkenden Menschen zu machen. Das ist das Gegenteil von einer Untertanenfabrik, wie die aufmüpfigen Schüler des Luisengymnasiums in ihren Schmierereien die Schule nannten.
Da halte die Auseinandersetzung um die Verantwortung für den Nationalsozialismus nach, der auch die deutsche Studentenbewegung geprägt hatte. So hatten sich das viele, die sich bis dahin für Bildungsreformen ausgesprochen hatten, dann aber doch nicht gedacht. Der bildungspolitische Reformkonsens über die Parteien hinweg erodierte ab dem Amtsantritt der sozialliberalen Koalition unter Willy Brandt 1969.
Das bürgerliche Lager musste feststellen, dass es die politische Macht im Land nicht auf ewig gepachtet hatte. Konservative Politiker machten sich zu Sprechern einer bürgerlichen Schicht, die ihre Privilegien gefährdet sahen.
Viele Eltern, die sich dann gegen Neuerungen wertend hatten, das vermutlich gar nicht bewusst zur Verteidigung eines elitären Status für ihre Familien, sondern sie sorgten sich tatsächlich um das Bildungsniveau ihrer Kinder, wenn in der reformierten Oberstufe nicht mehr wie seit Generationen Latein und Altgriechisch
als Ausweis akademischer Reife abgerufen wurden, sondern Naturwissenschaften eine große Rolle spielten oder gar die politisch heftig umstrittenen gesellschaftswissenschaftlichen Fächer. Und wie konnten in einer integrierten Gesamtschule herausragende Begabungen gefördert werden, wenn gleichzeitig viele Kinder zum Abitur geführt werden sollten?
dass auch die traditionellen Gymnasien nicht nur von herausragenden Begabungen besucht wurden und viele bürgerliche Sprösslinge sich nur dank vielfältiger privater Nachhilfestunden zum Abitur durchhangelten, das fiel dabei unter den Tisch.
Eberhard Brandt hat sich 1969 nach dem Abitur ganz bewusst dafür entschieden, Geschichte, Politikwissenschaft und Pädagogik zu studieren. Denn daran, dass er Lehrer werden wollte, hatte er keinen Zweifel. Naja, das sind sicher mehrere Gründe. Das eine ist, wir hatten junge Lehrkräfte, die waren sehr inspirierend und die waren auch Vorbilder. Und wir hatten so Lehrkräfte, die traumatisiert waren aus dem Zweiten Weltkrieg.
die immer ihre Kriegserlebnisse erzählt haben und die furchtbar autoritär waren. Und ich habe mir gedacht: Schule muss anders werden, man muss sich anders verhalten, man kann das auch. Ich merke ja, dass es geht. Das ist einer der Gründe. Das andere ist ein familiärer. Also mein Großvater war Lehrer, wurde 1933 entlassen. Meine Mutter ist davon geprägt, die wurde auch Lehrerin. Und so dass wir viel über Schulfragen diskutiert haben und ich habe gedacht: Ach, das ist ein toller Job. Das machst du.
Eberhard Brand war damals nicht der Einzige, der sich für ein Lehrerstudium entschied. Er erzählt von einer regelrechten Aufbruchsstimmung, die unter den Lehramtsstudierenden herrschte und wie er an seinem Studienort Marburg mit dem Gesamtschulvirus, wenn man so will, infiziert wurde. Da hat Professor Klaffke, der die ersten Gesamtschulen errichtet hat, mit seinen Mitarbeitern Seminare gemacht zum Thema Schulsystem, Schulreform, Gesamtschule, Reform der Universität.
Und das fanden wir spannend und haben daraus viel für uns, für unsere eigene Überzeugung auch gewinnen können. Und in den Fächern haben wir uns auch überlegt: Ja, was kann man denn fachlich anfangen in der Schule mit dem, was wir da machen? Haben Basisgruppen gebildet, wo wir mit vielen anderen zum Teil ein Parallelstudium gemacht haben zu dem offiziellen, wo wir uns nochmal zusätzlich jede Woche getroffen haben, um Parallelseminare zu machen. Also das haben wir schon selbst organisiert.
Und das war ein sehr solidarisches Element. Wir machen das zusammen. Die integrierte Gesamtschule, in der die Kinder gemeinsam unterrichtet und zu dem ihnen gemäßen Bildungsabschluss geführt werden, hatte sich in anderen Ländern längst bewährt.
Auch in Westdeutschland wollten die Alliierten nach dem Krieg eine möglichst lange gemeinsame Beschulung aller Kinder nach amerikanischem Vorbild einführen, weil sie das gegliederte deutsche Schulsystem für Unterwürfigkeit und einen Mangel an Selbstbestimmung verantwortlich machten, der das autoritäre Führerprinzip des Nationalsozialismus ermöglicht habe.
Sie bestanden dann aber angesichts heftigen Widerstands vor allem aus den konservativen Bundesländern nicht darauf, während in der DDR die Einheitsschule eingeführt wurde.
Gutachten und Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Schulen in der Bundesrepublik gab es dann ab Mitte der 50er Jahre. Ab 1970 nahm sich die neu geschaffene Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung der Sache an. Da wurde zum Beispiel das Züchtigungsrecht der Lehrkräfte abgeschafft. Es wurde beschlossen, dass dem sozialen Lernen neben dem fachlichen Lernen mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden müsse.
Reformpädagogische Lehrformen, also zum Beispiel Gruppenunterricht, gewannen an Bedeutung. Der Unterricht sollte schüler- und handlungsorientierter werden. Außerdem gab es eine Reform der Volksschule. Die Oberstufe wurde von der Grundschule getrennt und um ein neuntes Schuljahr verlängert.
Und im Rahmen von Schulversuchen sollte außerdem eine begrenzte Zahl von Gesamtschulen eingerichtet werden. Und nach wissenschaftlichen Begleituntersuchungen sollte dann darüber entschieden werden, ob diese neue Schulform Gesamtschule flächendeckend eingeführt wird, wozu es dann allerdings nicht kam. Gesamtschule, ja oder nein?
Daran schieden sich je nach politischer Einstellung die Geister. Bundesbildungsminister Klaus von Donany beschrieb die Lage im April 1972 so. Wir haben uns in den Zielen der Reform in vielen Punkten einigen können. Der große Streit liegt in der einen Frage, soll man in Zukunft in der Bundesrepublik eine Schule haben, in der man
den Kindern die Möglichkeit gibt, möglichst spät sich auf bestimmte Bildungsgänge festzulegen oder soll man wie bisher mit zehn oder vielleicht eines Tages mit zwölf Jahren gewissermaßen die Weichen in der Schule dadurch stellen, dass die Kinder verschiedene Schulen, Hauptschule, Realschule und Gymnasium besuchen.
Und als SPD-Minister setzt er hinzu mit einer politischen Gewissheit, die die Ergebnisse wissenschaftlicher Begleitstudien offenkundig nicht abwarten wollte. Wir sind für diese eine Gesamtschule, innerhalb derer man unterschiedliche Begabungen fördern und entwickeln kann.
Die Entscheidung darüber ist für die Sozialdemokraten faktisch gefallen, wenn auch die Ausfüllung dieses Konzeptes und seine Durchsetzung schrittweise und langfristig nur möglich sein wird.
1972 wurde auch in Wolfsburg eine Gesamtschule eingerichtet, an der Eberhard Brandt danach Abschluss seines Studiums ab 1978 unterrichtet hat. An seine ersten Tage als Lehrer erinnert er sich noch ganz genau, nicht nur aus pädagogischen Gründen. Ja, also erstens waren wir alle sehr jung. Und die Kolleginnen waren besonders jung, die kamen ja von der pädagogischen Hochschule.
Wenn dann ein Kollegium überwiegend aus 23- bis 27-Jährigen besteht, da war das natürlich auch eine sehr spannende Sache, weil wir auch in der Frage der Partnersuche und der Familienbildung waren. Und da tat sich auch viel. Also das war auch, das knisterte auch. Also wenn Sie mich so fragen, das fand ich schon sehr spannend. Da muss ich kurz einhaken, sind Sie dann auch fündig geworden? Ja, aber nicht im Kollegium. Nein, nein.
Ja, und das andere war, wir wollten eben Schule anders machen und hatten das große Glück durch einen Kultusminister, Peter von Oertzen. Für uns gab es keine Erlasse, keine Richtlinien in den Fächern. Wir mussten alles selbst entwickeln. Wir durften alles selbst entwickeln und das mussten wir dokumentieren.
Also daran haben wir gearbeitet. Und da haben wir dann auch nicht so auf die Uhr geguckt, sondern wir haben da sehr viele Grundsatzdiskussionen geführt. Dabei sind übrigens auch neue Lehrbücher entstanden von Kollegen, die daran besonders engagiert gearbeitet haben. Aber das war schon toll. Und dann waren wir sozusagen frei, weitgehend. Natürlich gab es Kontrolle, aber wir waren weitgehend frei. Wir hatten keine Zensuren.
die es ja bis heute an den Gesamtschulen in Niedersachsen nicht gibt bis zum achten Jahrgang. Und das hat uns schon viel Spaß gemacht. Einen Klassenkampf im Lehrerzimmer, wie es in der NDR-Sendung von 1969 hieß, habe es da nicht gegeben. In seiner Erinnerung haben alle an einem Strang gezogen. Na, also die älteren Kollegen, die an die Gesamtschule sich beworben hatten, die wollten ja die Reform.
Die Konservativen, die spielten da in solchen Gesamtschulkollegien keine große Rolle. Wem das nicht gefiel, wie man offen mit Schülern umgeht oder dass man eben auch selbstverständlich Klassenfahrten macht und
Projektunterricht und ja an sich arbeitet sich zu verändern auch seine Persönlichkeit zu entwickeln. Wem das nicht gefiel, da waren wir dann doch froh und haben notfalls nachgeholfen und gesagt such dir doch was anderes.
Und anders, als man es vielleicht vermuten könnte, hätten auch nicht nur sozialdemokratisch eingestellte Eltern ihre Kinder an die Gesamtschule geschickt. Diese Vorstellung, dass also Kinder gleiche Chancen haben, hat viele motiviert. Es gab sehr viele Anmeldungen. Und dann muss man sagen, es gab unter den Bildungsbürgern, unter den Akademikern, ob jetzt Journalisten, Pfarrer, Rechtsanwälte,
Lehrer gab es viele, die ihre Kinder bewusst auch an diese Schule geschickt haben. Übrigens aus allen Parteien damals in den niedersächsischen Städten. Auch Kinder von führenden CDU- und FDP-Leuten waren da drin und wollten das. Und ja, insoweit war das sehr lebendig. Der Elternratsvorsitzende der Schule kann mal so als Typ stehen. Der war Hauptabteilungsleiter im Volkswagen-Werk, zuständig für Tarifwesen.
Dessen Kinder hätten natürlich locker an jedem Gymnasium auch Abitur machen können. Der hat aber gesagt, ja, diese Schule muss wirklich eine Alternative sein. Wir brauchen die Schule.
Beim Volkswagenwerk ist es so ein Problem, wenn die Ingenieure sich mit den Arbeitern nicht verstehen, weil die keine gemeinsame Sprache sprechen. Wir brauchen das gemeinsame Lernen. Und der stand für die Schule ein, als CDU-Mitglied, als Hoher. Und der hat gegenüber dem Kultusministerium massiv die Interessen der Schule vertreten.
Also das war auch schon eine soziale Integration, die da stattgefunden hat. Es war nicht einfach nur linkes Rebellentum oder sowas, sondern das war auch schon eine sehr ernsthafte Arbeit. Musik
Das war schon eine sehr ernsthafte Arbeit, sagt Eberhard Brandt über das Ringen um die neue Schulform an seiner Gesamtschule. Ein Satz, der sicher auch daraus resultiert, dass die sozialdemokratische Bildungspolitik ab einem bestimmten Punkt von ihren Gegnern generell unter Ideologieverdacht gestellt wurde. Deutlich wurde das etwa in Aussagen des Hamburger CDU-Abgeordneten Volker Rühe aus dem Jahr 1978. Entscheidender Punkt ist der,
dass wir kein neues System den Hamburger Eltern, Schülern und Lehrern verordnen wollen, wie die Sozialdemokraten und die FDP. Wir meinen, dass die Schulen in den vergangenen Jahren von einer Veränderung in die andere gehetzt worden sind und dass sie jetzt in erster Linie Ruhe brauchen. Deswegen wollen wir
die nächsten vier Jahre nutzen, um im Rahmen des gewachsenen Systems Verbesserungen anzubringen. Insbesondere dadurch, dass wir den sich abzeichnenden Rückgang der Schülerzahlen nutzen, um zu kleineren Klassen, aber auch zu kleineren und überschaubaren Schulen zu kommen. Darüber hinaus
Wollen wir, dass die Schulen nicht mehr länger als ein Hebel zur gesellschaftspolitischen Veränderung missbraucht werden, sondern dass die Schulen wieder stärker respektiert werden als ein pädagogischer Raum, in dem auch die Erziehung wieder stärker in den Mittelpunkt gerückt wird.
Da klingt Mut zur Erziehung an. Das war der Titel eines Kongresses vom Januar 1978, bei dem konservative Wissenschaftler, Lehrer und Eltern sich massiv gegen anti-autoritäre Bildungsreformen wandten und das verstärkte sich dann in den kommenden Jahren. Musik
Eberhard Brand erzählt, dass es aber auch innerhalb des konservativen Lagers durchaus unterschiedliche Positionen gab. Niedersachsen war etwas anderes als Bayern. Naja, das eine war, wir haben die CDU, die dann an die Regierung gekommen war, als ich eingestellt wurde, die wollte die Gesamtschulen massiv knebeln und wollte sie zum Teil sogar abschaffen.
Und dann zeigte sich, und da war ich dann in der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft aktiv, der GEW, dass also ein Kultusminister wie Walter Remmers, der ein liberaler CDU-Mann aus dem Emsland war, gesagt hat, nee, wir schaffen die Gesamtschulen nicht ab, das macht meine Partei beschlossen haben. Wir machen mal eine wissenschaftliche Überprüfung und dann schauen wir mal, wie es weitergeht.
Das heißt also, man konnte auch im konservativen Lager liberale Leute finden und damals wurden die Gesamtschulen in Ruhe gelassen. Später war das nicht der Fall. Der niedersächsische Kultusminister Walter Remmers von der CDU vertrat in der Tat eine andere Linie als die Bildungshardliner in der Union.
In einem NDR-Interview aus dem Jahr 1979 forderte er, die Schulen aus der fortdauernden politischen Konfrontation herauszuführen, während seine Partei damit in den Wahlkampf für die Bundestagswahl 1980 ziehen wollte.
Ich kriege immer am meisten Beifall, wenn ich sage, ich möchte, dass die niedersächsischen Schulen so gestaltet werden, dass alle Eltern, egal welche Partei sie wählen oder welche Partei sie angehören, ihre Kinder guten Gewissens in niedersächsische Schulen schicken können. Remmers war da gerade als stellvertretender Vorsitzender der Bund-Länder-Kommission zurückgetreten, weil dort der Streit tobte um die Anerkennung der Abschlüsse der Gesamtschulen, die einige unionsgeführte Länder verweigern wollten.
Nachdem in der Kultusministerkonferenz dann noch eine Weile darum gerungen wurde, unter welchen Bedingungen die Abschlüsse denn als gleichwertig gelten könnten, kam es 1982 zum Kompromiss. Es wurden bestimmte Kriterien für die Abschlüsse an allen Schulen festgelegt. Dafür wurden sie von allen Ländern gegenseitig anerkannt.
Walter Remmers hatte es 1979 schon prognostiziert. Ja, also ich glaube, dass hier, wie das natürlich in Vorwahlkampfzeiten und in Wahlkampfzeiten erst recht häufig ist, mal die Suppe wieder sehr viel heißer gekocht wird, als sie dann nachher auf den Tisch gegessen wird. Also da muss nochmal ein bisschen drin gerührt werden und ein bisschen gepustet werden und dann kann man die Suppe auch wieder essen. Und deshalb bin ich der Überzeugung, dass wir uns im Endeffekt auch verständigen werden.
Dass die Gesamtschulen sich zwar etablierten, aber eben nur als eine Schulform neben anderen, führt Eberhard Brandt auch darauf zurück, dass sich das Schulsystem insgesamt weiterentwickelte. Mit der Schaffung der Hauptschulen und mit Realschulen und Gymnasien, in denen sehr viel mehr Kinder unterrichtet wurden als vor der Bildungsreformdebatte. Letztlich scheiterte die Einführung der Gesamtschule als einzige Schulform in der Bundesrepublik auch am Widerstand vieler Eltern.
Die Höherqualifizierung der Bevölkerung, die sich die Bildungspolitiker in den 60er Jahren auf die Fahnen geschrieben hatten, wurde aber erreicht. Ungleichheiten in der Bildung zwischen den Regionen, Konfessionen und Geschlechtern wurden abgebaut und das Abitur blieb nicht länger ein Privileg von Kindern aus bürgerlichen Familien.
Aber die wirtschaftlichen Probleme ab 1974 schränkten die finanziellen Spielräume des Staates ein und darunter litt auch die Bildungspolitik. Die Schulen wurden zum Teil überlastet, die Hochschulen entwickelten sich zu Massenuniversitäten. Für Eberhard Brandt ist das Thema Bildung auch heute noch eine Herzensangelegenheit. Das wurde während unseres Gesprächs immer wieder deutlich. Er ist halt Lehrer durch und durch.
Und auch rückblickend ist der 71-Jährige mit der damaligen Entwicklung zufrieden. Und er bleibt ein Gesamtschulfan. Also für meine Biografie war es so, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir haben sehr viel Klassenfahrten gemacht. Wir haben mit Teams in Kollegen Klassen betreut.
Und bei einem ehemaligen Treffen, was jetzt war, kamen Schüler, einige jetzt schon auch in Rente, so lange ist das ja her, wo ich dann gemerkt habe, ja, das hat sich gelohnt. Und das ist eine sehr lohnende Investition, diese viele Arbeit gewesen. Und gesellschaftlich, denke ich, hat es einiges verändert. Die Gymnasien kamen eben unter Druck, das Schulsystem kam unter Druck.
Werner Remmers hat mal gesagt, die Gesamtschulen sind der Stachel im Fleisch des gegliederten Schulsystems. Sonst entwickelt sich das nicht. Er hat gesagt, allein deswegen brauchen wir sie, damit sich pädagogisch was ändert. Ich glaube schon, dass sich vieles an pädagogischen Grundhaltungen bewährt und weiterentwickelt hat. Aber es ist weiter durch verschiedene Tendenzen aktuell in Gefahr.
Das katholische Arbeitermädchen vom Land galt zu Beginn der Bildungsreformdebatte als der im Begriff des benachteiligten Kindes, dem mehr Bildungschancen eröffnet werden müssten.
Doch auch gebildete Frauen waren in den 70er Jahren alles andere als gleichberechtigt. In der neuen Frauenbewegung kämpften sie um ihre Rechte. Darum geht es in der nächsten Folge von Deine Geschichte, unsere Geschichte. Frauen, wir tun uns zusammen. Frauen, wir tun uns zusammen. Frauen, wir tun uns zusammen. Gemeinsam sind wir stark.
Unsere Zeitzeugin ist dann die Hochschullehrerin Angelika Henschel. Sie hat sich schon in jungen Jahren für andere Frauen engagiert und war 1977 zum Beispiel Gründungsmitglied des Vereins Frauen helfen Frauen Lübeck. Gemeinsam mit ihren Mitstreiterinnen wollten sie damals nach dem Londoner Vorbild ein autonomes Frauenhaus in der Stadt eröffnen.
Sabine und Jacqueline haben den Podcast diesmal mit uns produziert. Alle Podcast-Folgen finden Sie, findet ihr in der ARD-Audiothek. Fotos, Filme und Texte zu den einzelnen Folgen gibt es unter ndr.de-geschichte. Und über Lob und Kritik freuen wir uns unter der E-Mail-Adresse deinegeschichte.ndr.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ein Podcast von NDR Info.
Untertitelung des ZDF, 2020