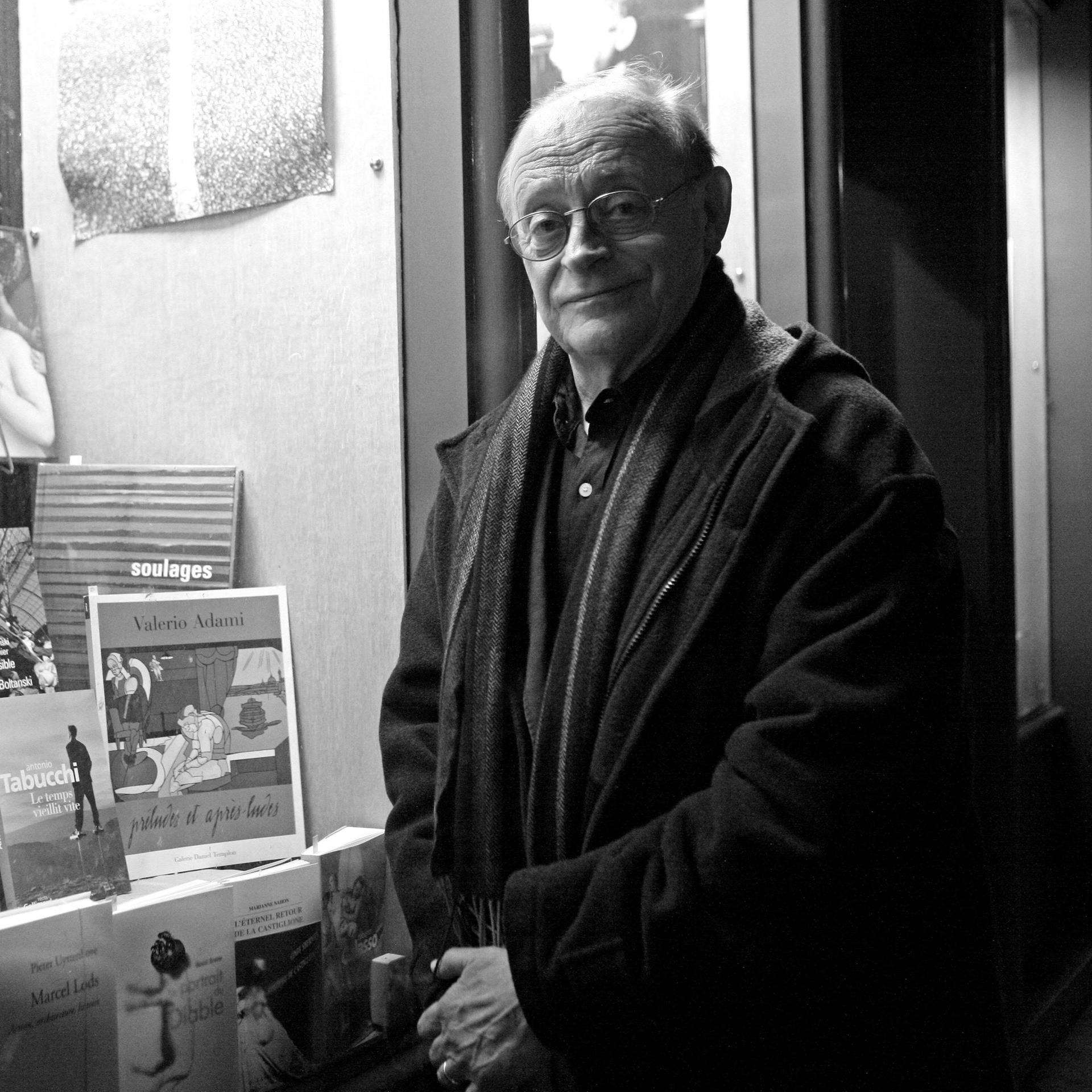
- Antonio Tabucchi war ein Meister der literarischen Melancholie.
- Er war ein politisch engagierter Intellektueller, der für Demokratie und Freiheit eintrat.
- Tabucchi ist bekannt für seine Verbindung zum portugiesischen Schriftsteller Fernando Pessoa.
- Seine Werke wurden weltweit übersetzt und verfilmt.
- Tabucchi erhielt zahlreiche Auszeichnungen und war für den Nobelpreis im Gespräch.
Shownotes Transcript
Ein ideenreicher Erzähler war der italienische Autor Antonio Tabucchi, in dessen Romanen Träume geträumt und Figuren auf Abwege geraten. Ein Erzähler, der sich der Fiktion des Fiktionalen immer bewusst war und zugleich ein politisch engagierter Intellektueller, der für die Demokratie und die Freiheit des Wortes und der Kunst eintrat. Das geht beides zusammen, gehört vielleicht sogar zusammen.
Etwa in seinem bekanntesten Werk Erklärt Pereira, das 1995 auch mit Marcello Mastroianni verfilmt wurde. Seien Sie gespannt auf Die Lange Nacht über Antonio Tabucchi von Christiana Coletti. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl. Ich bin der Redakteur der Langen Nacht. Sie erreichen mich wie immer unter langenacht.deutschlandfunk.de
Nächste Woche erwartet sie an dieser Stelle eine lange Nacht über Formen der Familie, die längst nicht mehr nur dem heiligen Vorbild folgt, sondern viele Ausprägungen gefunden hat, als Patchwork, als Mosaik, mit nur einem Elternteil oder auch mit drei. Seien Sie gespannt auf einen Blick zurück in die Geschichte der Familie, in andere, auch matrilineare Kulturen und in unsere vielfältige Gegenwart.
Sie können alle Lange Nächte der letzten Monate auch in der Deutschlandfunk-App nachhören. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche. Warum schreiben wir?
Es ist eine unvermeidliche Frage, die immer wieder auf Schriftsteller zurückkommt. Schreibt man, weil man Angst vor dem Tod hat? Das ist möglich. Oder schreibt man, weil man Angst vor dem Leben hat? Auch das ist möglich.
Antonio Tabuchi war einer der größten italienischen Schriftsteller der Gegenwart, Philologe und Professor für portugiesische Literatur.
Ein unbeugsamer und kämpferischer Geist, der an den Sinn und die Notwendigkeit des Schreibens glaubte. Schreibt man, weil man Sehnsucht nach der Kindheit hat? Weil die Zeit zu schnell vergangen ist? Oder weil die Zeit zu schnell vergeht und wir sie gerne ein wenig aufhalten würden, damit sie langsamer vergeht?
Schreibt man gewissermaßen aus Bedauern, weil man etwas Bestimmtes gerne getan hätte und es nicht getan hat? Oder schreibt man stattdessen aus Reue, weil man es nicht getan hat?
weil man etwas nicht hätte tun sollen und es doch getan hat? Schreibt man, weil man hier ist, aber gerne dort wäre? Oder schreibt man, weil man dorthin gegangen ist, es aber alles in allem besser gewesen wäre, hier zu bleiben? Oder schreibt man, weil es am besten wäre, dort zu sein, wo wir hinwollten?
Aber trotzdem ein bisschen hier zu sein, wo wir waren? Die Stimme von Antonio Tabuchi ist unverwechselbar. Sein Timbre, die Nuancen des tuskanischen Akzents, der Klang, der es schafft, seinen festen Worten ein gewisses Gefühl von Unbestimmtheit, von Grenzenlosigkeit zu verleihen.
Tabuki war ein europäischer Intellektueller, der sich nicht an einem Ort zu Hause fühlte, sondern in seiner Sprache, Italienisch. Doch er beherrschte viele Sprachen, Portugiesisch, Französisch, Spanisch, Englisch. So umfangreich sein Wissen war, so umfangreich und international war auch sein Publikum.
Als einzigartiger Autor von Kurzgeschichten und Romanen wie Erklärt Pereira, Die Frau von Portopim oder Tristan stirbt, wurde Tabuki weltweit berühmt und übersetzt. Unter seinen verfilmten Romanen ist Erklärt Pereira mit Marcello Mastroianni in der Hauptrolle sicher der bekannteste. In Italien hat er sich auch einen Namen gemacht als Herausgeber der Werke des portugiesischen Schriftstellers Fernando Psoa.
Antonio Tabuchi hat für sein Werk zahlreiche Auszeichnungen erhalten und war immer wieder für den Nobelpreis im Gespräch. Als er 2012 starb, trauerte man in der ganzen Welt um ihn.
Der italienische Schriftsteller Antonio Tabucchi ist tot. In Italien war Tabucchi jedoch eine umstrittene Figur. Ein unbequemer Intellektueller für einige, der in der Zeit, in der er lebte,
Ein Bezugspunkt für andere, für viele kann man wahrscheinlich sagen. In den letzten Jahren hatte er sich vor allem durch sein kämpferisches Engagement hervorgetan und war ein überzeugter Gegner Berlusconis und dessen Entpolitisierung von Politik.
Nicht nur als Universitätsprofessor, sondern vor allem als Schriftsteller wollte er die Bedeutung und den Wert der Literatur im weitesten Sinne durch öffentliche Auftritte bei Literaturfestivals, im Radio oder im Fernsehen vermitteln. Wie bei diesem vom Verlag Feltrinelli organisierten Gespräch mit dem Autor im Jahr 2009. Die Literatur hilft auch, uns in diese Zeit zu erinnern.
Die Literatur dient auch dazu, uns in diesen dunklen Tunnel zu führen, der wir sind. In diese Dunkelheit, aus der wir gemacht sind. Die Literatur steckt uns eine kleine Glühbirne über den Kopf. Und wir tasten im Dunkeln, ohne nach einer Lösung zu suchen. Ich glaube, deshalb gibt es zum Glück auch weiterhin Literatur, weil man nie etwas entdeckt. Manche Menschen, die sich in der Literatur befinden,
Man versteht vielleicht etwas mehr in diesem dunklen Tunnel, der unsere Menschenseele ist. Tabuki ist Autor von geheimnisvollen Geschichten voller Resonanzen, Anspielungen und Offenbarungen, die uns die Wirklichkeit aus immer neuen Perspektiven wiedergeben. Sie konfrontieren uns mit den Rätseln des Daseins und mit einem Blick auf das Leben, der zugleich bewusster und verlorener wirkt.
Es sind Geschichten des Zweifels und der Infragestellung, Geschichten über die Wirklichkeit als eine Kombination von undurchschaubar miteinander verbundenen Elementen. Borges sagte, dass die Literatur kein Zug ist, der an der Oberfläche fährt, sondern ein karstiger Fluss, der plötzlich auftaucht, wo und wann immer es ihm gefällt.
Eine Geschichte, eine Erzählung, die Idee für einen Roman kommt aus dem Nichts. In diesem Fall ist es schwierig, sich auf die Suche nach der Quelle zu machen. Sicherlich hat sie ihren Ursprung, den man auch erklären könnte,
Aber man muss so tief unter die Erde gehen, dass es sehr schwer ist, sie zu finden. Antonio Tabucchi im Gespräch mit dem Schriftsteller Marco Aloni im Jahr 2008. Eine Aufnahme aus dem Archiv des Senders RSI. Manchmal schwebt die Idee wie ein Luftballon plötzlich über dem Kopf. Manchmal ist es ein unbewusster Schnitt.
Man hat einen Satz hier aufgeschnappt, eine Szene dort gesehen, aber nicht sofort einen Zusammenhang entdeckt. Denn eigentlich gibt es überhaupt keine Verbindung zwischen einem Satz, den zwei alte Damen zueinander sagen, und einem Jungen, der auf einem Esel oder in einem Bus auf der anderen Seite der Landschaft sitzt. Die Literatur stellt Verbindungen her. Warum sie sie herstellt, weiß ich nicht. Aber sie tut es.
An einem bestimmten Punkt entsteht etwas, das man Geschichte nennt und das zwei Elemente zusammenbringt, die für sich genommen nicht miteinander kommunizieren. Für diejenigen, die Tabuki lesen, entfaltet sich eine Art literarischer Zauber.
Es entsteht sofort eine unverwechselbare Stimmung, die bei jedem Roman, jeder Erzählung, jedem Wort Tabukis immer wieder zu spüren ist und in Erinnerung bleibt. In seinen Geschichten glaubt man stets, den Klang einer melancholischen, unvollendeten Melodie zu erlauschen. Wie zum Beispiel im indischen Nachtstück. Das Dämmerlicht verbreitet eine verträumte Stimmung, die Begegnungen mit Schatten begünstigt. Musik
Dieses Buch ist nicht nur das Ergebnis von Schlaflosigkeit, sondern auch eine Reise. Die Schlaflosigkeit gehört dem, der das Buch geschrieben hat. Die Reise dem, der sie unternahm. Antonio Tapuki, Vorwort zum Roman »Indisches Nachtstück«. Da jedoch auch ich dieselben Orte aufgesucht habe wie der Protagonist der Geschichte, hielt ich es für angebracht, eine kurze Liste dieser Orte beizulegen.
Ich weiß nicht, ob dazu die Illusion beigetragen hat, ein topografisches Verzeichnis könne, dank der Kraft des Realen, ein Licht auf dieses Nachtstück werfen, das von der Suche nach einem Schatten handelt. Oder vielmehr die unsinnige Annahme, ein Liebhaber zielloser Reisen könne es eines Tages als Führer verwenden. Naja, erstens ist es ein ungewöhnliches Buch. Und es ist das erste Buch, das ich von ihm sozusagen...
doch viel intensiver gelesen habe als die kleinen Geschichten im Gatsby. Das heißt immer, das ist das Kennenlernbuch. Es gibt einen italienischen Autor, der eine sehr verrückte Geschichte schreibt, wie einer
nach Indien geht und dort dann auf eine geheimnisvolle Weise immer weiter verwiesen wird. Das heißt, die Identität der Person, des Erzählers, löst sich so langsam auf. Das ist eine Geschichte, die eben auch nicht wie sonst, so ganz kurze Geschichten, irgendwie zu einem Ende kommt, mit einem erkennbaren Schluss.
Es ist auch keine Novelle mit einem Höhepunkt am Ende, sondern es ist eine, die sich ganz offensichtlich in dieses indische Denken hineinversetzt hat. Der schriftstellerische Eros von Tabuki war, Geschichten zu erzählen. Das war auch seine tiefste Überzeugung. Ich erzähle Geschichten.
Geschichten sind Erzählungen über uns selber. Das ist das Einzige, was den Menschen von allen anderen Lebewesen unterscheidet. Also wir müssen, wir leben davon, Geschichten zu erzählen. Und das ist mit dem ersten Band, aber auch mit dem indischen Nachtstück, ist das auf eine sehr wunderbare Weise erfüllt. Es sind Geschichten, die alle sozusagen erzählen.
einen doppelten Boden haben, wenn man so will. Sie spielen mit der Realität, sie spielen mit der Einbildungskraft,
die sich an irgendeiner Alltäglichkeit entzündet. In dem Fall ist es, jemand sucht nach einem verschwundenen Freund und fährt eben nach Indien. Und von dort geht es immer weiter, ohne dass es eigentlich zu einem Ende kommt, so wie es eben eigentlich auch im Leben kein Ende hat, außer im Tod. Ich genieße es wirklich, den Geschichten anderer Leute zuzuhören.
Ich bin ein sehr aufmerksamer Zuhörer. Ich mag es auch, ihre Geschichten zu stehlen. Sobald ich zwei Menschen sprechen höre, tue ich das. Ein engagierter Schriftsteller ist jemand, der sich um die Angelegenheiten anderer Leute kümmert. Wenn ich mich nur um meine eigenen Angelegenheiten kümmern würde, hätte ich eine ganz andere Literatur geschrieben.
Antonio Tabucchi im Gespräch mit dem Schriftsteller Marco Aloni im Jahr 2008. Vor allem aber genieße ich es, mir Geschichten erzählen zu lassen. Ich habe festgestellt, dass Menschen gerne erzählen, vor allem, wenn sie merken, dass da jemand ist, der gerne zuhört, schweigt und nicht unterbricht, der mit aufmerksamen Augen dasteht.
Dem man ansieht, dass er sich für das, was man ihm erzählt, interessiert. Selbst wenn es sich scheinbar um eine Nebensächlichkeit handelt, weil sie für die Menschen, die sie erlebt haben, wirklich wichtig war. Man versteht vielleicht die Bedeutung der Geschichte nicht, die vielleicht banal ist. Man versteht aber, wie wichtig sie für die Menschen war. Es ist die Intensität des Gefühls, mit dem sie etwas erlebt haben, was mich interessiert.
Antonio Tabucchi war der Meinung, dass der Schriftsteller eine Art Janus mit einem Doppelgesicht sein muss. Einerseits derjenige, der zuhört und sammelt, was um ihn herum ist, andererseits derjenige, der schreibt und eine Geschichte erschafft. Der Akt des Erzählens hat eine Bedeutung, die weit über die Geschichte selbst hinausgeht.
Er stellt einen Versuch dar, dem belanglosen Fluss unseres Lebens eine Form zu geben. Es kommt auch für einen Schriftsteller die Zeit, in der er versucht zu messen, was geschehen ist. Und zwar nicht nur mit dem Selbst, sondern vor allem mit den anderen. Denn Schriftsteller schauen nach außen, sie schauen auf andere.
Vor allem kommt eine Zeit, in der der Schriftsteller versucht, Ereignisse zu formulieren. Ich glaube, dass das Erzählen mit dem Akt des Skandierens und des Messens zu tun hat. Antonio Tabucchi in einer öffentlichen Veranstaltung des Verlags Feltrinelli im Jahr 2009. Es ist ein Maß, weil das Erzählen eines Ereignisses bedeutet,
dass man es auf irgendeine Weise erfassen kann. Indem man es erfasst, misst man es. Sonst ist das, was geschieht, nur ein Fluss, der an uns vorbeifließt.
Wir achten auf die Ufer, wie Plotin sagte. Aber das Leben ist einfach ein uferloser Fluss. Von ihm zu erzählen, bedeutet also, ihm einen Rand zu geben. Inzwischen geht der Fluss seinen eigenen Weg weiter. Aber wir haben versucht, ihm ein Maß zu geben. Wir sind arme Vermesser des Lebens. Musik
Der erste in Deutschland erschienene Erzählband, der kleine Gatsby, wurde 1986 von Comedia und Arte veröffentlicht. Michael Krüger, damals literarischer Leiter des Hansa-Verlags, schrieb eine Rezension über das Buch.
Bei dieser Gelegenheit wurde Krüger zum ersten Mal auf Tabuki aufmerksam, wie er selbst erzählt. Und so kam es, dass ich dann das Buch »Indisches Nachtstück« gekauft habe für die deutsche Übersetzung, »Noturno Indian«. Und das hat mich dann sofort sehr fasziniert und gefreut.
Auch das ist ja noch bei Celeryo Asin, erst danach ist er dann zu Ferdinand gegangen. Aus vielerlei Gründen. Erstens mal, das ist sehr oberflächlich, aber ich war natürlich interessiert, weil Antonio auch 1943 geboren war, wie ich. Zweitens...
interessierte er sich und hat darüber gearbeitet für Fernando Pessoa. Und dieses Maskenspiel von Pessoa hatte ich damals kennengelernt und mich dafür zu interessieren begonnen. Da ich kein Wort Portugiesisch kann, war ich also ganz auf Übersetzungen angewiesen. Und damals begann in Deutschland...
Das Interesse an Psoa, an diesen verschiedenen Namen und Masken. Und da ich selber ein ziemlich guter Kenner war von Borges und dessen Masken, war also Psoa eine große Bereicherung. Mit anderen Worten, ich habe dann versucht, Kontakt aufzunehmen mit Tabuki, der damals noch Professor, glaube ich, in Siena war,
und für portugiesische Literatur und wir uns aber auch für portugiesische Literatur interessierten und ich ihm dann schrieb, es wäre doch ganz schön, wenn wir uns einmal kennenlernen würden und so ist es dann gekommen, dass wir uns getroffen haben. Er ging dann
zu Feltrinelli, Inge Feltrinelli und Carlo waren gute Freunde von mir, sodass wir dann ab dem indischen Nachtstück dann sein gesamtes Werk publiziert haben. In seinem Nachwort zu Tabukis posthum veröffentlichtem Buch »Für Isabel« erinnert sich Michael Krüger an den Autor und Freund Tabuki, an seine grenzenlose Neugier, an seine Melancholie.
Für manche Verleger war er ein schwieriger Autor. Michael Krüger verabschiedete sich von ihm mit dem Satz »Adeo, Antonio. Für mich warst du nie ein schwieriger Autor gewesen.«
weil meine italienische Kenntnisse sind so schlecht, dass man sehr gut zuhören muss. Und er saß dann immer da, er hatte diese wunderbar großen, traurigen Augen. Ich kenne keinen, der so große Augen hatte und einen immer so anguckte. Und man sprach über drei Dinge. Das eine ist natürlich...
Wie geht es weiter mit meinem Werk in Deutschland? Das zweite: Wann sieht man sich wieder? Und fährt man mal zusammen nach Portugal, um die Städten von Psoa zu besuchen?
Drittens natürlich werden wir ihm treu bleiben und viertens war es immer so, dass er sich wahnsinnig interessierte auch für das eigene, also für meine Existenz,
die ja eigentlich im Zusammenhang mit ihm ganz unwichtig war. Aber er hat sich das alles gemerkt und hat immer mal wieder gefragt und das und jenes. Er war also ein, wie ich mal gesagt habe, so ein Dosenöffner. Wenn er da war, mit meinem unglaublich komischen Italienisch, haben wir also stundenlang geredet, auch spazieren gegangen hier in der Stadt. Wir waren in der Pinakothek und haben uns die Sachen angeguckt.
Und er war immer mit einer leisen, aber intensiven Stimme beschäftigt, einen sozusagen auseinanderzunehmen.
Und das hat mir natürlich gut gefallen, weil er eben ein sehr sympathischer Mensch war, der so schrieb, wie ich mir das für eine Zeitgenossenschaft vorstelle. Ein weiterer Freund von Michael Krüger, der Schriftsteller Christoph Meckel, verfasste eines der einfühlsamsten Kurzporträts von Tabuki im deutschsprachigen Raum.
Wir fuhren nachts von Florenz nach Pisa, sehr schnell auf der Autostrada und tranken Sekt. Seine rechte Hand hielt das Glas, die linke das Steuer. Ich jonglierte die kalte Flasche und füllte nach. Er erzählte von Portugal und Lissabon, dort lebt er so oft der Beruf es erlaubt. Seine Frau, Maria José de Lancastre, ist Portugiesin und Professore wie er und Psoa sein Patron in der Literatur. Er hat ihn gemeinsam mit ihr übersetzt.
durch Edition und Essay in Italien vermittelt, und er hat ein Buch auf Portugiesisch geschrieben. Hommage an das Land seiner zweiten Geburt. Er könnte behaupten, Portugiese zu sein, wie Eliot Engländer war oder Beckett Franzose, denn er hat in sich eine Stärke und Schwäche jenes Merkmal portugiesischen Lebensgefühls, das man nicht erlernen, nachahmen, vortäuschen kann. Saudade.
Es ist ein Wort, das jeder zu kennen glaubt. Ein Begriff, der sich der Erklärung entzieht, nicht übersetzt werden kann und kaum definiert, in Jahrhunderten nichts an Magie und Bedeutung verlor. Und das ist etwas Elementares, worin man lebt. Darüber wurden Bücher geschrieben, von Leuten, die nicht Portugiese sind. La Saudade ist kein Wort, hat Tabuki geschrieben. Es ist eine geistige Kategorie.
Es gibt keine bessere Möglichkeit, Saudade zu verstehen, als sie selbst zu empfinden. Der beste Augenblick dafür ist natürlich der Sonnenuntergang. Das ist der Augenblick der Saudade.
Gut eignen sich aber auch gewisse Abende, an denen vom Atlantik her Nebel aufzieht, sich ein Schleier auf die Stadt senkt und die Laternen angehen. Antonio Taubugui aus dem Buch Reisen und andere Reisen. Wenn sie hier alleine sind und das Panorama vor sich betrachten, überkommt sie vielleicht eine Art Sehnsucht.
Ihre Vorstellungskraft wird der Zeit einen Haken schlagen, wird Ihnen den Gedanken einflüstern, dass Sie zu Hause, wenn Sie wieder Ihrem Alltag nachgehen, Sehnsucht nach einem ganz besonderen Augenblick Ihres Lebens überkommen wird, als Sie sich in einer wunderschönen und einsamen Gasse Lissabons befanden und ein herzzerreißendes Panorama betrachteten.
Sie haben die Sehnsucht nach dem Augenblick, den sie gerade in diesem Augenblick erleben. Das ist die Sehnsucht nach der Zukunft. Sie haben höchstpersönlich erfahren, was Saudade ist.
* Musik *
Ich bin meine Stimme, meine Lieder, die Illusion. Du hast mich von dem Lieben, der vielleicht nicht existiert, aber den ich in allen Tagen finde. Ich will nur dein Herz schlagen, deine Worte, die Füße in meinen Schrank, die dich erinnern werden.
Es gibt Schriftsteller, die dich mit dem Wissen verliebt haben, wenn du anfängst, dich ein bisschen von der Literatur zu verlieben.
Wenn man anfängt zu lesen und sich ein wenig in die Literatur verliebt, gibt es einige Schriftsteller, die man in Gedanken verfolgt in der Annahme, dass man ihnen eines Tages begegnen könnte. Und von allen zeitgenössischen italienischen Schriftstellern wollte ich unbedingt Tabucchi kennenlernen.
Und die erste Zeit, als ich ihn in Paris gesehen habe, war im Januar 2009.
Ich werde mich immer an diesen Moment erinnern. Ich war aufgeregt und auch verlegen, weil ich nicht wirklich wusste, was ich sagen sollte.
Man hatte, wer weiß, was für Reden vorbereitet. Dann kommt dieser Herr mit einer Baskenmütze an diesem eiskalten Tag herein, setzt sich vor dich und du bist fast sprachlos. Und er war es, der das Eis zum Schmelzen brachte. Denn er war es, der mir Fragen stellte, der mich fragte, worüber ich schreibe.
Ich war noch keine 26 Jahre alt und es war die Begegnung mit dem Rockstar der Literatur. Für mich war er auch das eigentliche Vorbild beim Schreiben. Ich muss sagen, dass die ersten Dinge, die ich geschrieben habe, Kurzgeschichten waren, die Tabuki sehr nachempfunden waren. Trotz des Altersunterschieds von 40 Jahren fand Di Paolo in ihm einen Lehrer, aber auch einen Weggefährten.
Eine Person, an die er sich wenden konnte, um manchmal getröstet und manchmal getadelt zu werden. Denn Tabuki konnte auch sehr streng sein. Ich verdanke ihm sicherlich den entscheidenden Anstoß, meinen ersten relevanten Roman zu veröffentlichen. Er hatte ihn gelesen und unaufgefordert mit Fußnoten versehen und korrigiert.
So erinnere ich mich an dieses Bild von ihm mit einem Bleistift hinter dem Ohr, wie ein alter Schreibwarenhändler oder ein Dorfmetzger. An diesem Morgen in Vecchiano, in seiner Heimatstadt, kam ich zum Frühstück herunter und fand ihn vor mir, der mein Buch gelesen hatte und bereit war mir zu sagen, was funktioniert hat und was nicht, aber auch, um mich zu ermutigen.
Ich muss wohl ohne Übertreibung sagen, dass ich ohne die Begegnung mit Tabuki nicht zu dem geworden wäre, was ich bin. Ein Autor, ein Mensch, der schreibt und der das Schreiben zu seinem Beruf gemacht hat. Paolo di Paolo hat viele Ausgaben von Tabuki zusammengestellt und Beiträge über ihn veröffentlicht.
Er ist sicher einer der sensibelsten und eloquentesten Experten seines Werks. Er nimmt den Begriff Saudade wieder auf und bringt einen zentralen Aspekt vom Universum Tabukis auf den Punkt. Das portugiesische Wort Saudade sei unübersetzbar, so Di Paolo. Man könne es als eine Form der Nostalgie bezeichnen, aber es ist keine rückwirkende Nostalgie. Das heißt, keine Nostalgie, die sich auf die Vergangenheit bezieht.
Es bezieht sich auf die Zukunft. Er hat es mir einmal so erklärt. Saudade ist die Art von Nostalgie, die man nach einer Liebe hat, die man nicht erlebt hat. Das heißt, du hast dich in eine Person verliebt, aber du hast diese Liebe nicht erlebt.
Dann hat man Sehnsucht nach dem, was man mit dieser Person hätte erleben können. Aber diese Beziehung hat nie stattgefunden. Der Begriff Saudade bringt uns auf die richtige Spur in Bezug auf die Wahrnehmung der Zeit, die das wirklich große Thema in Tabukis Werk ist. Sogar nominell, wenn man nur die Titel von Tabukis Werken zusammenzählt.
Die Zeit altert schnell, es wird immer später, Tristan stirbt und so weiter. Die Obsession für die Zeit ist offensichtlich. Es handelt sich jedoch nicht nur um eine chronologische oder anagrafische Frage.
Es geht um unerfüllte Möglichkeiten, verpasste Gelegenheiten, Umstände, die einen anderen Verlauf meines Schicksals hätten bestimmen können. Wegen eines kleinen Details, eines kleinen Missverständnisses, eines kleinen Umstands ist etwas Entscheidendes nicht passiert. All dies ist Teil einer Reflexion, die Tabuki ständig über die Zeit anstellt. Sicherlich hat er dies von den Großen des 20. Jahrhunderts geerbt. Proust, Virginia Woolf, Joyce und Psoab.
Aber Tabuki interpretiert die kognitive Obsession, die die große Frage, was Zeit ist, durchdringt, auf seine Art und Weise. Er sagte, dass er nicht mehr verstanden hatte, ob es Tabuki war, der das Zeit überbruchte.
Er sagte, er habe noch nicht verstanden, ob wir es sind, die durch die Zeit gehen oder ob die Zeit durch uns geht. Das können wir natürlich nicht beantworten. Was ist unsere Vergangenheit? Ist sie eine Summe verschiedener Bilder von uns selbst? Oder ist die Zeit ein fließender heraklitischer Fluss, in dem wir uns vorwärts bewegen?
Das sind alles sehr starke, metaphorische und philosophische Bilder. Es sind alles sehr starke, metaphorische und philosophische Bilder.
In der Erzählung »Das Umkehrspiel« gelingt es dem Protagonisten, in einem Bild das Gefühl zu evozieren, das hinter dem Begriff »Saudade« verborgen ist. Während einer Reise im Nachtzug schildert der Protagonist, wie er in Madrid vom Tod einer portugiesischen Freundin erfahren hat, Maria do Carmo, und nun deswegen nach Lissabon fährt. Unterwegs denkt er an seine erste Begegnung mit ihr zurück.
In Lissabon wird er von Marias Ehemann empfangen. Während des Gesprächs weckt ein Klang aus der Ferne seine Aufmerksamkeit und versetzt die Grenzen zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Das Erlebte und die Erinnerungen an Maria do Carmo tauchen in einer veränderten Dimension wieder auf. Durch das Fenster drang der Ton einer Sirene. Vielleicht war es ein Schiff, das in den Hafen einfuhr.
Auf der Stelle verspürte ich ein unendliches Verlangen, als Passagier auf diesem Schiff in den Hafen einer fremden Stadt einzufahren, die Lissabon hieß. Beauftragt zu sein, eine fremde Frau anzurufen, um ihr zu sagen, dass eine neue Übersetzung von Fernando Psoa erschienen sei und diese Frau hieße Maria do Carmo.
In einem gelben Kleid würde sie in die Buchhandlung Bertrand kommen. Sie würde den Fado und sephardische Gerichte lieben. Und ich würde das alles schon wissen. Aber jener Passagier, der ich war und der von der Reling des Schiffes aus die Stadt Lissabon betrachtete, wusste es noch nicht. Und alles würde für ihn neu und ganz genau so sein. Und das war die Saudade. Maria do Carmo hatte recht. Es war kein Wort. Es war eine geistige Kategorie.
Auf ihre Weise war auch sie ein Umkehrspiel. * Musik * * Musik *
Die Geschichten, die Tabuki erzählt, spielen immer an der Grenze zwischen einem geträumten Imaginären und der Realität. Tabuki dehnt die Trennlinie zwischen diesen Dimensionen so weit aus, dass der Abstand zwischen den beiden Welten fast verschwindet. Dennoch bleibt das Imaginäre bei Tabuki eine plausible Fantasie, weil es Aspekte und Details der Realität bewahrt, die es im Rahmen des Möglichen einfangen.
Es ist eine Fantasie im menschlichen Massstab, wie Anna Dolphy sagt. Sie ist emeritierte Professorin der Universität Florenz, Akademie-Mitglied der Linchei und Spezialistin für das 19. und 20. Jahrhundert mit Schwerpunkt auf dem Werk Tabukis.
Selbst wenn er etwas Fantastisches schreibt, etwas, das weniger real ist, ist Tabuki doch immer sehr nah an der Realität. Kurz gesagt, sein Imagineres ist nie wie das Genre Fantasy, das wir heute in Filmen sehen. Es ist eine Vorstellungswelt, die einen menschlichen Charakter beibehält.
Ein imaginäres, das möglich ist und das uns schließlich in die Welt der Träume zurückführt. Wie wir wissen und wie Freud zeigte, hat der Traum schließlich immer etwas mit der Realität gemeinsam. Das Imaginäre bei Tabuki ist eine Fantasie, die uns mitnimmt und uns mitnimmt.
und uns dadurch bestimmte Dinge über uns selbst offenbart. Tabuki liebte das Leben und die Genüsse, die es bot. Deshalb hat er als Autor, während er uns in eine metaphysische Dimension führt und uns Zweifel und Fragen über die Existenz stellt, im selben Text die Eigenschaften eines Gerichts oder eines Weins beschrieben.
Er präsentiert uns das Vergnügen des Kochens und Essens unmittelbar neben den unlösbarsten Fragen unseres Daseins.
Das Faszinierende ist, dass Tabuki es schafft, enorm wichtige Fragen über das Leben, über die Existenz, mit einem extrem starken, spielerischen Aspekt zu vermischen. Oder mit ganzen Seiten, die er in seinen Büchern Gerichten widmet. Köstlichkeiten, die meist natürlich in Lissabon oder Portugal gegessen werden.
Und das verstärkt für einen Leser, der kein Portugiese ist, auch die Exotik seiner Bücher. Zweifellos hat Tabuki gerne Champagner getrunken. Und so amüsiert es mich, wenn ich ihn lese, zu sehen, welche Champagner seine Figuren bevorzugen. Und das entsprach vielleicht auch seinen Vorlieben für Aperitifs oder begleitende Weine.
Alles, was mit dem Kochen zu tun hat, wird sehr stark in den Mittelpunkt gestellt. Denn das Kochen sagt viel aus und erzählt von den Gewohnheiten eines Volkes und auch von seiner Geschichte. Die Küche sagt viel und spricht von den Habitaten eines Volkes und auch seiner Geschichte.
Die Nähe zur Realität und zum Leben, die Tabuki stets bewahrt, zeigt sich auch in seinem politischen Engagement, seinen kritischen Artikeln und den hitzigen öffentlichen Debatten, die er auslöst. Tabuki war einerseits sofort in die Politik involviert.
Wahrscheinlich aus einer jugendlichen Leidenschaft heraus. Als sehr junger Mann ging er nach Paris, nachdem er Fellinis La Dolce Vita gesehen hatte und feststellen musste, dass unser Land hoffnungslos verloren war. Er dachte, dass intellektuelle Partei ergreifen sollten.
Und wir wissen natürlich, dass es solche Intellektuelle in Frankreich gibt. Dann haben sicherlich seine Kontakte zu portugiesischen Dissidenten politisch auch eine Rolle gespielt.
Das Problem ist, dass seine Beschäftigung mit der Politik ab einem bestimmten Punkt zusehends in Konflikt mit einer Macht geriet, die in Italien weniger tolerant war als zuvor. Tabucchi hat nicht geschwiegen angesichts der tiefgreifenden Fehlerziehung, die Berlusconi in der italienischen Jugend ausgelöst hatte und deren Auswirkungen wir immer noch beobachten.
2009 reicht Renato Schifani, der Präsident des Senats, eine Zivilklage gegen den Schriftsteller wegen Verleumdung ein.
In einem am 20. Mai 2008 in der linken Zeitung Lunita veröffentlichten Artikel hatte Tabuki auf Schifanis nachweisliche Bekanntschaften mit Personen hingewiesen, die später wegen Mafia-Delikten verurteilt wurden. Zweifellos trug der Fall Schifani, der Tabukis Erben bis vor einigen Jahren verfolgte,
fiel zur Bitterkeit der letzten Lebensjahre Tabukis bei. Ich möchte an die Klage erinnern, die der damalige Senatspräsident Skifani gegen Tabuki eingereicht hatte und in der er eine Entschädigung von 1,3 Millionen forderte. Tabuki hatte darauf reagiert,
indem er unverhohlen demonstrierte, dass dies ein einfacher Weg war, Intellektuelle zum Schweigen zu bringen. Der Verlag Alimar veröffentlichte in Le Monde einen Appell an die Intellektuellen. Wir unterstützen Antonio Tabucchi.
der von Nobelpreisträgern aus der ganzen Welt und von Intellektuellen unterzeichnet wurde. Es ging darum, dass das Recht auf Kritik verteidigt werden muss. Andererseits ergab sich der endgültige Freispruch, der nach seinem Tod erfolgte, gerade aus einer wichtigen Unterscheidung. Die Kritik
hat natürlich das Recht zu sprechen. Tabukis scharfer Blick war nicht nur auf Berlusconi und seine politischen Unterstützer gerichtet. Trotz seiner Nähe zu den Ideen der Linksintellektuellen ließ sich Tabuki auf keine politische Partei festlegen.
und kritisierte auch Positionen seiner Gleichgesinnten. Als er sich gegen den ehemaligen Terroristen und Mitglied der Brigade de Rosse, Cesare Battisti, äußerte, weil seiner Meinung nach dieser Mann ein Verbrecher war und kein Intellektueller, der geschützt werden müsste, wurde Tabuki auch von den linksorientierten Denkern und Aktivisten scharf attackiert.
Für Tabuki trug das politische Engagement keine Farbe einer Partei. Die Freiheit, eine politische Meinung zu haben und zu äußern, war für ihn ebenso wichtig wie die Freiheit des Schriftstellers, sein eigenes literarisches Universum zu gestalten. Die Obsession für die Politik, die vor allem die letzten Jahre seines Lebens kennzeichnete, spiegelt sich nur teilweise in der Welt seiner Erzählungen und Romane wider.
Tabukis erste und größte Berufung blieb die Literatur.
Eine Erzählung hat ein sehr schönes Maß. Sie gefällt mir sehr gut. Zum Roman hat man ein ganz anderes Verhältnis. Der Roman ist wie ein episches Gedicht.
Antonio Tabucchi in einer Aufnahme aus dem Archiv des Senders Rai 2008. Der Roman ist wie ein Reis.
Beim Roman ist es so, als ob man ein eigenes Haus hätte. Du kannst die Tür schließen und weggehen. Du kehrst zurück, öffnest die Tür und kommst in dein Haus zurück. Die Erzählung ist wie eine Mietwohnung. Wenn du sie verlässt, gehört sie dir nicht mehr.
Eine Erzählung zu schreiben, das ist ein Kampf gegen die Zeit. Sie hat ein eigenes Maß und muss in diesem Moment genau zu Ende geschrieben werden, sonst geht sie verloren. Die Erzählung ist wie das Sonett in der Poesie. Sie wird mit dem Takt der Zeit geschlagen. Antonio Tabucchi liebte die Form der Erzählung.
Selbst in seinen Romanen behält er einen Rhythmus bei und schafft eine Abfolge von Episoden, die fast wie unabhängige Kurzgeschichten wirken. Seine Erzählungen bleiben offen, sie haben kein endgültiges, klares Ende. Sie scheinen auf andere Räume zu verweisen.
Ich denke, die Erzählungen eines Schriftstellers wie Tabuki haben zwangsläufig meistens ein schwebendes Ende, weil er genau weiß, dass Geschichten nicht beginnen und nicht enden. Sie erreichen uns wie Musik. Der Schriftsteller Paolo di Paolo. Und die Musik hat eine Ende, aber sie bleibt in den Ohren und dann schwebt sie. Du kannst nicht sagen, wo die Musik endet. Das ist sehr schwierig zu sagen, oder?
Die Musik endet natürlich, aber sie bleibt tatsächlich im Ohr und verklingt dann. Man kann nicht sagen, wo die Musik endet, das ist sehr schwer zu sagen. Der Roman Requiem ist meiner Meinung nach das Ende eines Traums, deshalb gibt es auch da ein Ende. Es ist ein Traum, also muss er enden, um sich von dem Traum zu verabschieden, zurück in die Realität, weil es eine Halluzination war.
Aber bei allen anderen Büchern hatte ich immer den Eindruck, dass es so etwas wie Fortsetzungspunkte gibt, die sichtbar oder unsichtbar sind, die aber die Geschichte unendlich weitertragen. Jenseits der Seitengrenze könnte theoretisch etwas anderes passieren und wieder von vorne beginnen. Eine Geschichte abzuschließen, ist so, als würde man etwas Überschwängliches, Luftiges, Ungreifbares in ein starres Gefäß stecken.
Als würde man den Wind in eine Schachtel stecken. Wie kann man Luft und Licht in eine Schachtel stecken? Dieses Gefühl der Offenheit, einer ewigen Fortsetzung von Geschichten war, glaube ich, eine Idee, die Tabuki aus seiner Beschäftigung mit der Poesie entwickelt hatte. Mit einer bestimmten Poesie, in der die Melodie des Verses in gewisser Weise ein Echo über sich selbst hinaus hat.
Wenn man eher an Poesie als an Prosa denkt, sieht man auf den ersten Blick natürlich einen Text, der schwarz geschrieben ist und um ihn herum ist dieses Weiß. Aber dieses Weiß spricht genauso viel wie das Gedicht selbst. Wenn das Gedicht echte Poesie ist, ist das Weiß drumherum der Resonanzkörper der Poesie.
Es ist also so, als ob das Gedicht nicht endet, weil es in gewisser Weise in der Resonanz weitergeht, die es in dir hat, die es aber irgendwie auch in diesem weißen Raum schwingen lässt. In gewisser Weise ist es unmöglich, eine Geschichte zu beenden, denn es besteht immer die Möglichkeit, dass diese Geschichte etwas ausstrahlt, das über sie hinausgeht.
Geschichten erzählen bedeutet, etwas einen Sinn zu geben.
Ich glaube, das ist die Bedeutung des Schreibens und vor allem des Geschichtenerzählens. Es spielt keine Rolle, ob diese Geschichte auf Papier erzählt wird, laut erzählt wird, leise erzählt wird oder sogar im Stillen erzählt wird.
Antonio Tabucchi im Gespräch mit der Autorin Rosana Maspero im Jahr 2004. Eine Aufnahme aus dem Archiv des Senders RSI.
Denn wenn wir uns unser Leben nicht erzählen, wenn wir uns abends, wenn wir ins Bett gehen, nicht unseren Tag erzählen, dann ist es ein Chaos, eine Aneinanderreihung von Ereignissen, die keinen Sinn ergeben. Es ist die Erzählung, die unserem Leben einen Sinn gibt.
Das Wichtigste ist gerade der Versuch, in eine erzählerische Form zu bringen, was sonst nur ein Aneinanderreihen von Ereignissen ohne Zusammenhang wäre. Antonio Tabucchi wurde am 24. September 1943 in Pisa geboren. Er ist das einzige Kind von Tina Padella, einer Hebamme, und Adamo Tabucchi, einem Händler und Barbesitzer.
Der Zweite Weltkrieg traf Pisa sehr hart. 1943 wurde die Stadt von mehreren schweren alliierten Bombenangriffen getroffen, die die Infrastruktur eines wichtigen Eisenbahnknotens zerstören sollten. In der Nähe befanden sich auch verschiedene Fabriken, die für Kriegszwecke umgerüstet worden waren. Insbesondere die Firma Piaggio, die Motoren für Wasserflugzeuge herstellte. Musik
In einer Fernsehsendung im Jahr 2010 erzählte Tabucchi dem Moderator Fabio Fazio vom Tag seiner Geburt.
Ich wurde geboren, als die Alliierten beschlossen, die Stadt zu bombardieren, weil die Deutschen auf der rechten Seite des Arno waren und die Brücken gesprengt hatten.
Die Alliierten bombardierten das Industriegebiet um Porta Amare, wo sich Fabriken befanden, die in Kriegsfabriken umgerüstet worden waren. Es war ein strategisches Gebiet. Bomben sind nicht besonders intelligent. Auch damals fielen sie, wo sie wollten, sogar in der Altstadt. Ich wurde im Krankenhaus Santa Chiara geboren. Ich glaube, meine Mutter war zu diesem Zeitpunkt die einzige Insassin.
Die Fensterscheiben zerbarsten durch den Luftdruck. Eine kleine Nonne half meiner Mutter während der Geburt. Sie sagte zu meiner Mutter, Madame, beeilen Sie sich. Und sie antwortete, ich werde tun, was ich kann. Und meine Mutter sagte, ich mache das Unmögliche. Und so begann mein echterer Reise.
Antonio hat mir oft über seine Kindheit gesprochen. Er sagte immer, er habe eine glückliche Kindheit gehabt.
Antonio sprach oft mit mir über seine Kindheit. Er sagte immer, er habe eine glückliche Kindheit gehabt, eine fröhliche Kindheit. Maria José de Lancastre, Literaturwissenschaftlerin, Co-Editorin der italienischen Ausgaben von Fernando Psoa und Ehefrau von Antonio Tabuchi. Eppure nella sua famiglia c'erano stati due
Auch wenn die Familie schwere Schicksalsschläger erleben musste. Die Brüder seiner Mutter kamen früh ums Leben. Der letzte starb, als Antonio zehn Jahre alt war. Das war sein Lieblingsonkel. Antonio lebte in Vecchiano. Das war ein kleines Dorf in der Toskana. Und das hat in Italien vielleicht eine größere Bedeutung als woanders.
Es war ein Dorf mit verschiedenen Traditionen, ein landwirtschaftliches Dorf, in dem es noch eine Art Lehngut gab, La Macchia di Migliarino, das der Familie Salviati gehörte. Und die Vecchianesi waren, wie die anderen Bewohner der Gegend, eine Art Vasallen, Leibeigene.
In seinem ersten Roman, Piazza d'Italia, beschreibt Antonio dieses Dorf. Es war ein armes Dorf. Arm sein in Borgo hieß, zum Schilfrohr schneiden, in die Sümpfe zu fahren. Die Männer brachen im Morgengrauen auf langsamen Karren auf.
Um diese Zeit hatte das Dorf noch keine festen Umrisse und der Turm suchte im Nebel nach seiner Bestimmung. Der erste Karren hatte eine Lampe unter der hinteren Deichsel, um sich den Weg zu bahnen. Es gab keine Lieder, um keine kalte Luft zu schlucken und der tief in die Stirn gezogene Hut war die Sehnsucht nach dem Bett. Sie erreichten die Sümpfe, als die Sonne schon hoch stand und bestiegen zu zweit die Boote, um abwechselnd zu rudern und zu schneiden. Sie fuhren im Kreis.
Als trieben sie nur in ihrer Vorstellung existierende Tiere und kehrten erst zurück, wenn die Boote voll waren. Inzwischen war es Mittag und unter den Pappeln am Ufer aßen sie Brot und Zwiebeln. Dann arbeiteten sie weiter bis zum Abend. Spät in der Nacht kamen sie nach Hause. Das Knirschen der Räder kratzte an der Stille des Dorfes. Am Sonntag verkauften sie das Schilfrohr in der Fatoria Vecchia, zu deren Besitztümern die Berge und der See gehörten.
Dort empfing sie ein gedrungener, schmieriger Verwalter, der sich ununterbrochen den Gürtel lockerte, damit er seinem immer größer werdenden Bauch nicht im Wege wäre. Er bestimmte den Preis und erduldete keine Widerrede. Die Kindheit von Tabuki unterscheidet sich sehr von der Kindheit seiner Frau Maria José de Lancastre. Sie ist Portugiesin und gehört einer angesehenen, adligen Familie Lissabons an.
Die Tabukis waren im Gegenteil einfache und pragmatische Menschen, die ein starkes politisches Bewusstsein hatten.
Ich hatte eine absolut behütete Kindheit, voller Menschen, die sich um mich kümmerten. Zu Hause hatten wir drei Dienstmädchen, eine Köchin, ein Kindermädchen. Zwischen mir und dem Leben gab es eine große Distanz. Er hatte eine große Affe an alle. Er war ein sehr guter Mann.
Er hatte dagegen die große Zuneigung aller, weil er das einzige Kind war.
Außer seinen Eltern hatte er eine fabelhafte Großmutter, Dina, die ich kannte und die auch meine Kinder kannten. Sie war eine sehr schöne, immer schwarz gekleidete Frau, die Antonio anbetete. Er war also ein verwöhntes Kind, wurde geliebt und hatte eine Tante, die Schwester seiner Mutter.
Alle Frauen in seiner Familie hatten den gleichen Beruf, sie waren Hebammen. Die Tante war unabhängig, eine sehr intelligente Frau, die viel gereist war und etwas strenger mit ihm war. Sie war etwas stärker mit diesem Kind, obwohl sie ihn so liebte wie die anderen. Sie war etwas stärker mit ihm.
* Musik *
Er ugalletto ieri domesticava tante canzone, tante canzonette. La famigliola me le fa scordane.
Wir waren eine eher patriarchalische Familie.
Meine Großeltern, meine Eltern und mein Onkel, der noch nicht verheiratet war, lebten hier. Meine Kindheit war eine klassische italienische Kindheit der Nachkriegszeit. Ich muss sagen, dass es uns, anders als anderswo, an fast nichts fehlte, denn dies war eine landwirtschaftliche Gegend und mein Großvater züchtete Pferde, besaß Weinberge, einen kleinen Olivenhain.
Er war nicht reich, aber wir lebten gut. Natürlich war die allgemeine Situation so, wie sie war. Es fehlte an fast allem. Flüchtlinge waren in das Dorf geströmt, aber es herrschte eine Atmosphäre der Solidarität, an deren Nachhall ich mich noch erinnere.
Der andere Großvater war Arbeiter. Er hat körperliche Arbeit geleistet, meistens in den Bergwerken, aber auch in der Fabrik. Er hatte am Ersten Weltkrieg teilgenommen und war Sozialist. Zusammen mit anderen hatte er sogar in der Gründung verschiedener sozialistischer Sektionen mitgewirkt.
Der Vater meines Vaters hingegen hatte anarchistische Wurzeln. Es gab eine starke anarcho-sozialistische Tradition in dieser Gegend, weshalb fast alle Probleme mit den Faschisten und den Nazis hatten. Antonio Tabucchi besuchte die Grund- und Mittelschule in Vecchiano.
Dank seiner Großmutter und vor allem dank eines Onkels entwickelte er schon in jungen Jahren eine Leidenschaft für Literatur und Kunst. Ich hatte eine nette, intelligente Großmutter, die mir immer Kinderbücher kaufte. Und sie war es, die mich auf diese Weise diese große Leidenschaft entdecken ließ, die in mir verborgen war und von der ich noch nichts wusste.
Und dann war da noch mein Onkel mütterlicherseits, der in dieser Zeit eine sehr wichtige Rolle spielte. Er war der Intellektuelle in der Familie. Er schrieb Theaterstücke, die er nie veröffentlichte, und er hatte eine kleine Bibliothek voller Bücher über angloamerikanische Literatur, denn er liebte vor allem englischsprachige Autoren.
So begann ich Jack London zu lesen, was dann zu einer meiner großen Leidenschaften wurde. Dank ihm entdeckte ich die Lust am Abenteuer und eine bestimmte Art von Weltanschauung, denn London betrachtete die Wirklichkeit auf eine ganz besondere Weise. So konnte ich eine Landschaft sehen, die damals noch sehr exotisch für mich war. Nordamerika, die großen Weiten, Kanada, der
Der Schnee, die Grenze, faszinierende Orte, die mich sehr anzogen. Zu seinen Lieblingsbüchern in der Kindheit gehörten Pinocchio von Collodi, Gulliver's Reisen von Swift und Don Quixote von Cervantes.
Aber seine wahre Leidenschaft für das Lesen begann im Alter von 14 Jahren, als er nach einem Unfall gezwungen war, mit einem Gipsbein im Bett zu bleiben. Die langwierige Rekonvaleszenz überbrückte Tabuki mit Abenteuergeschichten, wie er in seinem Buch »Geschichten zu Bildern« beschreibt. »Für alle, die Stevenson in der Pubertät...«
Ein mitunter erstickendes Lebensalter, zu lesen und zu lieben begannen, stellte er Sauerstoff zum Atmen dar. Das Erstickende in diesem Lebensalter hat für jeden eine andere Qualität. Einer liegt zum Beispiel unbeweglich im Bett, weil er sich das Knie gebrochen hat. Es sind die 50er Jahre in Italien.
Gerade hat sich die Überschwemmung im Polesine oder eine ähnliche Katastrophe ereignet und man muss mildtätig sein. Die Dame del Patronato, manche erinnern sich wahrscheinlich noch an diese wohltätige Einrichtung, sammeln abgelegte Kleidung und schicken sie an die Überschwemmungsopfer. Derweil singt eine Stimme Vecchio Scarpone oder einen ähnlichen Schlager, denn im Radio läuft gerade das Festival von Sanremo.
Und er, der arme, vorübergehend invalide Jugendliche, erstickt beinahe, allerdings ohne es zu wissen. Bis schließlich irgendwer, ein Onkel, der für ihn zur rettenden Figur wird, ihm endlich ein Buch von Stevenson bringt, zum Beispiel die Schatzinsel. Und wie durch ein Wunder beginnt der Erstickende wieder zu atmen, denn es strömt Sauerstoff zu.
Der Wind bläht die Segel eines Schiffes, das Fahrt in Richtung einer fernen Insel aufnimmt. Einer Insel, die nicht wirklich eine Insel ist, sondern die Idee einer Insel, die in uns allen schlummert und die das anderswo bedeutet. Den Ort der Wünsche. Den Ort, von dem wir glauben, dass es dort etwas ganz anderes gibt als in unserer unmittelbaren Umgebung. Die Insel der Utopie?
Die fantastischen Südseeinseln, auf denen die in Öl gemalten Palmen wuchsen, die die Melancholie und die Schwindsucht der dekadenten Dichter nährten? Das »Komm mit mir« eines schönen Liedes, das der Invalide erst als Erwachsener hören sollte? All das und noch viel mehr, all das, was in den Raum einer imaginären Reise passt.
Keiner verstand es so gut wie Stevenson, in Richtung der mythischen Geografie der Seele zu reisen. Musik
Antonio sprach oft vom Onkel Cisello und erzählte etwas, das mich beeindruckte. Manchmal wachten sie sehr früh auf und fuhren mit dem Bus nach Pisa. Dort nahmen sie den Zug nach Florenz und besuchten die Museen. Malerei und Kunst waren in Antonios Leben schon sehr früh präsent.
Das Kind fragte ihn, Onkel, aber ist dieser Beato Angelico gesegnet, weil er unter den Engeln war?
Wie kann man Engel sehen? Der Onkel erfand Geschichten für das Kind und sagte, man muss den Pinsel gut in der Hand halten können, um Engel sehen zu können. Aus diesen Erinnerungen entstand einer der eindrucksvollsten Texte über Beato Angelico.
Die Erzählung »Die Vögel des Beato Angelico«, die Tabuki 1987 veröffentlichte, schwebt in einem Raum zwischen Imagination und Wirklichkeit, zwischen einfacher Bodenständigkeit, Vision und Traum.
Sie klingt wie eine geflüsterte Geschichte, der man beim Betrachten eines Bildes zu lauschen glaubt. Protagonist der Erzählung ist der bekannte Maler der italienischen Frührenaissance, Beato Angelico oder Fra Giovanni da Fiesole, wie ihn seine Zeitgenossen nannten.
Eines Tages erblickt der Mönch drei seltsame geflügelte Wesen, die im Klostergarten gestrandet sind. Er pflegt sie und findet Inspiration für sein Fresco. Die von Beato Angelico gemalten Engel sind in der Erzählung Tabukis also sehr konkrete Geschöpfe, die mit ihrem Erscheinen jede Grenze zwischen dem Irdischen und dem Göttlichen in einer ständigen Umkehrung der Ebenen auflösen.
In dieser Nacht besuchte ihn das Wesen, das aussah wie eine Libelle. Fra Giovanni schlief, als er es plötzlich auf dem Hocker der Zelle sitzen sah, und es war ihm als Schrecke er aus dem Schlaf auf, aber in Wirklichkeit war er bereits wach. Es war eine Vollmondnacht, und der Mondschein fiel durch das Viereck des Fensters auf den Fliesenboden. Fra Giovanni verspürte einen starken Geruch nach Basilikum.
So stark, dass er davon wie berauscht war. Er setzte sich auf und sagte, riechst du nach Basilikum? Das vogelähnliche Wesen legte ihm eine seiner langen Zehen auf den Mund, als wolle es ihm Schweigen gebieten. Dann trat es heran und küsste ihn.
Und da sagte Fra Giovanni, der von der Nacht, vom Basilikumduft und von diesem weißen Gesicht mit den langen Haaren ganz verwirrt war, »Ich träume von dir«, der Vogel lächelte. Und bevor er ihn verließ, sagte er mit einem Flügelrauschen, »Morgen musst du uns malen.«
Und nach dem ersten Gebet ging er sofort zum Käfig seiner Gäste und suchte sich sein erstes Modell aus. Er trug den Vogel also in die Zelle, setzte ihn auf einen Schemel mit dem Bauch nach unten, damit es aussah als flöge er. Und in dieser Stellung malte er ihn links und rechts neben dem Schnittpunkt des Kreuzes mit einem Werkzeug in der rechten Kralle, um die Nägel einzuschlagen.
Und die Brüder, die gemeinsam mit ihm das Fresco in der Zelle gemalt hatten, betrachteten verwundert dieses seltsame Wesen, das er mit unglaublicher Geschwindigkeit aus der Finsternis der Kreuzigung hervorzauberte mit seinem Pinsel. Und im Chor sagten sie, oh, so verging die Woche. Fra Giovanni malte und vergaß darüber sogar zu essen. Die Dämmerung senkte sich herab und
Und er empfand eine leise Müdigkeit und auch die Melancholie, die folgt, wenn die Dinge fertig sind, es nichts mehr zu tun gibt, die Zeit vergangen ist. Er ging zum Käfig und fand ihn leer vor. Im Netz waren vier oder fünf Federn hängen geblieben und sie bewegten sich im kühlen Wind, der von den Hügeln von Fiesole kamen.
Es war Ende 1964.
Ich hatte mich vorsichtshalber an der Universität für Literatur und Philosophie in Pisa eingeschrieben, wo es meiner Meinung nach zu viel Literatur und zu wenig Philosophie gab. Antonio Tabuchi in einer Aufzeichnung aus dem Archiv des Senders Rai 2008. Also hatte ich die Idee, nach Paris zu gehen.
Ich bat meinen Vater um etwas Geld. Und er gab es mir und sagte dann, sobald es zu Ende ist, wirst du für dich selbst verantwortlich sein. In Paris schrieb ich mich an das Sorbonne für Philosophie ein.
Es war ein sehr interessantes Jahr, in dem ich viele Dinge entdeckte und vor allem, dass die Philosophie nicht für mich gemacht war. Oder besser gesagt, dass ich nicht für die Philosophie gemacht war. Aber ich entdeckte das Kino und merkte, dass ich die Literatur sehr mag. Paris hat sehr früh sein Interesse geweckt, wahrscheinlich wegen der französischen Literatur, die Tapouki schon in der Schule kennengelernt hatte. Flaubert, Camus, Sartre, Prévert...
Wie er selbst erzählt, spürte er eine starke Faszination für die damalige französische Kultur, Saint-Germain, Juliette Greco, die Surrealisten, den Existenzialismus. »All das wollte ich aus nächster Nähe kennenlernen. Und dann hatte ich in Italien das Gefühl zu ersticken.«
Und das wurde mir durch einen Film bewusst, La Dolce Vita von Federico Fellini. Antonio Tabucchi aus dem Buch Zick-Zack. Conversazioni con Carlos Gumpert e Anteos Chrysostomidis.
Ich erinnere mich daran, als wäre es gestern gewesen. Wissen Sie, Pisa war damals ein kleines Provinzstädtchen. Und ich bin jeden Samstagabend mit meinen Freunden nach Florenz gefahren. Es muss Ende 62 oder Anfang 63 gewesen sein. Ich hatte gerade das Gymnasium beendet und musste mich an der Universität einschreiben. Ich sah den Film in Florenz und sofort brach meine Welt zusammen. Ich sagte mir, ich will hier weg.
In diesem Italien sehe ich also plötzlich einen Film, der ein völlig negatives Bild der italienischen Gesellschaft zeichnet, vor dem sich niemand retten kann. La Dolce Vita ist ein pessimistischer Film, der natürlich von den Christdemokraten, aber auch von der kommunistischen Linken, die damals an den neuen Menschen glaubte, angegriffen wurde. Es war die Zeit, in der die Linken Optimisten seien oder so erscheinen mussten.
Da ist die Rolle des jungen Marcello Mastroianni ein sehr ehrgeiziger Intellektueller, dessen Leben eine Katastrophe ist, der seinen Lebensunterhalt als Journalist für eine Boulevardzeitung verdient und davon träumt, berühmt zu werden.
Er ist, wenn man so will, das typische Porträt vieler junger Leute jener Zeit, die keine große Kultur hatten und, um zu überleben, tausend Jobs ausübten, während sie weiterhin vom literarischen Ruhm träumten. Es gibt den kultivierten bürgerlichen Intellektuellen, einen echten Philosophen, der Goethe liest, Bach hört, aber plötzlich seine Töchter umbringt und sich das Leben nimmt.
Das sind die Proletarier, die wie hypnotisiert auf die Felder rennen, um das angebliche Wunder der Madonna zu erleben. Und dann ist da noch das Fernsehen, das all diese armen Menschen filmt, die darauf warten, die Madonna zu sehen. Die Linke hätte sich ein starkes, klares Symbol gewünscht, einen Hauch von Hoffnung, den es letztlich nicht gibt. Musik
Auf jeden Fall ist die italienische Gesellschaft aus dieser Darstellung mit gebrochenen Knochen hervorgegangen. Und all das hat Fellini mit jener Anmut und Leichtigkeit dargestellt, die ihn immer ausgezeichnet haben. Musik
Dieser Film hat mich zum Nachdenken gebracht. Ich halte ihn auch heute noch für den wichtigsten Film der italienischen Nachkriegszeit. Er war der erste Film, in dem niemand verschont blieb. Musik
Tabuki blieb ein Jahr lang in Paris und belegte als Gasthörer einige Philosophie- und Literaturkurse an der Sorbonne. Darunter einige Kurse von Wladimir Junkiewicz.
Auch wenn er damals, wie Tabuki erzählt, nicht genau wusste, wer dieser charmante alte Mann war, der von Philosophie, der Musik, dem Tod, der Ironie sprach. Seine Bücher habe er erst viel später entdeckt. Der französische Philosoph und Musikwissenschaftler Wladimir Jankielewitsch war ukrainischer Herkunft.
In seinem Werk »L'irreversible et la nostalgie« schrieb Jean Kielewitsch, »Das Irreversible ist nicht ein Merkmal der Zeit unter anderen Merkmalen, es ist die Zeitlichkeit der Zeit selbst.«
Mit dieser Formulierung meint John Kelevich, dass die Zeit irreversibel sei. Jede Handlung wird nach diesem Satz in den zeitlichen Raum eingeschrieben. Sie kann nicht wiederholt werden. Wir können an die Orte der Vergangenheit zurückkehren, aber wir können die Vergangenheit nicht erneut erleben. Handeln ist gleichbedeutend damit, unsere Handlungen zu Gefangenen eines Universums zu machen, auf das wir keinen Einfluss mehr nehmen können.
Ein Universum, in dem auch die Leere dessen schwebt, was nicht geschehen ist und nicht mehr geschehen kann. Das erscheint fast wie ein unmittelbarer philosophischer Hintergrund für den Autor Antonio Tabucchi. Die Unveränderlichkeit der Vergangenheit führt seine Figuren zu tiefem Leid.
das sich in verschiedenen Emotionen äußert. Reue und Gewissensbisse erzählen uns vom Schmerz des Unumkehrbaren und von der unmöglichen Geschichte dessen, was nicht gewesen ist.
»Ich würde gerne mehr als ein Leben haben und verschiedene Möglichkeiten, in dieser Welt zu existieren«, so Antonio Tabuchi. In einem Interview von Carlos Gumpert zum Roman »Requiem« reflektiert Tabuchi über die Unveränderlichkeit der Vergangenheit. »Wenn wir Geister heraufbeschwören, sind für mich immer Gewissensbisse dabei.«
Wenn wir an die Toten denken, gibt es Gewissensbisse, weil wir sie nicht genug geliebt haben, weil wir ihnen nicht die Worte gesagt haben, die wir ihnen wirklich sagen wollten, weil wir nicht deutlich genug waren, weil wir zu etwas geschwiegen haben. Die Gewissensbisse rühren von der Unmöglichkeit, weitere Leben leben zu können her und von der Unmöglichkeit, das zu ändern, was gewesen ist.
Das ist der Grund, warum die Toten zurückkehren, warum sie uns heimsuchen und befragen. Und darum geht es in dem Buch, um die Besuche, die der Protagonist erhält, denn scheinbar ist er es, der die Geister besucht. Aber in Wirklichkeit geschieht genau das Gegenteil. Er sitzt lesend in einem Liegestuhl unter einem Baum und es sind die Geister, die zu ihm kommen. Musik
...
Musik
Nach einem Jahr des Herumirrens in Paris wurde mir klar, dass es angebracht war, nach Hause zurückzukehren, wenn ich etwas Konkretes tun wollte. Antonio Tabucchi in einer Aufzeichnung aus dem Jahr 2008.
Auf dem Weg zum Garde Lyon hielt ich vor einem Bukinisten, um ein Buch zu kaufen, das ich im Zug lesen wollte, und sah ein kleines Buch, eine dieser Plakett, die in 400 oder 500 Exemplaren erschienen. Darauf stand Fernando Psoa, ein Unbekannter für mich. Der Titel lautete Bureau de Tabac.
Ein Gedicht mit diesem Titel faszinierte mich. In dem Buch stand links eine fremde Sprache und rechts die französische Übersetzung. Es war eines der schönsten Gedichte von einem der Heteronyme Fernando Psoas, Alvaro de Campuch, das mich sehr beeindruckt hat. Es hat mich wirklich sehr berührt. Ich bin nichts.
Ich werde nie etwas sein. Ich kann nicht einmal etwas sein wollen. Abgesehen davon trage ich in mir alle Träume der Welt. Ihr Fenster meines Zimmers, des Zimmers von einem unter Millionen auf Erden, von dem niemand weiß, wer er ist, und wüssten sie es, wer er ist, was wüssten sie dann, führt zum Geheimnis der ständig von Menschen bevölkerten Straße.
Auf eine Straße, unzugänglich für alle Gedanken, wirklich unmöglich wirklich und sicher, ganz unbekannt sicher, mit dem Geheimnis der Dinge unterhalb ihrer Steine und Lebewesen. Mit dem Tod, der Feuchtigkeit auf die Wände und weißes Haar auf die Menschen legt, mit dem Schicksal, das die Karosse des Ganzen über die Straße des Nichts lenkt.
Ich bin heute zerschlagen, als ob ich die Wahrheit wüsste. Ich bin heute so geistesklar, als ob ich sterben müsste und keine andere Bruderschaft zu den Dingen besäße, als einen Abschied, bei dem dieses Haus, diese Straßenseite, zur Wagenreihe eines Zuges zum Signal der Abfahrt in meinem Kopf werden, zur Nervenerschütterung und zum Knochenknirschen bei der Abfahrt.
Ich bin heute fassungslos für jemand, der dachte und fand und vergaß. Ich teile mich heute in die Treue, die ich dem Tabakladen der anderen Straßenseite als äußere Wirklichkeit schulde und die Empfindung, dass alles nur ein Traum ist als innere Wirklichkeit.
Das ganze Gedicht Tabakladen steht völlig im Zeichen der Dialektik dieser beiden Gegensätze. Antonio Tabucchi aus dem Buch Wer war Fernando Psoa? Einerseits des Wunsches, die Erscheinungswelt, die vom Tabakladen auf der anderen Straßenseite symbolisiert wird, zu akzeptieren. Und andererseits der Spekulationen des Dichters über die äußere Wirklichkeit.
Oder anders gesagt, des Gegensatzes zwischen der naturalis salus, die darin besteht, die phänomenale Wirklichkeit zu akzeptieren, und dem metaphysischen Schauder infolge des Zweifels an eben dieser Wirklichkeit. Doch der Besitzer des Tabakladens trat an die Tür und blieb an der Tür. Ich betrachtete ihn mit dem Unbehagen des schräg gedrehten Kopfes und mit dem Unbehagen der missverstehenden Seele.
Er wird sterben und ich werde sterben. Er wird das Ladenschild hinterlassen und ich hinterlasse Verse. Tabakladen von Fernando Psoas heteronym Alvaro de Campos. Irgendwann verrotten dann das Ladenschild und auch die Verse. Nach einiger Zeit stirbt die Straße, in der das Ladenschild hing und die Sprache, in der die Verse geschrieben wurden. Später stirbt dann der kreisende Planet, auf dem sich dies alles zutrug.
Auf anderen Satelliten anderer Sternsysteme werden menschenähnliche Wesen fortfahren, solche Dinge wie Verse zu machen und unter Dingen wie Ladenschildern zu leben, immer das eine dem anderen gegenüber, immer das eine so nutzlos wie das andere, das Unmögliche immer so töricht wie das Reale, das Geheimnis am Grunde immer so sicher wie der Geheimnisschlaf an der Oberfläche, immer dies oder anderes oder weder dies noch das andere.
Doch ein Mann trat ein in den Tabakladen, um Tabak zu kaufen. Und die glaubhafte Wirklichkeit überwältigt mich jäh. Ich richte mich auf, energisch und überzeugt und menschlich und will versuchen, diese Verse zu schreiben, in denen ich gerade das Gegenteil sage. Bei dem Gedanken, sie schreiben zu wollen, zünde ich mir eine Zigarette an und genieße beim Rauchen Befreiung von allen Gedanken.
Ich verfolge den Rauch, als wäre es mein eigener Weg und genieße in einem feinfühligen, dazu passenden Augenblick die Befreiung von allen Spekulationen und das Bewusstsein, dass Metaphysik nur die Folge von Unwohlsein ist. Mit diesem Werk Psuas begann für Tabuki eine weitere lange Reise, die sich über Jahrzehnte hinzog und aus Übersetzungen, Analysen und Essays bestand.
Eine Reise, auf der er Psoas Universum umfassend durchquerte. In unserem so menschenfreundlichen und gleichzeitig so ruchlosen Jahrhundert fürchtet sich Psoa vor jeglicher Menschenliebe und vor jeglicher Ruchlosigkeit.
Er mag weder die tröstlichen, barmherzigen Theorien, deren beunruhigende Kehrseite er zum Vorschein bringt, noch die feierlichen, charismatischen Utopien. Beinahe, als würde er die Gräuel und Gemetzel voraussehen, die in ihrem Namen begangen werden sollten. Psoar ist ein vielfaches, ungeheures, schlechtes Gewissen.
»Meines, unseres, eures, das aller Menschen, die guten Willens sind, um was für einen guten Willen es sich auch immer handeln mag. Psoar ist ein Schmerzensschrei und ein Gewinsel, ein lauter Gesang und eine Grimasse, ein Nagel, der über die Schiefertafel kratzt, auf der ein wackerer Professor gerade den beruhigenden Nachweis seines Theorems erbringen will.«
Psoa ist eine Konkretion, eines jener Wesen, die offenbar vom Schicksal aus ersehen sind, Leiden auf sich zu nehmen, die nicht die ihren sind. Wie bei den Morsezeichen in dem Gedicht, das ihm Murillo Mendes gewidmet hat, bei denen das Ja nur als Verneinung existiert, besteht die Negativität Psoas vielleicht darin,
In seiner Scheu vor dem affirmativen Zeichen, in seiner Ablehnung des Allgemeingültigen. Ist er, der absolut nichts lehren will, dieser feierliche Erforscher der nichtigen Dinge, als der er sich selbst bezeichnet, eine Warnung oder eine Drohung, ein freundlicher Wink oder ein Gelächter im Dunkeln? Musik
Musik
* Musik *
In Pisa begann ich an der Philosophischen Fakultät zu studieren und stellte fest, dass es in der Abteilung für Romanische Philologie einen Kurs für Portugiesische Sprache und Literatur gab. Antonio Tabuchi in einer Aufzeichnung aus dem Jahr 2008.
Ich nahm mit Begeisterung daran teil und erwies mich am Ende des Jahres als der beste Student. Man sagte mir, es gäbe ein Stipendium und wenn ich wollte, könnte ich nach Portugal gehen. Und ich ging.
Ich lernte ein Land kennen, das sich in einer äußerst schweren Situation befand. Ich lernte Schriftsteller kennen, die in großen Schwierigkeiten steckten. Sie kamen oft ins Gefängnis, weil sie gegen Salazar waren. Und dann traf ich Maria José, meine Frau. Und Portugal trat in mein Leben.
1965 fährt Dabuki mit seinem Fiat Cinquecento zum ersten Mal nach Portugal. Dort trifft er wichtige portugiesische Schriftsteller und Intellektuelle, darunter José Cardoso Pires, die vom Salazar-Regime verfolgt wurden.
und knüpft Beziehungen zu den surrealistischen Dichtern, insbesondere zu Alexandre O'Neill und Mario Cesarini, dem Hauptvertreter des Surrealismus in Portugal. In ständiger Gefahr, unterdrückt und verarmt, behaupteten sich diese Autoren mit Ironie und Wortspielen gegen das Salazar-Regime. 1971 veröffentlicht Tabuki seine erste Studie über portugiesische Autoren »Das verbotene Wort«.
Seine größte Leistung als Literaturwissenschaftler bleibt jedoch die Analyse, die Übersetzung und die Verbreitung des Werkes Fernando Psoas. Ich habe meine Arbeit als Philologe mit einer Vorliebe für die Entdeckung dieses großen Dichters ausgeübt, der zu dieser Zeit in Italien praktisch unbekannt war.
Ich erinnere mich, dass ich 1969 oder 1970 die erste Übersetzung von Psoa in einer Zeitschrift veröffentlichte, einer schönen Theaterzeitschrift namens Il Drama. Von Psoa gab es noch keine zuverlässige kritische Ausgabe, nicht einmal in Portugal.
Auch deshalb, weil sich der ganze Koffer mit den Manuskripten noch im Haus seiner Schwester befand, einer freundlichen und reizenden Dame, die ich zu Besuchen pflegte, um darin zu stöbern.
Damals gab es nur die alte Attica-Ausgabe, also die Ausgaben, die Psoas Bewunderer veröffentlichten. In der italienischen Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts sind die Figur und das Werk Fernando Psoas unzertrennlich von den Namen Antonio Taubucki und Maria José de Lancastre, deren Übersetzungen mehrere Generationen von Literaturwissenschaftlern und Lesern geprägt haben.
Ich achtete darauf, dass es keine Interpretationsfehler gab. Antonio nahm diese übersetzten Sätze und verwandelte sie in Poesie auf Italienisch.
Es war auch ein ziemliches Abenteuer, weil Psoe in der Literatur alles ausprobierte. Zum Beispiel interessierten ihn einmal die volkstümlichen Vierzeiler und er schrieb 1000 volkstümliche Vierzeiler. Hier in Lisboa gibt es eine Tradition zu Ehren des Schutzpatrons, des heiligen Antonius, der am 13. Juni gefeiert wird.
Man stellt einen populären Vierzeiler in eine Vase mit kleinblättrigem Basilikum. Man würde nicht auf die Idee kommen, diese Volkstradition mit Pseu und seiner metaphysischen Poesie in Verbindung zu bringen. Aber auch das hat er sehr gerne gemacht. Er, der alles auf dem Gebiet der Fantasie und des Wissens ausprobierte. Er schreibt metaphysische Poesie.
Was die Studie vom Suhas Werk betrifft, so gehören Tabuki und de Lancastre zweifellos zur Avantgarde ihrer Zeit. Das Buch der Unruhe zum Beispiel wurde auf Portugiesisch zum ersten Mal im Jahr 1982 veröffentlicht. Tabuki und de Lancastre geben es bereits 1986 in Italien heraus.
Aber Psoa spielt für Tabukis Leben und Schaffen eine Rolle, die weit darüber hinausgeht, dass Tabuki einen grundlegenden Beitrag zur Verbreitung und Analyse des Werkes leistet. Die philosophische Dimension von Psoa dringt in das literarische Universum Tabukis, in dem sich die Grenzen zwischen Wirklichkeit und imaginärem Realität und Traum langsam auflösen,
und die Frage der Identität keine eindeutige Antwort findet. Von Maurice Blanchot stammt die Feststellung, ein Buch habe immer, auch wenn es fragmentarisch ist, ein Zentrum, um das es kreise. Ein Zentrum, das nicht fix ist, sondern sich aufgrund des Drucks des Buches und der Umstände seiner Entstehung verlagert.
Zugleich ein fixes Zentrum, das sich verlagert, sofern es ein wahres Zentrum ist, während es dasselbe bleibt und immer zentraler wird, immer verborgener, ungewisser und gebieterischer. Es ist beinahe ein Pleonasmus festzustellen,
Die Heteronymie sei das verborgenste und gewiss das gebieterischste Zentrum des umfangreichen und geheimnisvollen Buches, das uns Psoe hinterlassen hat. Wobei wir Heteronymie nicht nur als metaphorische Theatergarderobe verstehen, in der der Schauspieler Psoe sich versteckt, um seine literarisch-stilistischen Verkleidungen anzulegen,
sondern als wahre Freizone, als terrain vague, als magische Linie, die Psoa überschritten hat, um ein anderer zu werden und dabei er selbst zu bleiben. Psoas Fiktion ist immer eine transzendente Fiktion, ist Wort, aber im Sinn von »Energie in Ologos«, »Am Anfang war das Wort«.
Und dieses Wort ist gewiss nicht der literarische Text. Psoas Logos ist in seiner Transzendenz, in seiner Eigenschaft als Metatext eine Abweichung, verlässt die existenziell-textuelle Ebene und ereignet sich im ontologisch-metaphysischen.
Mit einem Kalauer könnte man sagen, das Spiel Psoas bestehe darin, das Spiel zu spielen, es zu lösen, ohne sich darauf einzulassen, auf die Ebene der reinen Mutmaßung überzuwechseln.
Man könnte über Psoas sagen, was Benjamin über Kafka geschrieben hat. Dass nämlich Kafkas ganzes Werk einen Kodex von Gesten darstellt, die keineswegs von Hause aus für den Verfasser eine sichere symbolische Bedeutung haben, vielmehr in immer wieder anderen Zusammenhängen und Versuchsanordnungen um eine solche angegangen werden. Musik
Es war Psoas Idee der Selbstvervielfältigung. In dem Moment, in dem man sich als der andere vorstellt, kann man für einen Moment der andere sein, wenn man die Realität als Möglichkeit, als Erzählung, als Befragung betrachtet. Wie Erzählung, wie Interrogation usw.
Dies geschieht auf einer emotionalen und intellektuellen Ebene. Sich auf die Spur von jemandem zu begeben, der nicht mehr ist, bedeutet auch, eine Identität in der Zeit zu verfolgen. Tabuki sagt, dass von allem etwas bleibt, dass eine Spur von uns bleibt.
Wenn wir uns auf die Suche in Zeit und Raum begeben, setzen wir unsere Identität mit der Identität eines Verstorbenen in Beziehung, aber nicht im herkömmlichen Sinn. Die Toten sind nicht außerhalb, sondern innerhalb der Zeit. Ich erkläre dies mit einem für Tabuki typischen Bild. Sein Onkel sagt etwas in sein Ohr, während er in einem Hotel in Singapur schläft.
Dieses Hören auf die Geister bedeutet, die eigene Identität in der Beziehung zu den Schatten zu nähren und zu spüren, dass es eine viel größere Gegenwart gibt, die auch aus der Vergangenheit derer besteht, denen wir begegnet sind.
Niente finisce, tutto appunto continua a trasformarsi, tutto continua a esistere. Du in qualche modo stai dentro quel passato, dentro qualcosa che esiste nel tuo presente però.
Auf Reisen begegnet man vor allem Lebenden, hin und wieder auch Sterbenden und manchmal auch Toten, je nachdem, wo man sich aufhält. In gewissen Ländern zum Beispiel trifft man heutzutage viele Tote, aber auch die eigenen Toten bzw. die Toten, die wir kennengelernt haben, als sie noch am Leben waren. Musik
So kommt es zum Beispiel vor, dass jemand in einer einfachen Pension in Lissabon an einem Augustsonntag, wenn die Stadt wie ausgestorben ist, Besuch von seinem Vater erhält, der seit geraumer Zeit tot ist. Antonio Tabucchi im Gespräch mit Paolo Di Paolo. Ausschnitt aus dem Buch Reisen und andere Reisen. Warum ist er nicht nach Hause gekommen? Sind die Toten schüchtern?
Wäre es ihm schwergefallen, an einen Ort zurückzukehren, der ihm allzu bekannt war? Auch kommt es vor, dass man in einem anonymen Hotelzimmer in Singapur, ganz oben im obersten Stockwerk eines Wolkenkratzers, plötzlich die Stimme eines Onkels aus Luka hört. Was für eine Kraft die Stimme doch haben muss, wenn sie von so weit herkommt, während wir sie aus der Nähe nie gehört haben.
Man schläft in einem Hotel in Singapur und wird von der Stimme eines Onkels aus Luka geweckt. Vielleicht, weil er den ganzen Mist, der im Alltag herumliegt, hinweggefegt hat?
Vielleicht, weil die Toten, die wie Wale mithilfe einer Art natürlichem Sonar kommunizieren, damit sie von den vielen künstlichen Tönen, die die Ozeane durchsetzen, nicht gestört werden, akustisch sauberes Wasser brauchen, damit sich ihre Stimme nicht in dem Hintergrundgeräusch verliert, das uns umgibt? Vom Besuch seines Vaters träumte Tabuki in einem Hotelzimmer in Paris.
Im Traum sprach sein Vater zu ihm auf Portugiesisch, also eine Sprache, die sein Vater nicht kannte, die aber in Tabukis Leben eine große Rolle spielte. Am folgenden Tag versucht Tabuki, sich des Traumes zu entsinnen. In einem Pariser Café beginnt er so, seinen ersten und einzigen auf Portugiesisch verfassten Roman zu schreiben, »Lissabonner Requiem«, »Eine Halluzination«.
Der Protagonist befindet sich im Urlaub in Azeitau, ca. 35 km südlich von Lissabon, im Landhaus eines Freundes. Er schläft unter einem Baum ein. Plötzlich findet sich der Mann zur Mittagszeit, ohne zu wissen wie, in einem menschenleeren Lissabon an einem heißen Juli-Sonntag wieder.
Er weiß, dass er etwas zu tun hat. Er ist mit dem größten Dichter des 20. Jahrhunderts verabredet, mit jemandem also, der längst verstorben ist und wie alle Geister wahrscheinlich erst um Mitternacht auftaucht. Der Protagonist weiß nicht, wie er ihn treffen kann. So verlässt er sich auf den Fluss der Zufälle, nach einer Logik, die den freien Assoziationen des Unbewussten folgt.
Er begibt sich auf eine Reise, die ihn dazu führt, Vergangenes erneut zu erleben. Zwölf Stunden fährt er durch Lissabon und durch die bedeutungsvollsten Momente seines Lebens, versucht, die ungelösten Knoten seiner Reue und die Rätsel seines Lebens zu entwirren. Vergangenheit und Gegenwart vermischen sich, um sich gegenseitig zu offenbaren. Tote und Lebende treffen sich in einem real erscheinenden Alltag.
Der Protagonist trifft seinen Vater, einen Losverkäufer, einen Kopisten der Details aus Hieronymus Boschs Versuchung des heiligen Antonius nachmalt, eine ehemalige Puffmutter, einen alten Freund und Rivalen, seine ehemalige Geliebte Isabel. Um Mitternacht hat er schließlich das erwartete Gespräch mit dem Geist, der ihn gerufen hatte, der größte Dichter des 20. Jahrhunderts, Fernando Psoa. Musik
»Eigentlich wollte nicht ich Sie sehen,« erklärte ich, »sondern Sie wollten mich sehen.« »Nun, ich habe Ihre Botschaft erhalten,« sagte er. »Das ist stark,« sagte ich. »Heute Morgen habe ich ruhig unter einem Baum in Esatero gesessen und gelesen. Sie haben mich zu sich gerufen.« »Schon gut,« sagte mein Gast. »Wie Sie wollen, wir werden uns nicht streiten. Sagen wir, ich würde gerne wissen, was Ihre Absichten sind.« »In Bezug worauf?« fragte ich.
»In Bezug auf mich zum Beispiel«, sagte mein Gast. »In Bezug auf mich. Das interessiert mich.« »Sind Sie zufälligerweise etwas egozentrisch?« fragte ich. »Natürlich«, antwortete er. »Aber was soll man machen? Alle Dichter sind egozentrisch. Und mein Ego hat ein ganz besonderes Zentrum. Übrigens, wenn ich Ihnen sagen wollte, wo sich dieses Zentrum befindet, wüsste ich es nicht.«
»Über das, was Sie mir gerade sagen, habe ich mir einige Gedanken gemacht«, sagte ich. »Ich habe mein Leben damit verbracht, mir über Sie Gedanken zu machen. Und jetzt habe ich genug davon. Genau das wollte ich Ihnen sagen.« »Please«, sagte er, »Sie werden mich doch nicht mit Menschen alleinlassen, die keine Zweifel haben. Das sind schreckliche Leute.«
»Sie brauchen mich nicht«, sagte ich. »Erzählen Sie mir keine Geschichten. Die ganze Welt bewundert Sie. Ich habe Sie gebraucht, aber jetzt möchte ich aufhören, jemanden zu brauchen. Das ist alles. Haben Sie sich nicht wohlgefühlt in meiner Gesellschaft?« fragte er. »Nein«, antwortete ich. »Sie war sehr wichtig, aber sie hat mich beunruhigt. Ja, sagen wir, sie hat mich beunruhigt.« »Ach ja«, bestätigte er.
»Bei mir ist das letztendlich immer so, aber, hören Sie, glauben Sie nicht, dass die Literatur genau das tun muss?« »Beunruhigen?« »Was mich anbelangt, so habe ich kein Vertrauen in eine Literatur, die das Gewissen beruhigt.« »Ich auch nicht,« stimmte ich zu. »Aber schauen Sie, ich bin selbst schon unruhig genug. Ihre Unruhe gesellt sich zu meiner und verursacht Angst.«
»Mir ist Angst lieber als ein fauler Friede«, behauptete er, »von beiden ist mir die Angst lieber.« Als Erzähler fühlte sich Tabuki immer zu dem Geheimnis des Lebens vom Psoa und dem seines Charakters hingezogen. Denn Psoa ist für ihn nicht nur ein Dichter, sondern auch eine Figur.
Die Figur, die er für sich selbst war, und die Figur, die er für andere ist, umhüllt von einer geheimnisvollen Aura. Er lebte das Leben eines bescheidenen Angestellten, der in gemieteten Zimmern wohnte und sich ganz dem Schreiben widmete. Im Roman »Lissaboner Requiem« kann der Protagonist sich nicht entziehen, der Figur Psoar die Fragen zu stellen, die seine Kritiker nicht lösen können.
Hören Sie, ich habe zugelassen, dass alle dachten, ich hätte eine geheimnisvolle Kindheit gehabt, weil ich die Kindheit aus meinen Schriften verbannte. Aber das sind lauter Märchen, glauben Sie mir, nur um die Kritiker in die Irre zu führen. Ich halte sie für dermaßen indiskret, dass ich mich lieber von Anfang an über sie lustig gemacht habe.
Sie sind ein Lügner, sagte ich. Ein großer Lügner. Vielleicht haben Sie sogar Ihre Kritiker getäuscht. Aber wenn Sie jetzt auch mich täuschen wollen, heißt das, dass Sie sich nicht an die Regeln halten. Hören Sie, sagte er. Sie können ruhig glauben, dass ich nicht aufrichtig bin in dem Sinne, wie Sie den Begriff verstehen. Meine Gefühle entstehen nur durch eine wahrhaftige Fiktion.
Ihre Art von Aufrichtigkeit halte ich für eine Art Armut. Die höchste Wahrheit besteht in der Fiktion. Das war schon immer meine Überzeugung. Sie übertreiben, sagte ich. Das ist jetzt eine zweifache Lüge. So geht es nicht. Es geht. Und wie es geht, erwiderte mein Gast. Es kommt einzig und allein darauf an, etwas zu spüren.
»Ja«, sagte ich, »ich bin auch davon überzeugt, dass Sie alles gespürt haben. Ich dachte sogar immer, Sie hätten Dinge gespürt, die normale Menschen nicht zu spüren imstande wären. Ich habe immer an Ihre okkulten Fähigkeiten geglaubt. Sie sind ein Zauberer und genau deshalb bin ich hier und habe den Tag so verbracht, wie ich ihn nun eben verbracht habe.« »Und? Sind Sie zufrieden mit der Art und Weise, wie Sie den Tag verbracht haben?«, fragte er. »Das könnte ich nicht sagen«, antwortete ich.
Ich fühle mich ruhiger, leichter. Genau das haben sie gebraucht, sagte er. Ich bin ihnen sehr dankbar, sagte ich. Psoa als Figur erscheint auch in Tabukis Buch die letzten drei Tage des Fernando Psoa, ein Delirium. Und im Theaterstück Herr Pirandello wird am Telefon verlangt, ein versäumter Dialog, das in einer psychiatrischen Klinik spielt.
Der Protagonist ist ein Schauspieler, der als Psoa das Publikum unterhalten möchte. Oder vielleicht Psoa selbst, der vorgibt, ein Schauspieler zu sein und sich vorstellt, mit Luigi Pirandello zu telefonieren.
In diesem Stück ruft Tabuki seinen Wunsch ins Leben, ein Gespräch Psoas mit dem italienischen Schriftsteller Luigi Pirandello zu erleben. Zwei Autoren, die sich nie begegnet sind und deren Poetik in vielerlei Hinsicht Gemeinsamkeiten aufweist.
Eine Poetik, die in Tabukis Werk eindringt und damit eine lange literarische Tradition fortsetzt. Und so muss man Pascoli wirklich zustimmen, wenn er sagt, dass der Künstler zu einem solchen wird,
weil er in der Lage ist, das Kind, das er war, zu bewahren und es sein Leben lang mit sich zu tragen. Nach dieser Theorie gäbe es also in der Künstlerseele einen kleinen verborgenen Geist, der bei jedem von ihnen eine andere Gestalt annimmt.
Bei Pascoli ist es der Fancholino, das kleine Kind. Bei Grodek heißt er Es. Bei Psoa ist er ein Heteronym und bei Pirandello eine Maske. In meinem Fall ist es wahrscheinlich ein Doppelgänger, dieser Geist aus den Märchen, der so viele verschiedene Gesichter und Aspekte annimmt, dass er nicht erkannt werden kann, obwohl er auf die eine oder andere Weise immer ein Spiegelbild von mir bleibt.
Wenn man schreibt, ist man selbst. Aber gleichzeitig ist man es nicht. Man hat das Gefühl, jemanden in sich zu tragen, der manchmal eine außergewöhnliche Macht über einen ausüben kann. Musik
Bewegt von einer unbewussten Suche nach der eigenen Identität, von dem Schmerz, die Vergangenheit nicht ändern zu können, von dem Wunsch, einen verpassten und unmöglichen Dialog mit dem Anderen, dem Abwesenden wiederherzustellen, bewegen sich Tabukis Figuren in einem Labyrinth, in dem es keine Lösung oder Absolution gibt. Der Weg, den sie gehen, konfrontiert sie mit einem Geheimnis.
Der andere, der Abwesende, den die Protagonisten finden wollen, dem sie Fragen stellen wollen, entkommt und löst jene Bewegung aus, die sie immer weiter in das Labyrinth treibt.
Dies geschieht mit Spino, dem Protagonisten des Romans »Am Rande des Horizonts«, genauso wie mit Ruh, dem Protagonisten vom indischen Nachtstück. »Mein Nachtstück« entstand hauptsächlich aus einer primären Obsession, aus einer dieser vielleicht absurden Ideen, die manchmal in der Literatur, aber auch in den Meandern des Geistes oder einfachem Leben auftauchen.
Eigentlich war ich in Indien, um eine bibliografische Recherche abzuschließen, als mich eine seltsame Fantasie überkam, genau wie der Ich-Erzähler, der eine literarische Form übernahm, die schließlich zu einem Roman wurde. Und diese seltsame Idee, die mir kam, während ich durch Indien wanderte, war folgende.
»Es gab eine Person, die ich kannte, die aus meinem Leben verschwunden war und von der ich lange Zeit nichts wusste. Ich wusste nicht, wo er war und was aus ihm geworden war, aber ich wusste mit Sicherheit, dass er nicht in Indien verschwunden war. Obwohl ich mir absolut sicher war, konnte ich nicht aufhören, daran zu denken, dass ich ihn vielleicht auf einer Reise durch Indien treffen würde, denn so etwas kann im Leben passieren.«
Natürlich traf ich diese Person nicht. Aber als ich nach Hause zurückkehrte, wurde mir klar, dass es einen anderen Weg gab, ihn zu finden. Das Schreiben eines Romans. Und ich machte mich an die Arbeit. Der Protagonist Rue reist nach Indien, wo er Xavier, einen portugiesischen Freund, der sich verirrt hat, ausfindig machen will.
Er hat nur wenige vage Spuren. Einen Brief, einige verwirrte oder zurückhaltende Aussagen, eine sehr allgemeine Notiz, Zeichen, Bruchstücke, die er mühsam zusammenzusetzen versucht. Es gibt etwas Unstimmiges in dieser Suche nach dem verlorenen Freund, nach einem Schatten der Vergangenheit. Es ist eine Reise in einem Indien, das man nur in Hotelzimmern, Krankenhäusern, Bahnhöfen vorwiegend nachts kennenlernt.
Und das doch kurz aufblitzt in den wesentlichen Gesprächen mit Propheten, die man in Bussen trifft, mit portugiesischen Jesuiten, mit Gnostikern einer theosophischen Gesellschaft. Was zunächst unstimmig erscheint, weist auf ein hinter Andeutungen und Details verborgenes Geheimnis hin. Die nächtliche und okkulte Seite der Dinge, das ist das Thema des indischen Nachtstücks.
Bemerkenswert ist in dieser Hinsicht der Abschied zwischen dem Protagonisten und einem seiner Gesprächspartner, dem Mitglied der theosophischen Gesellschaft. Ich stand auf und er führte mich durch den langen Korridor bis zur Eingangstür. Ich blieb einen Augenblick in der Halle stehen und wir schüttelten uns die Hand. Beim Hinausgehen dankte ich ihm kurz. Er lächelte wortlos. Dann sagte er, bevor er die Türe schloss,
Die blinde Wissenschaft pflügt eitle Schollen. Der irre Glaube lebt im Traum seines Kults. Ein neuer Gott ist nur ein Wort. Hör auf zu glauben und zu suchen. Alles liegt im Dunkeln.
Ich ging die wenigen Stufen hinab und machte ein paar Schritte auf dem Kiesweg. Dann begriff ich mit einem Mal und drehte mich rasch um. Es waren die Zeilen eines Gedichts von Psoa, die er jedoch auf Englisch rezitiert hatte, weswegen ich sie nicht sofort erkannt hatte.
Die Faszination für Indien und die Eindrücke dieser Reise, die im Gespräch mit dem Gnostiker der theosophischen Gesellschaft oder in der Begegnung mit dem Arhant, einem Propheten, auftauchen, bleiben gedämpft und unscharf. Sie lassen immer einen Hauch von etwas Unausgesprochenem oder gar Unerreichbarem zurück. Während seiner Reise im nächtlichen Indien landet Ruh in einer Busstation und wartet auf die Weiterfahrt.
Dort begegnet er einem Arhant, einem merkwürdigen Propheten, der wie ein kleiner Affe, wie ein Ungeheuer aussieht. Auf Nachfrage behauptet der Prophet, das Karma des Protagonisten nicht lesen zu können, da er in seinem Gegenüber nur Maya, die Erscheinung der Welt, und keinen Atman, die individuelle Seele erkennt.
Der selbliche Wunsch, sich selbst zu kennen und zu erforschen, die eigene Identität zu fassen, gerät in die Schwebe. Was soll er sehen? Wo mein Atman ist, sagte ich. Sagtest du nicht, er sei ein Hellseher?
Der Junge gab meine Frage weiter und der Bruder antwortete kurz. »Er sagt, er kann es versuchen«, übersetzte er mir. »Aber er kann nichts versprechen.« »Das macht nichts. Er soll es trotzdem versuchen.« Das Ungeheuer blickte mich lange Zeit sehr eindringlich an. Dann machte er eine Geste mit der Hand und ich wartete darauf, dass er zu sprechen begann, aber er sagte nichts. Seine Finger bewegten sich leicht in der Luft und zeichneten Wellen nach.
Dann legte er die Hände zu einer Muschel zusammen, um darin imaginäres Wasser einzufangen. Er flüsterte ein paar Worte. Er sagt, du bist auf einem Boot, sagte der Junge, ebenfalls im Flüsterton. Das Ungeheuer streckte die Hände aus, mit den Handflächen nach oben und erstarrte. Auf einem Schiff? fragte ich. Frag ihn, wo, schnell, was für ein Schiff ist es? Der Junge lehnte das Ohr an den flüsternden Mund seines Bruders. Er sieht viele Lichter.
Mehr sieht er nicht. Es hat keinen Sinn, darauf zu bestehen. Der Hellseher hatte wieder seine ursprüngliche Haltung eingenommen, das Gesicht in den Haaren seines Bruders verborgen. Die Geheimnisse Indiens und die indischen Bräuche bleiben im Roman schwer begreifbar. Sie werden höchstens an der Oberfläche wahrgenommen, mit extremer und bewusster Flüchtigkeit berührt.
Die Figur der Fotografin Christine, die gegen Ende des Romans auftaucht, bietet sich als Sprachrohr für diese Poetik des unscharfen Blicks an. »Waren Sie noch nie in Kalkutta?« Ich schüttelte den Kopf. »Fahren Sie ja nicht hin«, sagte Christine. »Machen Sie nie diesen Fehler.« Ich dachte, jemand wie Sisa der Ansicht...
Im Leben sollte man so viel wie möglich sehen. Nein, sagte sie überzeugt, so wenig wie möglich. Wenn man genau liest, weiß man am Ende auch nicht, weiß er eigentlich, was dieser Mann gemacht hat, dieser Freund? War der in Drogen unterwegs? Ist das Ganze sowieso eine Halluzination? Was ist diese eigentümliche Freundin, die er da trifft? Der Schriftsteller und Verleger Michael Krüger. Mit allen Worten,
Alles wird opak. Die ganze Wirklichkeit löst sich auf wie ein fadenscheiniger Stoff und zerfällt in die verschiedensten Teile, ohne dass die Erzählung darunter leidet. Die Erzählung bleibt sozusagen mit einer festen Stimme erhalten, aber alle diese Dinge zerfasern. Und ich glaube, das ist eines seiner großen Talente,
geschult an Borges, ohne jede Frage, dass man sozusagen über die unwahrscheinlichsten Dinge mit der haltbarsten und festesten Stimme sprechen muss. Die Suche, die der Protagonist unternimmt, scheint ihren Sinn zu verlieren, während er durch das Labyrinth voranschreitet. Die Identität seines vermissten Freundes und der eigentliche Zweck der Suche werden immer unschärfer.
Am Ende des Romans wird das Rätsel nicht gelöst. Im Gegenteil. Es verdichtet sich durch die Umkehrung der Perspektive. Bedeutungsvoll ist nicht mehr der Zweck, den vermissten Freund zu finden, sondern die Suche selbst, die Reise und das geheimnisvolle Indien.
Beim Abendessen im Restaurant seines Hotels erzählt Ruh der jungen Fotografin Christine, dass er einen Roman schreibt. »Der Inhalt ist, dass ich in diesem Buch jemand bin, der in Indien verloren gegangen ist«, wiederholte ich. »Sagen wir es einmal so. Ein anderer sucht mich, aber ich habe durchaus nicht die Absicht, mich finden zu lassen.«
Ich habe gesehen, wie er angekommen ist. Ich bin ihm gewissermaßen Tag für Tag gefolgt. Ich kenne seine Vorlieben und seine Abneigungen, seinen Elan und sein Misstrauen, seine Großzügigkeit und seine Ängste. Ich habe ihn praktisch unter Kontrolle.
Er hingegen weiß so gut wie nichts von mir. Er hat ein paar ungenaue Anhaltspunkte, einen Brief, verworrene oder widerstrebend abgegebene Aussagen, ein ziemlich nichtssagendes Kärtchen, Zeichen, Bruchstücke, die er mühsam zusammenzufügen versucht. Aber wer sind sie? fragte Christine. Ich meine im Buch. Das wird nicht gesagt, antwortete ich.
Ich bin einer, der nicht gefunden werden möchte. Also verstößt es gegen die Spielregeln, zu sagen, wer er ist. Der, der sie sucht und den sie so gut zu kennen scheinen, fragte Christine weiter, kennt der sie? Früher einmal kannte er mich, sagen wir, wir waren sehr gute Freunde in der Vergangenheit, aber das geschah vor langer Zeit außerhalb des Rahmens des Buchs.
Das indische Nachtstück, kurze Geschichte, ist ja nicht lang, ist aber immer eines meiner Lieblingsbücher von ihm geblieben. Michael Krüger. Und es hört ja auch so wunderbar auf. Die Korridore, die zu den Zimmern führten, hatten ein Dach aus poliertem Holz wie ein Kreuzgang. Und sie blickten auf die im Dunkel liegenden Büsche, die hinter dem Hotel wucherten.
Wir waren wohl unter den Ersten, die sich auf ihr Zimmer zurückzogen, denn die anderen Gäste waren zum Großteil auf der Terrasse geblieben und hörten in den Liegestühlen ausgestreckt der Musik zu. Wir gingen schweigend nebeneinander her und am Ende des Balkons hörten wir einen Augenblick lang einen großen Nachtfalter schwirren. »Irgendetwas in Ihrem Buch stimmt nicht«, sagte Christine. »Ich weiß nicht recht, was«,
Aber irgendetwas stimmt nicht. Das glaube ich auch, antwortete ich. Hören Sie zu, sagte Christine. Sie sind mit meiner Kritik immer einverstanden. Das ist unerträglich. Aber ich bin überzeugt davon, behauptete ich. Wirklich. Es ist wohl so ähnlich wie bei Ihrem Foto. Der vergrößerte Ausschnitt verfälscht den Kontext. Man muss die Dinge aus der Entfernung betrachten. M'effiez vous de m'en so choisis.
»Wie lange bleiben Sie hier?« fragte sie mich. »Morgen reise ich ab.« »Sobald?« »Meine toten Ratten erwarten mich«, sagte ich. »Jeder hat seine Arbeit.« Ich versuchte die resignierte Geste nachzumachen, mit der sie über ihre Arbeit gesprochen hat. »Auch ich werde dafür bezahlt.« Sie lächelte und steckte den Schlüssel ins Schloss.
Also diese 25 Zeilen sind so voller Anspielungen, Echos von verschiedenen anderen Erzählungen und trotzdem sind sie ganz konkret. Jemand geht mit jemand, der ganz offensichtlich eine Nähe spürt und gleichzeitig kann man dieser Nähe nicht nachgeben. Und sie lächelte und steckte den Schlüssel ins Schloss.
Normalerweise würde man jetzt sagen, naja, wenn jemand Schlüssel ins Sock trägt, geht eine Tür auf und was beginnt? Eine neue Geschichte. Ich bin in die Wälder gegangen, in die Wälder gegangen.
Ich habe ihm eine reichere Rose gegeben, um sich an mich zu erinnern. Ich habe ihm eine reichere Rose gegeben, um sich an mich zu erinnern. Ich bin mein Nachbar gesehen, da an den Seiten des Passauers.
Ich bin mit meinem Wenzin nach den Flächen gegangen. Ich habe mir ein Lenz von Linho, das ist das finstere Bragau. Ich habe mir ein Lenz von Linho, das ist das finstere Bragau.
# Minha mai kuade morrer # Minha mai kuade morrer # Ai choro por quem muito amargo # Ai choro por quem muito amargo # Para então dizer ao mundo # Para então dizer ao mundo # Ai Deus me deu, ai Deus me levou # Ai Deus me deu, ai Deus me levou # Ai Deus me deu, ai Deus me levou
Es gibt noch eine andere Definition von Literatur, die Tabuki gegeben hat. Literatur ist im Grunde genommen eine Vision der Welt, die sich von derjenigen unterscheidet, die uns durch das herrschende Denken, oder besser gesagt, durch das Denken derjenigen, die an der Macht sind, aufgezwungen wird.
Qualsiasi esso sia. Quindi il fatto della libertà di pensiero
Es geht um die Freiheit des Denkens, um die Fähigkeit zur Kritik, um die Fähigkeit, die Widersprüche der Welt aufzuzeigen. Unter diesem Gesichtspunkt möchte ich Ihnen einen Satz aus Erklärt Pereira zitieren. Die Philosophie scheint sich nur mit der Wahrheit zu befassen, aber vielleicht spricht sie auch nur aus den Fantasien. Und die Literatur scheint sich nur mit Fantasien zu befassen, erzählt aber vielleicht die Wahrheit.
Ich glaube also, dass es zumindest in der Art und Weise, wie ich Tabuki lese, auch eine Suche nach der Wahrheit gibt.
An einem Abend im September 1992 erdacht,
In zwei Monaten, im Sommer des folgenden Jahres geschrieben und 1994 veröffentlicht, ist »Erklärt Perera« eines der wichtigsten italienischen Werke der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und Antonio Tabucchi's erfolgreichster Roman.
Die Idee des Romans bekam Tabuki eines Tages in Lissabon, als er in der Zeitung las, dass ein alter portugiesischer Journalist gestorben sei. Er hatte ihn Jahre zuvor in Paris flüchtig kennengelernt, wo der Journalist im Exil lebte. In den 40er und 50er Jahren arbeitete er noch in Portugal. Nachdem es ihm gelungen war, einen kritischen Artikel über das Salazar-Regime zu veröffentlichen, musste er ins Exil gehen.
Erst 1974, als Portugal wieder demokratisch wurde, kehrte der Journalist zurück in seine Heimat, wo er im hohen Alter völlig in Vergessenheit geriet.
Antonio Tabucchi erwies dem verstorbenen Journalisten in einer Lissabonner Kirche die letzte Ehre. »Im September, wie ich bereits sagte, besuchte mich dann Pereira. Zuerst wusste ich nicht, was ich zu ihm sagen sollte. Aber dann begann ich zu ahnen, dass diese vage Erscheinung, die sich in Gestalt einer literarischen Person zeigte, ein Symbol und eine Metapher war.«
In ihr lebte in gewisser Weise der Geist des alten Journalisten weiter, dem ich die letzte Ehre erwiesen hatte. Ich war verlegen, empfing ihn jedoch mit Herzlichkeit. An diesem Septemberabend begann ich zu begreifen, dass eine Seele, die durch den Äther irrte, mich brauchte, um von sich zu erzählen, um von einer Entscheidung, einer Pein, einem Leben zu berichten. In
In jenem besonders günstigen Augenblick, der dem Schlaf vorausgeht und der für mich der geeignetste Zeitpunkt ist, um die Besuche meiner Personen zu empfangen, sagte ich zu ihm, »Er solle wiederkommen, er solle sich mir anvertrauen, er solle mir seine Geschichte erzählen.«
Perreira. Auf Portugiesisch bedeutet Perreira Birnbaum. Bei seinen nächtlichen Besuchen erzählte er mir, dass er Witwer, herzkrank und unglücklich sei. Dass er die französische Literatur liebe, vor allem die katholischen Schriftsteller der Zeit zwischen den Kriegen wie Mauriac und Bernanot.
dass er besessen sei von der Idee des Todes, dass sein engster Vertrauter ein Franziskaner namens Pater Antonio sei, zu dem er beichten ging, in der Angst, ein Ketzer zu sein, weil er nicht an die Auferstehung des Fleisches glaubte. Und Pereiras Geständnisse gemeinsam mit der Fantasie des Autors besorgten den Rest. Musik
Tabuki erfand einen Monat, der im Leben Pereiras eine entscheidende Rolle spielen sollte. Einen glühend heißen Monat, den August 1938. Europa steht kurz vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, während in Spanien der von General Franco entfesselte Bürgerkrieg gegen die rechtmäßige Regierung der Republik im Gange ist. Die Handlung spielt in Salazars Portugal.
Pereira ist ein Journalist mit langjähriger Erfahrung. Seit kurzem arbeitet er bei der Lisboa, einer neu gegründeten katholisch inspirierten Zeitung und ist für den Kulturteil verantwortlich.
Auf der Suche nach Ideen für den Aufbau dieser Seite liest Pereira in der sommerlichen Langeweile einen philosophischen Essay über den Tod von Francesco Monteiro Rossi, einem jungen italienisch-lusitanischen Absolventen der Universität Lissabon.
Beeindruckt von seinen Ideen nimmt Pereira Kontakt mit ihm auf, um ihm eine Zusammenarbeit vorzuschlagen. Er soll Nachrufe im Voraus schreiben, damit die Zeitung im Falle des Todes einiger großer Schriftsteller der damaligen Zeit darauf vorbereitet wäre.
Pereira sieht die Literatur als etwas, das nichts mit Politik, Gewalt und Krieg zu tun haben muss. Er liebt vor allem französische Autoren, pflegt und lebt ein eher geschlossenes und isoliertes Leben. Doch Monteiro Rossi, ein junger Diktaturgegner, schreibt mit seiner Freundin Marta subversive Nachrufe, die den Erwartungen Pereiras nicht entsprechen.
Pereira veröffentlicht die Artikel nicht, beschließt aber, Monteiro Rossi trotzdem zu bezahlen, wenn auch aus seiner eigenen Tasche. Die Bekanntschaft zwischen Pereira und Monteiro Rossi geht weiter. Sie sehen sich im Café Orqueja, wo Pereira gewohnheitsmäßig Kräuteromelettes und Limonade verziert, sprechen knapp am Telefon oder schicken sich Briefe ohne Absender. Auch Marta, Rossis schöne Verlobte, ist in die Beziehung involviert.
Sie verbirgt ihr politisches Engagement und ihre Wut über die Situation im Land nicht. Pereira pflegte seine Passivität als Mensch, der immer geglaubt hat, dass unpolitische Literatur das Wichtigste auf der Welt sei. Langsam fängt er aber an zu zweifeln. Was, wenn diese beiden jungen Menschen Recht haben?
Gequält von der Hitze und von körperlichen Beschwerden geht Pereira in eine Klinik, um abzunehmen. Dort trifft er Dr. Cardoso, einen Arzt, der Pereira von seinem Plan erzählt, nach Frankreich zu ziehen, einem Land, das für ihn die Freiheit symbolisiert. Als Pereira ihm offenbart, dass er in seinen Ansichten nicht mehr gefestigt ist, erklärt ihm der Arzt die Theorie vom Bündnis der Seelen.
Kennen Sie die Mézins-Philosoph? Nein, gestand Pereira. Ich kenne sie nicht. Wer sind sie? Die Bedeutendsten sind Theodule Ribot und Pierre Janais, sagte Dr. Cardoso. Dr. Ribot und Dr. Janais sehen die Persönlichkeit als ein Bündnis verschiedener Seelen. Denn wir tragen verschiedene Seelen in uns, nicht wahr? Als Bündnis, das der Herrschaft eines hegemonischen Ichs untersteht.
Was man als Norm oder als unser Sein oder als Normalität bezeichnet, ist nur das Resultat und nicht die Voraussetzung und wird von der Herrschaft eines hegemonischen Ichs bestimmt, das im Bündnis unserer Seelen die Führung übernommen hat.
Vielleicht, sagte Dr. Cardoso abschließend, gibt es ein hegemonisches Ich, das sich im Bündnis ihrer Seelen nach einer langsamen Erosion an die Spitze setzt, Dr. Pereira. Und sie können da gar nichts tun. Sie können es höchstens unterstützen.
Angetrieben von diesen Überlegungen beschließt Pereira nicht länger nur zuzusehen und Ärger aus dem Weg zu gehen, sondern Monteiro Rossi, der für ihn wie ein Sohn wird, nach Kräften zu helfen. Die Situation der beiden jungen Rebellen wird immer gefährlicher. Beide müssen untertauchen und verschwinden. Bis zu dem Tag, als Monteiro Rossi auf der Flucht Unterschlupf bei Pereira sucht.
Die Geheimpolizei findet und tötet ihn in der Wohnung von Pereira. Der Tod des jungen Mannes darf nicht umsonst gewesen sein, denkt Pereira. Es gelingt ihm, die Zensur zu umgehen, die Nachricht von der Ermordung Monteiro Rossis in seiner Zeitung zu veröffentlichen und so die Gewalt des Regimes öffentlich anzuprangern, bevor er mit einem gefälschten Pass Portugal verlässt.
Musik
Das Buch handelt in der Tat vom politischen Bewusstwerden des Protagonisten. Aber es konzentriert sich nicht nur auf diesen Aspekt. Es gibt noch andere. Ich würde sagen, dass es vor allem ein existenzieller Roman ist. Es ist die Geschichte eines gequälten Gewissens, einer Reue, wenn man so will, die schließlich das Leben des Protagonisten prägt. Er
Er befragt sich selbst über die Vergangenheit. Er verspürt das Bedürfnis zu bereuen, aber ohne zu wissen, was er bereut.
Im Zuge dieser Überprüfung, dieses Überdenkens einer ganzen Existenz und der daraus resultierenden Kränkungen und Qualen, entwickelt er schließlich auch ein politisches Bewusstsein. Aber das ist nur ein Aspekt der Innenansicht der Figur. Es gibt auch den Wunsch, eine andere Vergangenheit gelebt zu haben.
Es gibt die Infragestellung des Wertes und der Wirksamkeit der Literatur, ja sogar ihres eigentlichen Sinns durch jemanden, der fast symbiotisch mit ihr gelebt hat und sein Leben auf den Glauben an die Literatur gründet. Kurzum, es ist ein Roman, in dem es um viele Dinge geht und nicht nur um das politische Thema, obwohl ich es nicht für falsch halte, die Bedeutung des politischen Aspekts in einem Buch wie diesem anzuerkennen.
Am Ende des Romans erklärt Pereira steht, er hatte keine Zeit zu verlieren. Ich habe den Eindruck, dass Tabuki das auch dachte, dass es keine Zeit zu verlieren gibt, dass man es sich nicht leisten kann zu warten.
Der Schriftsteller Paolo Di Paolo. Wenn man etwas denkt, das vielleicht sogar gegen die Mehrheitsmeinung geht, muss man es sagen. Man kann sich auch irren. Ich denke, er war manchmal ein wenig zu hitzig bei bestimmten Themen. Aber ich verstehe, dass dieser Ton einen dazu zwingt, über etwas nachzudenken, dessen Widersprüche man sonst nicht wahrnehmen würde.
Dann kam hinzu, was die ganze Sache sozusagen noch dynamisiert hat, dass er eben ein sehr kämpferischer Polemiker war, der sehr viele Leute auch herausgefordert hat. Michael Krüger
In dieser Zeit war er einer der wenigen, die diese kämpferische Natur beibehalten hat. Was natürlich ganz im Gegensatz zu seiner portugiesischen Mentalität, die ja eher eine saudade, eine elegisch-melancholische ist,
Diese Seite hatte er auch. Aber wenn er dann einmal in seinem Furor war und sich irgendwie etwas vorgenommen hatte, um irgendeine Ungerechtigkeit darzustellen, dann hat er mächtig gekämpft. Eigentlich aber war er doch eher ein Melancholiker. Musik
Der Titel dieses Buches
Der Titel dieses Buches deutet auf eine Dringlichkeit hin und enthält auch ein Gefühl der Beunruhigung. Er verweist unmittelbar auf das Vergehen der Zeit, aber ein Vergehen der Zeit, das zu schnell ist. Antonio Tabucchi über sein Buch »Es wird immer später«.
Eine Aufzeichnung aus dem Jahr 2001. Diese Geschwindigkeit wirkt sich auch auf unsere individuelle Zeit aus. Sie vermittelt uns den Eindruck, dass alles schneller fließt. Irgendwie enthält der Titel diese Warnung.
Es gibt auch eine kommunikative Dringlichkeit, denn dies ist ein Roman, der aus Briefen besteht. Und wenn man jemandem etwas mitteilen will, ist die Dringlichkeit, dies zu tun, viel stärker zu spüren. Es gibt eine Chance, die verpasst werden könnte. Es gibt eine Chance, die verpasst werden könnte. Und vielleicht allude auch der Titel dazu.
Das Buch »Es wird immer später« ist ein außergewöhnlicher Briefroman, der aus Briefen von unterschiedlichen Absendern besteht, die auf keine Antwort warten.
Mal mit Zärtlichkeit, mal mit Sinnlichkeit, Sehnsucht, Bedauern, Groll, Grausamkeit oder Wahn verweben siebzehn männliche Figuren in siebzehn Briefen an ebenso viele weibliche Figuren die Fäden einer ungewöhnlichen Erzählung, die aus konzentrischen Kreisen besteht, die sich ins Nichts auszudehnen scheinen.
Es sind monologisierende Figuren, die vielleicht gierig nach einer Antwort suchen, die nie kommen kann. Es ist eine Reise durch die menschlichen Leidenschaften, bei der die Liebe der illusorische Mittelpunkt zu sein scheint, aber in Wirklichkeit ein Fluchtpunkt ist, der in die dunkelsten Bereiche der Seele führt.
Der Ausgangspunkt dieses Buches ist die Liebe, die Leidenschaft. Ein Gefühl, das sich aber vielleicht als Fluchtpunkt erweist, weil es in Wirklichkeit auch als Vorwand dient, um andere Bereiche der menschlichen Seele zu erforschen. Gefühle, die weit von der Liebe entfernt sind, die sich in der Liebe verändern.
Aber nur scheinbar, wie das Bedauern, die Sehnsucht, der Groll und sogar das Gefühl einer verlorenen Liebe. Auch die Zeit hat viel damit zu tun, denn in Wirklichkeit geht es oft um eine abgelaufene Liebe oder eine Liebe, die in Verzug ist. Die Zeitabläufe zweier Menschen gleiten parallel und treffen sich nicht.
Vielleicht haben diejenigen, die diese Geschichten erlebt haben, von denen die Absender in ihren Briefen erzählen, die Leidenschaft, an die sie sich erinnern, nicht mit dem richtigen Timing erlebt. Und so haben sie zueinander nicht gefunden. Sie haben sich im Labyrinth ihrer Existenzen verloren. Sie sind in den Labyrinthen ihrer Existenzen verloren.
Der Autor selbst nannte sein Buch, es wird immer später, ein Stimmenporträt. Weil jede Erzählung immer mündlich durch eine Stimme hervorgerufen wird. Die letzte Stimme in Tabukis Roman ist die Stimme einer Frau. Ihr Brief scheint wie die Antwort der abwesenden Geliebten zu sein.
Die abwesende Geliebte, ideale Empfängerin aller Liebesbriefe, schwebt in ihrer eigenen parallelen Welt, in ihrer eigenen Zeit und sucht Spuren ihres verlorenen Liebsten. Es ist die Stimme einer aus dem Rahmen des Mythos getretenen Ariadne, die auf Naxos nach Theseus sucht. Brief an den Wind. »Am späten Nachmittag bin ich auf dieser Insel an Land gegangen.«
Vom Fährboot aus sah ich, wie der kleine Hafen immer näher kam, mit dem weißen Städtchen unterhalb der venezianischen Festung. Und ich dachte, vielleicht ist es hier. Und während ich die Stufen in den Gässchen hinaufstieg, auf denen man bis zum Turm gelangt, mit meinem Gepäck, das jeden Tag leichter wird, sagte ich bei jeder Stufe aufs Neue zu mir, vielleicht ist es hier.
Auf dem kleinen Platz unterhalb der Festung, einer Art Terrasse, von wo aus man auf den Hafen blickt, gibt es ein einfaches Restaurant mit alten Eisentischen entlang einer Mauer, zwei Blumenbeeten mit zwei Olivenbäumen und feuerroten Geranien in viereckigen Blumenkisten. Die Nacht senkte sich herab.
Eine transparente Nacht, die das Kobaltblau des Himmels in leuchtendes Violett verwandelte. Und dann die Dunkelheit, wo nur noch Indigo übrig blieb. Über dem Meer leuchteten die Lichter der Dörfer von Paros und es hatte den Anschein, als wären sie nur ein paar Schritte entfernt. Ich habe dich gesucht, mein Liebling, in jedem deiner Atome, die sich im Universum zerstreut haben.
Ich habe so viele gesammelt wie möglich. Am Boden, in der Luft, im Meer, in den Blicken und Gesten der Menschen. Ich habe dich sogar in den Kuri gesucht, im fernen Gebirge einer dieser Inseln, nur weil du mir einmal erzählt hast, dass du dich einem Kuros auf den Schoß gesetzt hast.
Das Meer war unendlich weit. Und so suchte ich dich im Geiste im Funkeln dieses Meeres, weil du es gesehen hattest und in den Augen des Kurzwarenhändlers, des Apothekers, des Alten, der auf diesem kleinen Platz Eiskaffee verkaufte, weil sie dich gesehen hatten. Auch diese Dinge habe ich in die Tasche gesteckt, in diese Tasche, die ich selbst und meine Augen ist. Ich weiß nicht, ob du mir deinen Samen eingepflanzt hast oder umgekehrt.
Aber nein, kein Same von uns ist je aufgeblüht. Jeder ist allein, ohne die Vermittlung zukünftigen Fleisches und ich vor allem ohne jemanden, der meine Angst einsammeln wird. Ich habe alle diese Inseln befahren und auf allen habe ich dich gesucht. Und das ist die Letzte, so wie ich die Letzte bin. Nach mir ist Schluss. Wer könnte dich noch suchen, wenn nicht ich?«
Antonio Tabuchi gehört heute zu den Persönlichkeiten unserer Vergangenheit, denen wir gerne viele Fragen stellen möchten. Wenn wir uns vorstellten, Antonio Tabuchi heute zu begegnen und ihm Fragen zu stellen, würden seine Antworten aus ebenso vielen Fragen bestehen, die uns Zweifel offenbaren würden, die Unruhe der Existenz und eine Warnung.
Es wird immer später. Tabuki starb am 25. März 2012 im Alter von 68 Jahren im Hospital da Cruz Vecmelia in Lissabon nach einem kurzen Kampf gegen den Krebs. Seine Asche wurde im Cemeterio do Sprescherich in der Kapelle des Escritores Portugueses beigesetzt. Das Leben ist eine Musikpartitur.
die wir spielen, ohne die Musik zu kennen, sagte Tabuki. Man versteht sie erst im Nachhinein, wenn die Musik bereits zu Ende ist.
Ich laufe gerne mit meinem kleinen Notizbuch in der Tasche herum und halte eine Idee fest. Oder schreibe eine ganze Seite, wenn sie auftaucht. Denn man weiß nie, wann eine Seite kommt. Schließlich ist das Schreiben ein Privileg.
Alles, was man braucht, ist ein Stift in der Brusttasche und ein Notizbuch in der Tasche. Und von diesem Privileg mache ich Gebrauch, weil ich gerne die Stimmen der Menschen und das Leben um mich herum höre. Auch weil das Schreiben merkwürdig ist. Es ruft etwas ins Leben, aber gleichzeitig bestimmt es auch dessen Tod.
Und das missfällt dem Autor ein wenig. Man möchte das Ende der Geschichte oder das Schicksal ändern, das wir bestimmten Figuren zugedacht haben und ihnen sagen, ich schreibe dir jetzt ein anderes Buch. Du wirst ein anderes Schicksal haben. Und vielleicht kann man das mit der Literatur auch machen. Musik
Es wird immer später. Eine lange Nacht über Antonio Tabuchi von Christiana Coletti. Es sprachen Gabriele Blum, Axel Gottschick, Doris Plehnert, Simon Roden. Übersetzung der Werke von Tabuchi Karin Fleischanderl.
Übersetzung der O-Töne und der gedruckten Interviews Christiana Coletti. Ton und Technik Christoph Rieseberg und Thomas Wittig. Regie die Autorin. Redaktion Hans-Dieter Heimendahl. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über Formen der Familie, die längst nicht mehr nur dem heiligen Vorbildvolk mit Mutter, Vater, Kind, sondern viele Ausprägungen gefunden hat.
Als Patchwork, als Mosaik, mit nur einem Elternteil oder auch mit dreien. Seien Sie gespannt auf einen Blick zurück in die Geschichte der Familie, in andere, auch matrilineare Kulturen und in unsere vielfältige Gegenwart. Sie können alle Lange Nächte der letzten Monate auch in der Deutschlandfunk-App nachhören. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche.
