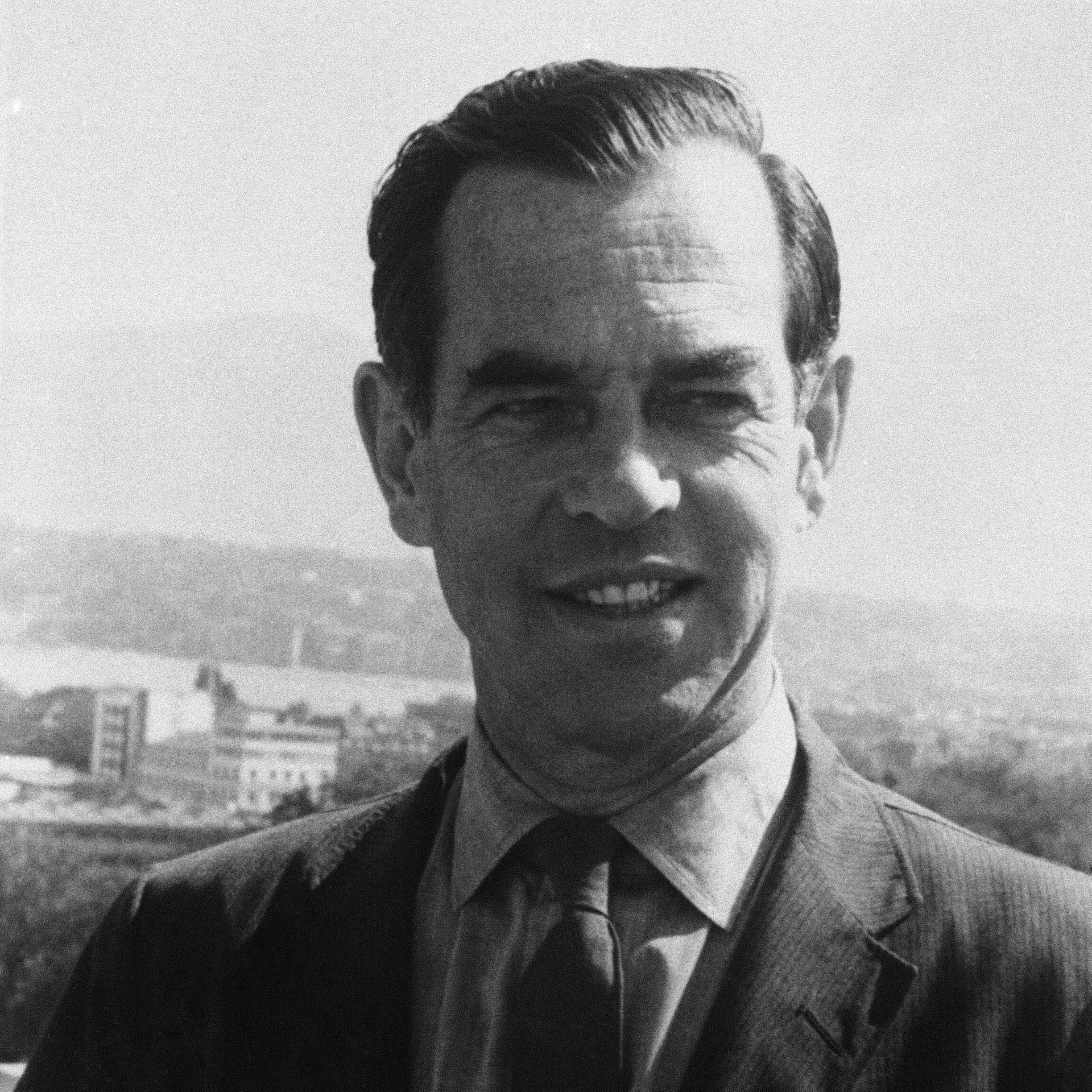
Shownotes Transcript
Was interessiert uns, wenn wir ins Kino gehen oder wenn wir ein Buch aufschlagen? Was für Geschichten sprechen uns an? Nun, eine Formel, die für jeden zu jeder Zeit gelten würde, gibt es sicher nicht. Aber eine These kann man schon aufstellen. Wir interessieren uns für Heldengeschichten.
Es stehen nämlich nicht nur am Anfang des Interesses von Jungen an, Büchern oder Kino, Helden wie Ernie, Harry Potter oder Justus Jonas, Robin Hood, Old Shatterhand oder Luke Skywalker. Auch bei den Mädchen ist das so. Denn es geht gar nicht primär darum, dass Heldinnen oder Helden Taten vollbringen, die gleich die ganze Menschheit retten. Es geht darum, dass wir uns als Lesende bewegen.
Oder im Kino, in dem Wohl und Wehe im Text und auf der Leinwand spiegeln. Dass wir uns hineinversetzen und mitleiden bei großem Unglück und großen Krisen, bei großen Gefahren und Herausforderungen und eben auch bei großen Erfolgen, bei wichtigen Erfahrungen oder bedeutenden Erkenntnissen. Schließlich sind ja auch Märchen Heldinnen- oder Heldengeschichten.
Die enge Verbindung zwischen den Geschichten, Sagen, Ursprungserzählungen in der Kultur und unseren persönlichen Sehnsüchten und Träumen gesehen und ihr nachgegangen zu sein, das scheint mir das große Verdienst des Mythenforschers Joseph Campbell. Und er hat damit einen Nerv getroffen. Das Muster der Heldenreise, das er beschreibt, hat Hollywood-Regisseure ebenso beeinflusst, George Lucas etwa für den Krieg der Sterne,
Wie es heute noch Therapeutinnen und Therapeuten als Hilfsmittel dient, um die Folgen von Krisen und Herausforderungen im Leben ihrer Klienten, in ihrem oder meinem Leben also, aufzunehmen und anzusprechen. Denn manches erscheint in einem neuen Licht, wenn man sich vor Augen führt, dass wir auf einer Heldinnen- oder Heldenreise sind.
Seien Sie gespannt auf die Entdeckung der Hellenreise und die Lange Nacht über den Mythenforscher Joseph Campbell von Sabine Fringes. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl. Ich bin der Redakteur der Lange Nacht. Sie erreichen mich wie immer unter langenacht.de. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine ganz konkrete Reise, nämlich die nach Bad Kissingen.
Lernen Sie eine Stadt in Franken und Ihre Geschichte kennen und seien Sie gespannt auf eines der ältesten Bäder Deutschlands, in dem mitentwickelt wurde, was sich als Kuraufenthalt in ganz Europa etabliert hat. Sie können alle langen Nächte der letzten Monate auch in der Deutschlandfunk-App nachhören. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche. Was hält die Welt im Innersten zusammen?
Andra moi enne per Musa, polytropon, hos mala pola, plankte, epe troies hierompto lietron eparse. Polon dantropon idem astea kainoon egno, pola dogen pontu, paten algea hon katatumon, arnumenos hente psycheen kainoston hetairon.
Was erzählen uns die Mythen vom Leben? Er hat den Abgrund gesehen, den Grund aller Dinge.
Er hat die Tiefe darin gesehen, den Urgrund der Erde und den Umkreis der Länder auf ihr. Ans Ende der Welt ist er gegangen und weiter und sah das Meer, das uns umschließt. Von den Gestalten zu künden, die einst sich verwandelt in neue Körper, so treibt mich der Geist.
Ihr Götter, da ihr sie gewandelt, fördert mein Werk und lasset mein Lied in dauerndem Flusse von dem Beginne der Welt bis auf meine Zeiten gelangen. Odyssey, Gilgamesch, Metamorphosen. Welche Gemeinsamkeit haben Mythen quer durch alle Zeiten und Kulturen? Dieser Frage ging Joseph Campbell nach, als er sich Mitte der 40er Jahre an das Schreiben seiner Studie machte.
Das Muster, auf das er stieß, nannte er Monomythos. Später wurde es unter dem Begriff Heldenreise populär. Musik
Normalerweise betrachten wir die Welt ja durch den Filter unserer eigenen Persönlichkeit, unserer eigenen Kultur, unserer eigenen persönlichen nationalen Firmeninteressen und so weiter. Und diese Sichtweise der Mythen, wie Campbell sie darstellt, die bedeutet letztendlich, diese Filter loszulassen und die Brille abzunehmen.
Joseph Campbells Heldenreise, unabhängig davon, wie man das jetzt wissenschaftlich einschätzen möchte, ist einfach eine großartige Geschichte und ein wunderbares Format, eine wunderbare Struktur, mit der sich eben ganz viel in unterschiedlichen Kontexten unserer gegenwärtigen Gesellschaft anfangen lässt. Im Film, in der Literatur, in der Therapie. Für mich ist die Heldenreise mittlerweile ein elementarer Bestandteil meines Lebens geworden.
Ich weiß, ich befinde mich in einer Heldenreise, in der nächsten Heldenreise, an mehreren Heldenreisen gleichzeitig.
Dieses dicke Buch ist erstaunlicherweise bis heute ein Muster, mit dem man klassische Filme des Hollywood-Kinos erzählen kann. Und wenn man im Wissen um Joseph Campbells Modell mal den ersten gedrehten Teil von Star Wars anschaut, also Star Wars, dann ist es fast witzig zu beobachten, dass die Stationen, die Joseph Campbell beschreibt, tatsächlich in Star Wars zu finden sind. Musik
Martin Weyers, Stefanie Gripen-Trogschädel, Michaela Krützen und Michael Dahl. Ein bildender Künstler, eine Religions-, eine Medienwissenschaftlerin und ein Coach. Sie haben sich intensiv mit Joseph Campbells Heldenstudie beschäftigt. Ein Mammutunternehmen, für das Campbell Hunderte von Mythen, Märchen und Träumen aus aller Herren Länder studierte.
Dieses Buch auch nur einmal zu lesen, wird unbegrenzte Unterhaltung bieten. Es zweimal oder besser noch ein Dutzendmal zu lesen, wäre das Äquivalent einer universellen Ausbildung. Der Schriftsteller Henry Morton Robinson bei Erscheinen des Buchs im Jahr 1949. Niemand schreibt oder denkt wie Joseph Campbell. Mit der Heros in tausend Gestalten vollbringt er zwei fast unglaubliche Leistungen.
Er verbindet Mythologie, Psychoanalyse, Poesie und Gelehrsamkeit zu einer fesselnden Erzählung. Dann, als ob das nicht genug wäre, überzeugt er den nachdenklichen Leser, dass Mythos und Traum, diese flüchtigen und vernachlässigten Unwirklichkeiten, die mächtigsten Kräfte im Leben der Menschen sind.
Doch es gab nicht nur begeisterte Stimmen. Viele Kritiker stießen sich an den von C.G. Jung und Sigmund Freud inspirierten Interpretationen und empfanden das Werk als vage und undeutlich. Erst im Laufe der 60er Jahre entwickelte sich The Hero with a Thousand Faces zu einer Art Bibel einer ganzen Generation. Don't start crushing me
Es war die Ära der inneren Entdeckung während der LSD-Phase. Plötzlich wurde der Heros in tausend Gestalten zu einer Art Triptychon für die Reise nach innen. Die Menschen fanden in diesem Buch etwas, das ihnen half, ihre eigenen Erfahrungen zu interpretieren.
Jeder, der sich auf eine Reise begibt, sei es nach innen oder nach außen, begibt sich auf eine Reise, die in den Mythen der Menschheit viele Male beschrieben wurde. Und ich habe sie einfach alle in diesem Buch zusammengefügt. Musik
Künstler wie Bob Dylan, Jim Morrison, die Rockband Grateful Dead, George Lucas, Stanley Kubrick und Steven Spielberg ließen sich von Campbells Heros in tausend Gestalten inspirieren. Bis heute taucht es auf Listen der besten Sachbücher auf. Das Time Magazine zählte es 2011 zu den wichtigsten 100 Büchern in englischer Sprache.
Ein Millionenpublikum erreichte Joseph Campbell durch eine Fernsehreihe mit Interviews, die Bill Moyers in den 80er Jahren mit ihm geführt hat. Auf der Luke Skywalker Ranch von George Lucas. Warum der Heros in tausend Gestalten?
Weil es eine typische Abfolge von Heldenhandlungen gibt, die in Geschichten aus aller Welt zu allen Zeiten zu finden ist. Es geht quasi um die eine Tat, eine Tat, die von vielen verschiedenen Menschen vollbracht wird.
Warum gibt es in der Mythologie so viele Geschichten über Helden? Weil es das ist, worüber es sich zu schreiben lohnt.
Sogar in populären Romanen ist die Hauptfigur der Held oder die Heldin. Also jemand, der etwas gefunden oder erreicht oder getan hat, was über den normalen Bereich von Leistung und Erfahrung hinausgeht. Ein Held ist jemand, der sein Leben einer Sache gewidmet hat, die größer oder anders ist als er selbst. So in all of these cultures...
In all diesen Kulturen, gleich wie sie aussehen, worin besteht die Tat? Es gibt zwei Arten von Taten. Die eine ist die physische, eine Kriegshandlung oder das Retten eines Lebens. Das ist eine Heldentat. Sich selbst hinzugeben, sich für einen anderen zu opfern.
Und das andere ist der spirituelle Held, der den übersinnlichen Bereich des spirituellen Lebens erfahren hat und dann zurückkommt, um es zu teilen. Der Heldenzyklus ist ein Zyklus von Aufbruch und Rückkehr. Aber das lässt sich auch im einfachen Initiationsritus erkennen, wo ein Mensch seine kindliche Persönlichkeit und Psyche sterben lassen muss, um als selbstverantwortlicher Erwachsener zurückzukommen.
Das ist eine grundlegende Erfahrung, die jeder Mensch machen muss. Aus dieser Abhängigkeit in eine Selbstverantwortung zu gelangen, erfordert einen Tod und eine Auferstehung. Und das ist das Grundmotiv der Heldenreise. Die Quelle des Lebens zu finden, die einen reiferen Zustand hervorbringt. So that if
Wenn wir also keine Helden im großen Sinne der Befreiung einer ganzen Gesellschaft sind, müssen wir diese Reise selbst antreten? Das ist richtig. Und Otto Rank in seinem wunderschönen, sehr kurzen Buch,
Otto Rank schreibt in seinem wunderbaren Buch mit dem Titel Der Mythos von der Geburt des Helden, dass jeder von Geburt an ein Held ist. Er hat eine enorme Verwandlung durchgemacht. Von einem kleinen Fruchtwasserwesen zum luftatmenden, selbstständigen Säugetier.
Das ist eine enorme Verwandlung und heldenhafte Tat. Und es ist auch heldenhaft von Seiten der Mutter. Sie ist der primäre Held, die Heldenform, könnte man sagen. Musik
Joseph Campbell wurde 1904 in White Plains, New York City, als erstes von vier Kindern in eine römisch-katholische Familie hineingeboren. Mit sieben nahm ihn sein Vater, der mit seinem Strumpfhosenhandel einen gewissen Wohlstand erlangt hatte, mit zu den Buffalo Bills Wild West Shows im Madison Square Garden. Doch Joe, wie er genannt wurde, interessierte sich nicht für die Cowboys. Er war ... Fasziniert und ergriffen.
vom Indianer mit dem wissenden Blick, mit dem Ohr am Boden lauschend, Pfeil und Bogen in der Hand. Mein Vater war sehr großzügig und half mir bei der Suche nach Büchern über die amerikanischen Indianer. George Burt Grinnells Bücher, Indian Lodge Tales, die Berichte des American Bureau of Ethnology und so weiter. Und so wurde ich schließlich eine Art kleiner, wandelnder Wissenschaftler auf dem Gebiet der amerikanischen Indianer.
In der Zwischenzeit wurde ich von Nonnen in der römisch-katholischen Religion unterrichtet und es dauerte nicht lange, bis ich erkannte, dass es in beiden mythologischen Systemen jungfräuliche Geburten, Tode und Auferstehungen gab. Ich interessierte mich also schon sehr früh für diese Vergleiche und mit zwölf war ich schon recht gut in der Materie drin. In meinen Studienjahren habe ich mich dann auf die Literatur des Mittelalters spezialisiert und ergänzend dazu natürlich auch auf die klassischen Mythologien.
Auch hier fand ich die Bilder der christlichen Tradition, aber aus einem universellen Blickwinkel heraus. Nach seinem Abschluss an der Columbia University führte Campbell ein Stipendium für Altfranzösisch und Sanskrit nach Europa, an die Universitäten von Paris und München. Er entdeckt Nietzsche und Schopenhauer, Thomas Mann und James Joyce und in den Werken von Sigmund Freud und Carl Gustav Jung einen Schlüssel zur Interpretation von Mythen.
In seinem »Heros in tausend Gestalten« spricht Joseph Campbell jedoch noch nicht von der Heldenreise, sondern er nennt das Muster den Monomythos. Der Monomythos, und das ist eben eine ganz interessante Theorie, die Joseph Campbell da verfolgt. Und er ist da nicht der Erste im Übrigen und auch nicht der Einzige gewesen, aber eben für seine Arbeit war es dann grundlegend und er hat diesen Begriff auch geprägt.
Und der Monomythos ist sozusagen ein und dieselbe Geschichte, die immer wiederkehrt an unterschiedlichsten Orten, in unterschiedlichen Kontexten, in jeweils unterschiedlicher Einkleidung, wenn man so will. Aber das kulturell Spezifische ist immer nur die Einkleidung. Und letzten Endes ist es ein im Wesen immer gleicher Kern. Es ist die gleiche Struktur, die wir Menschen uns da erzählen.
Und das Besondere vielleicht an Joseph Campbell ist, dass er das zugleich verbindet mit der Psychoanalyse. Also ganz stark hat er sich beschäftigt auch mit der Psychoanalyse von Carl Gustav Jung und der Theorie vom kollektiven Unbewussten. Und er schließt da eigentlich direkt an und sagt, letzten Endes diese Struktur, die wir da vorfinden, die im Monomythos erzählt wird, die ist letzten Endes eine Struktur in der menschlichen Psyche.
Und das macht es so besonders und zugleich sehr ähnlich dem, was eben auch Carl Gustav Jung beschrieben hat für diesen Begriff des kollektiven Unbewussten.
Die Religionswissenschaftlerin lehrt an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Und dieses kollektive Unbewusste wird aber durch bestimmte Strukturen bestimmt, die sogenannten Archetypen, so nennt Carl Gustav Jung das. Und Joseph Campbell schließt daran an und sagt jetzt eben, der Held, die Heldenfigur ist ein solcher Archetypus.
Und es sind natürlich nur Namen, die wir diesen Strukturen geben. Also auch C.G. Jung hat gesagt, letztlich entziehen sie sich der Beschreibung. Aber wir können Rückschlüsse auf diese Strukturen im kollektiven Unbewussten ziehen.
Eben indem wir Märchen, Erzählungen, eben religiöse Mythen, auch Träume, die wir haben und so weiter, also verschiedene Formen von Geschichten, auf die wir empirisch auch zugreifen können, wenn wir die beginnen zu vergleichen, werden wir auch da wiederkehrende Strukturen finden.
Und die entsprechen diesen archetypischen Strukturen in der menschlichen Psyche und können uns dann auch helfen, die zu verstehen. Das ist dann die therapeutische Relevanz auch dabei. Der Mythos verhält sich zum Traum wie die tieferen Zonen des Meeres zu den Untiefen. Im Mythos wie im Traum ist es das Geheimnis der inneren Welt, das zu uns kommt. Aus Tiefen, die zu bedrohlich scheinen, um leicht erkannt zu werden.
Dieses Atlantis der inneren Wirklichkeiten ist uns so fremd wie ein unbekannter Kontinent. Seine Geheimnisse wollen erforscht werden. Ich wusste nicht, wo ich war, aber es machte mir Spaß, die Gegend zu erkunden. Ich ging in eine Straße, die furchtbar schmutzig war und über einen offenen Abwasserkanal führte.
Ich ging weiter zwischen Reihen von Baracken und entdeckte schließlich einen kleinen Fluss, der zwischen mir und einem höher gelegenen Terrain verlief, auf dem es eine gepflasterte Straße gab. Es war ein klarer Fluss, der über Gras floss. Ich konnte sehen, wie das Gras sich unter Wasser bewegte. Es gab keine Brücke und so ging ich zu einem kleinen Haus und fragte nach einem Boot.
Ein Mann dort sagte mir, er könne mir selbstverständlich helfen, hinüber zu gelangen. Er holte eine kleine Kiste und legte sie ans Flussufer. Und ich erkannte sogleich, dass ich mit dieser Kiste leicht hinüberspringen konnte. Ich wusste, dass alle Gefahr vorüber war und wollte den Mann reich belohnen.
Wenn ich an diesen Traum denke, habe ich das deutliche Gefühl, dass ich keineswegs an diese Stelle hätte gehen müssen, sondern auch einen bequemen Weg über gepflasterte Straßen hätte nehmen können. Ich war durch das heruntergekommene, schmutzige Viertel gegangen, weil ich das Abenteuer liebte. Und als ich erst einmal begonnen hatte, musste ich weitergehen.
Eine große Quellensammlung von Mythen und Märchen und religiösen Erzählungen aus aller Welt liegt Campbells Heldenstudie zugrunde. Auch Sammlungen von Träumen gehören dazu, worin er auch den einer Opernsängerin wiederfand. Campbell erkannte in diesem Traum die Grundlinien der universellen Mythenformel des Heldenabenteuers bis ins Detail wieder.
Zuerst die Überquerung des Abwasserkanals, dann der vollkommen klare, über grasigen Grund strömende Fluss. Im kritischen Augenblick das Erscheinen des bereitwilligen Helfers und der hochgelegene, sichere Grund vor dem letzten Strom. Das irdische Paradies, das Land jenseits des Jordans. Das sind die ewigen und immer wiederkehrenden Themen des wunderbaren Lieds »Vom großen Abenteuer der Seele«.
Über das Wasser hilft der Träumenden in unserem Beispiel eine kleine hölzerne Kiste, die in diesem Traum an die Stelle der üblicheren Barke oder Brücke tritt. Sie steht für ihre besonderen eigenen Talente und Fähigkeiten, die ihr über die Wasser der Welt geholfen haben. Die Träumende berichtet uns nichts über ihre Assoziationen, sodass wir nicht wissen, was sich denn genau in der Kiste befunden haben mag.
Doch es handelt sich mit Sicherheit um eine Abwandlung der Büchse der Pandora, jenes Geschenks der Götter an schöne Frauen, gefüllt mit den Keimen für alle Probleme und Segnungen des Daseins, aber auch mit der stärkenden Kraft und Hoffnung.
Dank dieser Hilfe gelangt die Träumende ans andere Ufer. Und dank eines ähnlichen Wunders wird auch jeder, der sich an die schwierige und gefahrvolle Aufgabe der Selbstentdeckung und Selbstentwicklung macht, über den Ozean des Lebens getragen werden. Solange du lebst, leuchte. Traure über nichts zu viel.
Eine kurze Frist nur bleibt zum Leben. Das Ende bringt die Zeit von selbst. Das älteste vollständig erhaltene Musikstück der Welt ist das Seikilos-Lied aus dem 2. Jahrhundert nach Christus.
eingemeißelt in eine Marmorstähle in Traleis in Kleinasien, wehen heute noch seine Klänge zu uns herüber. Der Tod ist das große Mysterium, aus dem alle Mythen hervorgehen. Schau, die Zinnen des Stadtwalls glänzen wie Kupfer. Pfeiler, wie sie kein anderer so zu bauen vermocht hätte.
Steig über die Stufen einer lang vergangenen Zeit hoch zum Eana, dem Sitz der Göttin Ischda. Ein Bauwerk, das kein König nach ihm so zu bauen verstand. Kletter hoch zum Wehrgang, geh die Brustwehr entlang, klopf die Fundamente ab und prüf das Mauerwerk. Was ist ein Mythos, ist eine große Frage. Und zwar natürlich vor allem auch für mein Fach, die Religionswissenschaft.
Und es gibt eben eine ganz große Vielzahl an unterschiedlichen Mythen-Theorien. Ich würde jetzt einmal zwei vorschlagen. Die eine ist relativ...
Einfach und eingängig nämlich zu sagen, ein Mythos, das ist der einer Gruppe vorgegebene Fundus an Bildern und Geschichten. Also es hat etwas mit Gruppenbildung zu tun und ein Mythos, eine mythologische Erzählung hat eine bestimmte Funktion für eine Gruppe. Das ist so ganz klassisch in der Geschichte der Religionswissenschaft eine Weise gewesen, den Mythosbegriff zu definieren.
Ein sehr alter Begriff von Mythos stammt zum Beispiel von einem spätantiken römischen Philosophen, dem Salustius. Der hat einen sehr schönen Satz gesagt, den ich sehr bedenkenswert finde. Der hat gesagt, der Mythos ist, was niemals war und immer ist.
Das spricht schon so ein bisschen das auch an, was ja dann auch Joseph Campbell gesagt hat. Wir haben einerseits natürlich bei mythologischen Erzählungen, zumindest wir, die wir das heutzutage auch reflektieren und kritisch, rational auch auseinandernehmen, ja nicht die Auffassung, dass es sich bei mythologischen Erzählungen um wahre Erzählungen handelt, die irgendwann stattgefunden haben.
sondern das hat eben nie wirklich stattgefunden und trotzdem ist es immer da. Also es ist sozusagen eine Struktur, die eben immer, immer wiederkehrt. Also das haben einige Mythos-Theorien gemeinsam, diesen Blick auf den Mythos. Was ist das, was wir hier sehen?
3600 Morgen sind Häuser, 3600 die Palmgärten, 3600 die Lehmgruben und halb so viel ist das Tempel. 10.800 und 1.800 Morgen Land umfasst die Stadt Uruk. 5000 Jahre alt ist die Geschichte über Gilgamesch, den Herrscher der mächtigen Stadt Uruk, und gilt als das älteste Epos.
Gilgamesch, von der rastlosen Suche nach Macht und Unsterblichkeit getrieben, zieht in einen alten Zedernwald, um dort tausende Bäume für die Errichtung einer mächtigen Stadtmauer zu fällen. An seiner Seite Enkidu, ein behaartes Naturwesen, aus der Wildnis der Steppe kommend. Gemeinsam gelingt es ihnen, Khumbaba, den Wächter des Waldes, zu besiegen. Doch den Tod besiegen sie nicht. Als Enkidu stirbt, ist Gilgamesch außer sich vor Verzweiflung.
Und frag den Geistesverstorbenen. Rede, mein Freund, rede. Das Gesetz der Erde, die du sahst, verkünde mir jetzt. Ich kann es dir nicht sagen, Freund, ich kann es dir nicht sagen. Künde ich dir das Gesetz der Erde, die ich schaute, so wirst du dich hinsetzen und weinen.
»Die uralten Mythen haben mit tiefen inneren Problemen des Menschseins zu tun, mit den Mysterien des Lebens, mit inneren Schwellen, die wir bei Übergängen im Leben, wie Geburt, Adoleszenz, Pubertät, Ehe, Vater, Mutterschaft, Wechseljahre, Alter, Krankheit, Tod, überqueren und durchlaufen müssen. Wer die Zeichen nicht kennt, der muss sich allein zurechtfinden.«
Aber wenn ein Mythos gleich welcher Tradition dich ergreift, dann wird das eigene Leben dadurch inspiriert und belebt. Und die Mythen werden zu Wegweisern. Wenn der Held startet zu seiner Heldenreise, ist er natürlich zunächst einmal von einer gewissen Naivität geprägt und er stößt auf lauter Hindernisse in Form von Verletzungen.
Dämonen oder anderen Widersachern, denen er vielleicht auch nicht immer auf die rechte Weise begegnet. Wir kennen die Geschichte von Odysseus, wie er kämpft, auch nicht immer fair oder auf eine besonders vorbildliche Weise. Das heißt, der Held muss auch reifen und in dem Moment, in dem er eine gewisse Stufe überwunden hat und vielleicht auf eine klügere und
einvernehmlichere Weise diesen Herausforderungen begegnet, können die dann auch gnädig gestimmt werden und werden dann zu Unterstützern seiner Heldenreise. Deshalb können sich die Torwärter, die es erstmal gibt, es gibt zum Beispiel auch bei Gilgamesch diese Situation, wo ihm die Göttin Ischta begegnet und ihn erstmal abzuhalten versucht, von seinem weiteren Vordringen in die Unterwelt abzuhalten.
Dieses Phänomen, das gibt es überall im Leben, dass jemand, der dann uns begegnet, uns erstmal abzuwehren versucht und dann durch kluges Verhalten aber eher in einen Unterstützer verwandelt wird, was Gilgamesch dann auch gelingt, indem er diese Göttin überzeugt von der Ernsthaftigkeit seines Vorgehens. Und dazu gibt es immer wieder Herausforderungen und die werden letztendlich als Prüfungen begriffen und indem man dann nicht zurückschreckt und sagt,
sich sozusagen zurückzieht, sondern seinen Weg weitermacht, aber vielleicht auch nicht gewaltsam vorgeht, sondern sich zu arrangieren versucht, versucht mit diesen Kräften umzugehen auf eine kooperative Weise oder sich dienlich zu machen, vielleicht auch den Zugang etwas zu verändern und Dinge einzubeziehen, die man vorher abgewährt hat. Dadurch kann man Dinge integrieren.
Und plötzlich geht es irgendwo weiter und dann eröffnet sich wieder ein Weg, der vorher nicht da war. Martin Weyers ist bildender Künstler und organisiert Symposien im Bereich von Symbol- und Mythenforschung.
Rund 20 Jahre lang hat er auch für die Joseph Campbell Foundation gearbeitet. Campbells Buch begleitet ihn seit bald 25 Jahren. Und immer wenn ich es lese, kommen mir neue Ideen und manchmal bin ich erstaunt über das, was ich vor 20 Jahren geschrieben habe, aber vieles vertraut, also es ist eine ewige Beschäftigung damit. Und ich habe damals einmal, als ich einen Vortrag erhalten darüber, da kam einer, der auch fürs Fernsehen irgendwelche Sendungen gemacht hat und der hat gesagt, eigentlich
Ah ja, Heldenreise kenne ich, habe ich mal ein Seminar darüber gemacht. Da muss ich mal dran denken, muss ich natürlich auch schwunzeln, aber nee, ist halt endlos, diese Beschäftigung. Hier kommt der Monomythos, die Geschichte der Reise des Helden, so wie Joseph Campbell sie in tausend Gestalten fand. Der mythologische Held verlässt sein gewohntes Haus oder Schloss und gelangt,
Aus eigenem Antrieb oder gelockt oder dorthin getragen, zur Schwelle der Abenteuerfahrt. Dort stößt er auf ein schattenhaftes Wesen, das den Durchgang bewacht. Der Held besiegt oder besänftigt diese Macht und betritt lebendig das Reich der Finsternis oder wird von seinem Gegner getötet und steigt hinab ins Totenreich.
Jenseits der Schwelle durchquert der Held eine Welt unbekannter, aber seltsam vertrauter Kräfte, von denen einige ihn heftig bedrohen, während andere ihm magische Hilfe gewähren. Wenn er auf dem Gipfelpunkt der mythischen Reise ankommt, unterzieht er sich einer letzten Feuerprobe und verdient sich seinen Lohn.
Der Sieg kann dargestellt werden als sexuelle Vereinigung mit der Muttergöttin der Welt, als Anerkennung durch den Schöpfervater, als seine eigene Vergöttlichung oder, falls Mächte ihm weiterhin feindlich gesinnt bleiben, als Diebstahl oder Raub der Gunst oder Gabe, deretwegen er dorthin gekommen war. Seinem Wesen nach handelt es sich hier um eine Erweiterung des Bewusstseins und damit des Seins. Die letzte Tat ist die Heimkehr.
Haben die Mächte dem Helden ihren Segen gegeben, setzt er sein Abenteuer unter ihrem Schutz fort. Andernfalls flieht er und wird verfolgt. An der Rückkehrschwelle müssen die transzendenten Mächte zurückbleiben. Der Held kehrt aus dem Reich des Grauens zurück. Die Gabe, die er mitbringt, stellt die Welt wieder her. Musik
Joseph Campbell teilt die Heldenreise auf in drei Phasen. Aufbruch, Initiation und Rückkehr. Jede Phase wiederum besteht aus rund sechs Etappen. Wobei, wie Campbell ergänzt, die meisten Geschichten nur ein paar Elemente daraus wählen, während andere mehrere zu einer Folge zusammenfassen, wie etwa die Odyssee. Doch die drei Phasen, Aufbruch, Initiation und Rückkehr, sind für jede Heldenreise obligatorisch.
Auch wenn Campbell meist nur allgemein von dem Helden spricht, meint er doch die Frau immer mit. Der Unterschied zwischen Männern und Frauen, das ist eine sehr wichtige und kontrovers diskutierte Frage. Joseph Campbell selbst hat schon geschrieben, dass das natürlich gleichermaßen gilt, also dieses Format der Heldenreise, diese Erzählung für Frauen ist.
Und trotzdem ist ihm dann auch in der weiteren Diskussion, auch in der Forschungsdiskussion, das immer wieder zum Vorwurf gemacht worden, dass das viel zu Männer zentriert wäre, rein schon von der Wortwahl her, dass er immer vom Helden spricht.
Und dann hat es aber eben andere gegeben, die versucht haben, ganz explizit, also zum Beispiel Maureen Murdoch ist eine, die hat dann ein Buch publiziert, 1990, The Heroine's Journey, also wo sie bewusst nochmal das auf die Frau anwendet, diese Geschichte oder das Weibliche nochmal stärker macht, aber das durchaus eben in einer kritischen Form.
Reaktion auf Joseph Campbell. Das war ein zentraler Kritikpunkt an seiner Arbeit. Die Mythen handeln natürlich vielfach von männlichen Helden, weil sie aus solchen Gesellschaften hervorgegangen sind. Und es ist interessant zu sehen, wie Campbell sich verändert hat im Laufe der Zeit. Er hat ja erstmal in seiner Ehefrau Jean Erdmann, die eine bekannte, erfolgreiche Tänzerin und Choreografin war, angefangen,
einen Widerpart gefunden, der ihn immer wieder, wie er es sagte, daran erinnert hat, dass die Mythen für die Lebenswelt Bestand haben müssen. Und auch seine Schülerin am Mädchen-College, das Sarah Lawrence College in New York, wo er 38 Jahre lang unterrichtet hat,
Die hätten ihn immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass es einen Lebensbezug geben muss. Und insofern hat er sich immer wieder dafür bedankt, dass eigentlich die Frauen in seinem Leben ihn dazu gebracht haben, dass eben auch dieser Lebensbezug da sein muss.
Und am Anfang sprach er oft davon, dass die Frau die Mutter des Helden ist und eine ganz andere Rolle inne hat und wurde dann aber auch oft, da gibt es auch Audioaufnahmen von Vorträgen, wo das dann kritisiert wurde und es dann interessant zu sehen, dass er in seinen späteren Lebensjahren dann doch davon abgekommen ist und das sehr begrüßt hat und auch die Frauen und weiblichen Zuhörer aufgefordert hat,
das selber zu entdecken und das haben dann auch andere Autorinnen gemacht. Ich glaube, er hat sich dann selber nicht mehr als der Anleiter dafür gesehen, aber er hat es begrüßt, dass andere das weiterführen. Alle großen Mythologien und ein Großteil der mythischen Erzählungen der Welt sind aus der Sicht des Mannes entstanden. Als ich »Der Heros in tausend Gestalten« schrieb und weibliche Helden einbringen wollte, musste ich auf die Märchen zurückgreifen.
Und so begann Joseph Campbell in seinem Werk »Den Reigen der Reise von Helden und Heldinnen« mit einem Märchen. Dem Märchen vom Froschkönig. »In den alten Zeiten, wo das Wünschen noch geholfen hat, lebte ein König, dessen Töchter waren alle schön, aber die jüngste war so schön, dass sich die Sonne selber, die doch so vieles gesehen hat, darüber verwunderte, so oft sie ihr ins Gesicht schien.«
Nah bei dem Schlosse des Königs lag ein großer dunkler Wald. Und in dem Walde unter einer alten Linde war ein Brunnen. Wenn nun der Tag recht heiß war, so ging das Königskind hinaus in den Wald und setzte sich an den Rand des kühlen Brunnens. Und wenn sie Langeweile hatte, so nahm sie eine goldene Kugel, warf sie in die Höhe und fing sie wieder. Und das war ihr liebstes Spielwerk.
Nun trug es sich einmal zu, dass die goldene Kugel der Königstochter nicht in das Händchen fiel, das sie ausgestreckt hatte, sondern neben vorbei auf die Erde schlug und geradezu ins Wasser hineinrollte. Die Königstochter folgte ihr mit den Augen nach, aber die Kugel verschwand und der Brunnen war tief und gar kein Grund zu sehen.
Da fing sie an zu weinen und weinte immer lauter und konnte sich gar nicht trösten. Und wie sie so klagte, rief ihr jemand zu. »Was hast du, Königstochter? Du schreist ja, dass ich ein Stein erbarmen möchte.« Sie sah sich um, woher die Stimme käme. Da erblickte sie einen Frosch, der seinen dicken, hässlichen Kopf aus dem Wasser streckte.
»Ach, du bist's, alter Wasserplatscher«, sagte sie, »ich weine über meine goldene Kugel, die mir in dem Brunnen hinabgefallen ist.« »Gib dich zufrieden«, antwortete der Frosch, »ich kann wohl Rat schaffen. Aber was gibst du mir, wenn ich dein Spielwerk wieder heraufhole?«
»Was du willst, lieber Frosch«, sagte sie, »meine Kleider, meine Perlen und Edelsteine, dazu die goldene Krone, die ich trage«, der Frosch antwortete.
»Deine Kleider, deine Perlen und Edelsteine, deine goldene Krone, die mag ich nicht. Aber wenn du mich liebhaben willst und ich soll dein Geselle und Spielkamerad sein, an deinem Tischlein neben dir sitzen, von deinem goldenen Tellerlein essen, aus deinem Becherlein trinken, in deinem Bettlein schlafen, wenn du mir das versprichst,«
»So will ich dir die goldene Kugel wieder aus dem Grunde hervorholen.« Dies ist ein Beispiel für den möglichen Beginn des Abenteuers. Ein Patzer, scheinbar der reinste Zufall, öffnet eine unerwartete Welt und der Einzelne wird in eine Beziehung zu Kräften hineingezogen, die er nicht wirklich versteht. Wie Freud gezeigt hat, sind Patzer kein bloßer Zufall. Sie sind das Ergebnis unterdrückter Wünsche und Konflikte.
Sie sind Kräusel auf der Oberfläche des Lebens, ausgelöst von unvermuteten Quellen. Als erste Manifestation der ins Spiel einbrechenden Mächte können wir den auf wundersame Weise auftauchenden Frosch als Boten und die Krise seines Auftauchens als Aufruf zum Abenteuer bezeichnen. Die Mitteilung des Boten mag die Aufforderung sein, zu leben, wie in diesem Fall, oder zu einem späteren Zeitpunkt der Lebensgeschichte zu sterben.
Sie mag der Aufruf zu einer großen geschichtsträchtigen Unternehmung sein. Oder sie mag den Beginn religiöser Erleuchtung markieren. Nach dem Verständnis der Mystiker markiert sie das, wie sie es nennen, Erwachendes Selbst. Im Fall der Prinzessin aus unserem Märchen signalisiert sie nicht mehr als den Beginn der Adoleszenz.
Doch ob groß oder klein, in welcher Lebensphase und in welchen Lebensverhältnissen auch immer, stets lüftet der Ruf den Vorhang über einer geheimnisvollen Verwandlung, einem Ritus oder Augenblick spirituellen Übergangs, der nach seinem Abschluss einem Sterben und Geborenwerden gleichkommt. Über den vertrauten Lebenshorizont ist man hinausgewachsen. Die alten Konzepte, Ideale und Gefühlsmuster passen nicht mehr.
Joseph Campbell in seinem »Heros in tausend Gestalten« über den Beginn des Froschkönigs. In der Szenerie des dunklen Waldes, des hohen Baums und der murmelnden Quelle spiegeln sich typische Merkmale für den Beginn einer Heldenreise.
Es sind Symbole des sogenannten Weltnabels, laut Campbell ein zentraler Punkt im Mythos. Die Quelle allen Daseins, der Punkt, von dem aus die kosmischen Energien ins Zeitliche drängen. Die transzendente Kraft, die in allem lebt und webt, die Fülle des Guten wie des Bösen beinhaltend.
Am anderen Tage, als sie mit dem König und allen Hofleuten sich zur Tafel gesetzt hatte und von ihrem goldenen Tellerlein aß, da kam plitsch, platsch, plitsch, platsch etwas die Marmortreppe heraufgekrochen und als es oben angelangt war, klopfte es an die Tür und rief »Königstochter, Jüngste, mach mir auf! Weißt du nicht, was gestern du zu mir gesagt, bei dem kühlen Wasserbrunnen?«
Das Märchen des Froschkönigs erzählt eine doppelte Heldenreise. Auch der Frosch hat ein Abenteuer zu bestehen. Er verlässt seine heimatliche Brunnenwelt, begibt sich mutig an Land und Hof, wo er unerwartet Hilfe vom König erfährt. Der König aber wurde zornig und sprach, »Wer dir geholfen hat, als du in Not warst, den sollst du hernach nicht verachten.«
Da packte sie den Frosch mit zwei Fingern, trug ihn hinauf in ihr Kämmerlein und setzte ihn dort in eine Ecke. Als sie aber im Bitte lag, kam er gekrochen und sprach, »Ich will schlafen so gut wie du. Heb mich hinauf, oder ich sag's deinem Vater.« Da wurde sie bitterböse, holte ihn herauf und warf ihn gegen die Wand.
»Nun wirst du Ruhe geben«, sagte sie, »du garstiger Frosch!« Als er aber herabfiel, war er kein Frosch mehr, sondern ein Königssohn mit schönen, freundlichen Augen. Der war nun nach ihres Vaters Willen ihr lieber Geselle und Gemahl. Er erzählte ihr, er wäre von einer bösen Hexe verwünscht worden, und niemand hätte ihn aus dem Brunnen erlösen können als sie allein.
Und morgen wollten sie mitsammen in sein Reich gehen. Campbell sieht im Frosch nicht nur ein Boot in der Jenseitswelt, der zum Ruf zum Abenteuer aufruft, sondern zugleich eine kindliche Entsprechung, wie er sagt, der Schlange des Ostens, wie in der chinesischen Mythologie, die die Sonne im Maul trägt. Die Sonne wieder aufgeht, wird die sozusagen von diesem Drachen wieder ausgespuckt.
Genauso wie der Frosch ja die goldene Kugel aus der Tiefe des Brunnens wieder emporbringt. Und da kann man allerdings, wie ich meine, noch viel weiter gehen im Sinne einer kosmischen Symbolik oder kosmologischen Symbolik, die im Grunde genommen auch in dem Märchen vom Froschkönig angelegt ist. Also der Prinz ist verzaubert, man könnte auch sagen verdammt dazu, im Zustand des Froschartigen zu verharren.
Er kommt, wie gesagt, aus der Tiefe des Brunnens, des Unbewussten hervor, aus dem Feuchten, Animalischen. Und die kindliche Prinzessin ist das Gegenstück dazu. Sie gehört ganz der Welt des Tages an, des Lichtes, will von den Abgründen des Brunnens nichts wissen, findet den Frosch hässlich und die goldene Kugel ist für sie nichts weiter als ein Spielzeug, obwohl die ja tatsächlich auch als ein Sonnensymbol angesehen werden könnte. Auch das hat Campbell ja gesehen. Und dann gibt es aber darüber hinaus noch einen interessanten Zusammenhang, wie ich finde,
zwischen der Heldenreise und der Nachtmehrfahrt. Den Begriff hat ja der Völkerkundler Leo Frobenius eingeführt, 1904 in einem Buch über das Zeitalter des Sonnengottes in der ägyptischen Mythologie. Und dieser Gedanke der Nachtmehrfahrt hat Campbell zu seiner Idee von der Heldenreise inspiriert. Laut Frobenius folgen alle Mythen dem Bild des Sonnenlaufs, der unter- und wiederaufgehenden Sonne. Der
Der Sonnengott muss jeden Abend untergehen und dann auch eine gefahrvolle Reise bestehen, wie eben der Heros in der hellen Reise. Eine gefahrvolle Reise durch die Unterwelt, um am nächsten Morgen neu geboren zu werden. Und in der ägyptischen Mythologie ist dann der Sonnengott Reh, der mit seiner Barke die Wasser der Unterwelt durchfährt und dabei von einer Riesenschlange bedroht wird, die die Sonne zu verschlucken droht.
Und im Märchen ist davon noch der Frosch übrig geblieben. Und am Ende müsste dann eigentlich die Hochzeit von Himmel und Unterwelt stehen, wovon die Prinzessin aber bekanntlich nichts wissen will. Und dann besteht jetzt die geniale Leistung von Jung darin, diese Nachtmehrfahrt auf psychische Krisen zu übertragen. Also wer zum Beispiel eine Depression durchmacht, durchläuft in gewissem Sinne ebenfalls eine Nachtmehrfahrt.
Und das dann wiederum als Heldenreise anzusehen, kann hilfreich sein, weil man die Situation als eine Durchlaufphase erkennt und Licht am Ende des Tunnels sehen kann. Und in genau so einer Situation befindet sich ja auch der im Froschkörper gefangene Prinz vor seiner Erlösung, während er umgekehrt auch der Prinzessin aus ihrer Kinderwelt in die reife Erwachsenenwelt verhilft.
Aber wichtig ist, dass beide am Anfang nur eine Seite der Welt repräsentieren und wenn sie dann am Schluss zusammen auf dem Wagen davon fahren, dann ist die Erleichterung des Dieners groß, des treuen Heinrich, dem ja die Eisen von der Brust abfallen, also sprichwörtlich, aber im Märchen eben auch durchaus wörtlich aufgefasst.
Und diese Erleichterung des Dieners, das ist im Grunde genommen die Erleichterung der ganzen Welt. Denn im Märchen geht es ja meist zunächst um das Schicksal Einzelner, die zwar nicht als Individuen dargestellt werden, sondern als typisierte Figuren. Aber im Mythos, und das schwingt ja durchaus auch mit, geht es um das Schicksal der Gemeinschaft und des ganzen Volkes, der ganzen Welt.
Und die Fahrt mit dem Wagen zum Schluss, das ist im Grunde genommen die Fahrt des Sonnenwagens, könnte man auch sagen. Also die Fahrt kann weitergehen, das Leben kann weitergehen, nachdem Licht und Dunkel wieder vereint sind am Schluss der Geschichte. Alles verwandelt sich, nichts geht unter. Es wandert der Lebenshauch von dort hierher, von hier dorthin und er drängt sich ein in beliebige Körper. Was früher gewesen ist, nicht mehr, was nicht gewesen entsteht. Es erneuern sich alle Momente.
Also die Geschichte der Religionswissenschaft war lange Zeit geprägt, eben durch genau dieses Interesse, was auch Joseph Campbell hatte, nämlich
zu vergleichen und zwar in dem Fall jetzt eben mythologische Erzählungen aus unterschiedlichen kulturellen Kontexten miteinander zu vergleichen, um eben gegebenenfalls eine allengemeinsame Struktur zu finden. Und man hat sich in der Religionswissenschaft sehr stark von solchen Vorgehensweisen distanziert. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass man sagen muss, ein Vergleich ist,
findet ja immer aus einer bestimmten Perspektive statt, die ich ja zunächst einmal einnehme. Ich habe einen bestimmten Standort und von dem aus schaue ich und finde dann aufgrund einer bestimmten Richtung, die ich für meinen Blick wähle, Gemeinsamkeiten. Und das ist sicherlich, würde ich sagen, der zentrale Vorwurf, den man an
Joseph Campbell als aus einer wissenschaftlichen Sicht formulieren kann, dass er Gemeinsamkeiten sehr stark hineinliest, aus einem bestimmten Interesse heraus, das er verfolgt hat. Das wäre einfach der Einwand, den ich aus meinem Fach formulieren würde.
Jedes Mal, wenn die Sonne die Mitte des Himmels erreicht hat, geht auch der ehrliche Alte vom Meere heraus aus der Salzflut, lässt sich beim Wehen des Zephyr von dunklen Wellen umkreuseln, ist er an Land. Dann schläft er in einer geräumigen Höhle. Um ihn herum aber sammeln sich Robben und schlafen. Es sind dies Kinder der herrlichen Meere.
Diese entsteigen der grauen Flut und schnauben die bitteren Gerüche der salzigen Tiefe. Campbell wollte kein endgültiges System zur Deutung der Mythen schreiben, denn dies gäbe es seiner Ansicht nach auch nicht. Am Ende seiner Studie vergleicht er die Mythen mit Proteus, dem alten vom Meere aus Homers Odyssee.
Wie jener Meeresgott geben auch die Mythen ehrlich Antwort. Ob ihre Antwort tief oder trivial ausfalle, hänge ganz von der Frage ab. Denn wenn man nicht fragt, was der Mythos ist, sondern wie er funktioniert, was er in der Vergangenheit geleistet hat und was er heute noch zu leisten vermöchte, dann zeigt sich, dass er ebenso empfänglich ist für die Obsessionen und Bedürfnisse des Einzelnen, der menschlichen Gruppen und der Zeit wie das Leben.
Auch wenn Campbell bei seiner Frage nach der Gemeinsamkeit aller Mythen über viele Unterschiedlichkeiten hinwegsehen musste, so hatte er doch mit seinem Modell der Heldenreise ins Schwarze getroffen. Also in die Filmindustrie hinein, in die Literatur hinein, in die Therapie hinein, in die Coaching-Szene hinein. Und dort wird es verwendet und dort wird es rezipiert.
Insofern ist es einfach eine Tatsache, dass sein Denken in unserer Gesellschaft eine Verbreitung gefunden hat. Und das wiederum ist wissenschaftlich natürlich interessant zu beschreiben. Also wieso ist das so erfolgreich? Warum knüpfen Leute da gerne dran an? Warum verwenden Filmemacher dieses Schema so gerne? Und warum sind Filme, die dieses Schema umsetzen, so unglaublich erfolgreich?
Also das sind dann auf jeden Fall wissenschaftlich hochinteressante Fragen, denen man eben auch weiter nachgehen sollte, aus meiner Sicht.
Sing it, Sam.
You must remember this, a kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by.
Zu den bis heute erfolgreichsten Filmen der Kinogeschichte gehört Casablanca. Das US-amerikanische Immigranten-Melodram erschien 1942, sieben Jahre vor Erscheinen von Campbells Heldenstudie. Sam, I thought I told you never to play.
Casablanca zeigt ja musterhaft auch eine Reise des Helden. Unser Barbesitzer Rick, den wir am Anfang kennenlernen, hat ja eine Backstory-Wound, eine Verletzung in der Vergangenheit. Das ist die Ilsa. Die Ilsa hat ihn ja verlassen in Paris und großes Gejammer. Und da ist er nach Casablanca gegangen. Und am Anfang sagt er, ja, also ich kümmere mich um gar nichts, um Politik und so weiter und so fort. Also er hockt da total verbittert. Doch was passiert? Da kommt die Ilsa.
am Arm in sein eigenes Lokal hinein und so geht er auf eine äußere Reise. Er beschafft diese Visa.
Es könnte eine gute Idee sein, von Casablanca zu vergehen.
Musik
Dass es Muster gibt, war den Autorinnen und Autoren auch der 10er, 20er, 30er Jahre natürlich bewusst.
Die haben aber nicht Joseph Campbell gelesen. Das Buch ist 1948 erschienen. Also dass jetzt jemand auf die Idee gekommen wäre, den aus dem Regal zu nehmen und das Muster zu bauen, das steckte in den Filmemachern und Filmemacherinnen drin. Und die haben ja auch in einer Geschwindigkeit produziert, die wir uns heute gar nicht mehr vorstellen können. John Ford hat 170 Filme gedreht. Also es ist unfassbare Geschwindigkeit. Hitchcock so um die 70 und die brauchten kein Musterbuch an der Seite, die hatten das Muster in sich.
Campbell also 1948, okay, wird dann entdeckt in den 70er Jahren. Das geht etwas zögerlich, aber dann fängt man auch bei Disney an, sozusagen das Kondensierte von Campbell rauszunehmen und daraus so Handlungsanleitungen zu bauen. Dieser Wunsch nach Handlungsanleitungen, nach Mustern, nach Rezepten, der ist aber schon viel älter. Und Campbell ist halt nur ein Modell unter mehreren, was sich Praktiker und Praktikerinnen so erhoffen, um in Notsituationen schneller arbeiten zu können.
Michaela Krützen ist Medienwissenschaftlerin und lehrt an der Hochschule für Fernsehen und Film in München. Für ihr Buch »Dramaturgie des Films« hat die Professorin anhand von Joseph Campbells Modell der Heldenreise die Erzählweise von 200 Filmen analysiert.
Vielleicht sagen sie einfach Hollywood-Kino dazu, aber es ist ja in allen Ländern vertreten. Also dieses Classical Cinema hat seine ganze Formsprache schon unheimlich schnell entwickelt. Also seit 1895 gibt es das Kino. Man ist immer wieder, wenn man das so anschaut, überrascht, wie schnell das zu seiner Form gefunden hat. Schon in den 10er Jahren des 20. Jahrhunderts war diese Heldenreise, ohne dass einer wusste, dass es die Heldenreise ist, bereits präsent. Also das Muster steckt ja in den Leuten drin.
So, das Gegenkino hat sich ja immer wieder versucht. Also der russische Revolutionsfilm, wenn Sie Panzerkreuzer Potjomkin gucken, da ist auch keine Heldenreise drin, es sei denn, das Schiff ist die Heldenreise. So, das heißt, es gibt immer wieder Gegenkino im Surrealismus bei der Andalusische Hund keine Heldenreise. Das dominiert aber diese Art des Erzählens ja bis in die 60er Jahre hinein.
Das Classical Cinema ist ein Kino, wo Sie am Ende einer Szene wissen, da kommt irgendein Reiz. Oh, ich muss Jeff informieren und die Hauptfigur agiert und geht in die nächste Szene rein. In der Fachsprache heißt es dann immer No scene that doesn't turn. Keine Szene darf es geben, die die Handlung nicht vorantreibt. Classical Cinema ist handlungsorientiert.
Es treibt die Handlung voran, voran, voran. Niemals wird eine Figur einfach nur so, sagen wir mal, eine Viertelstunde durch die Vororte von Rom ziehen, wie Sie es dann bei Antonioni beispielsweise sehen, wo die Figuren ziellos sind, wo sie nicht wissen, was sie wollen. Im Classical Cinema haben die Figuren immer ein Ziel und es gibt dieses Reizreaktionsschema, das geht immer weiter voran. Das ist ein typisches Merkmal. Classical Cinema heißt auch immer verständlich sein.
Das heißt, der Zuschauer, die Zuschauerin ist vielleicht mal kurz irritiert, aber eigentlich haben sie den Eindruck, sie wissen, worum es da geht. Sie verstehen, wo der Film spielt, sie verstehen, wann der Film spielt. Und all das sind, es gibt irgendwie viel mehr Merkmale, aber das reicht schon mal, um zu kapieren, dass es ein Kino der Sicherheit ist, was sie eben verlassen, wenn sie nicht mehr Classical Cinema machen. You're the top of the world.
You're the Coliseum. You're the top. You're the Louvre Museum. You're a melody from a symphony by Strauss. You're a band old bonnet, a Shakespeare sonnet, you're Mickey Mouse. You're the knife. You're the Tower of Pisa. You're the smile.
Untertitelung des ZDF, 2020
Nehmen wir mal sowas wie die heißen Screwball-Comedys. Das sind so Komödien, wo ein Held oder eine Heldin total durchgeknallt ist und die andere Figur sozusagen überzeugt, mit auf eine Reise zu gehen. Sowas wie »Die Schwester, der braut Holiday« mit Katharine Hepburn und Cary Grant beispielsweise.
Immer wieder gern gesehen, The Philadelphia Story wieder. Ich bin jetzt gerade bei Katharine Hepburn gelandet, warum auch nicht? Und Cary Grant, das ist immer wieder das gleiche Muster. Eine Figur ist total verbohrt und will sich nicht ändern. Die andere Figur kommt, die Figur ändert sich. Das bleibt ein sehr stabiles Muster und Figuren, die sich nicht ändern, werden abgestraft.
Also wer nochmal Gone with the Wind gucken will und überrascht sein wird, wie rassistisch der Film ist, Klammer zu, wer nochmal Gone with the Wind guckt, wird feststellen, oh, Scarlett O'Hara macht ja keine innere Reise durch. Ja, okay, klar, macht sie nicht. Aber darum wird sie am Schluss auch von Red Butler verlassen. Sie wird abgestraft.
Das Muster ist trotzdem da und es bleibt dominant bis in die 50er Jahre hinein. Das heißt, die Heldinnen, die auf eine Reise gehen, also beispielsweise, dass Frauen in Romantic Comedies, in romantischen Komödien was lernen können, indem sie sich eben auf ihre eigenen Werte besinnen oder dass sie tatsächlich als Detektivinnen arbeiten können, als Astronautinnen und so weiter und so fort.
Das haben ja dann eigentlich erst die 70er und 80er Jahre gebracht. Und seitdem ist das Muster von Campbell auch wiederzufinden in Filmen, wo die Protagonistin eben eine Protagonistin ist, also eine Frau. Also eine Figur, sagen wir mal, wie Clarice Starling in Das Schweigen der Lämmer, eine Ermittlerin, die noch nicht mal ein Love Interest hat. Das ist dann eigentlich typisch für eine bestimmte Zeit. Where they say, let us begin.
Campbells Buch »Heros in tausend Gestalten« wurde jedoch erst populär, nachdem ein großer Filmemacher es entdeckt hatte. George Lucas
Nachdem George Lucas American Graffiti gedreht hatte, war er in der paradiesischen Situation, er hätte im Prinzip fast alles machen können. Das ist ja toll, das ist ja bis heute so in der Filmbranche, sie haben einen so einen Kracher und alle sagen, mach was. Für George Lucas war die Situation nicht so paradiesisch, weil er saß an einem Drehbuch, The Adventures of the Starkiller und kriegte das Ding einfach nicht hin.
Kein Writers Block, aber die Struktur einer Katastrophe. Und man weiß anekdotisch, dass Lukas sich in seiner Verzweiflung mit der Schere am Bart rumgeschnitten hat. Jeder macht ja was anderes in seinem Wahnsinn, wenn er oder sie nicht weiterkommt und kam nicht weiter. Und da erinnert er sich an sein Studium. Und da hat er in der Anthropologie mit Joseph Campbell, der Heros in tausend Gestalten, Erfahrungen gemacht.
Und das gilt sozusagen, ob die Anekdote nun genauso stimmt oder nicht, als die Initialzündung. Weil dieses seltsame Drehbuch, The Adventures of the Starkiller, hat er daraufhin umgeformt. Und das kann man jetzt tatsächlich sehen. Wenn man die Originalfassung anguckt, ganz ehrlich gesagt, ich kann ihn, The Adventures of the Starkiller, nicht zusammenfassen. Ich habe mir damals so einen Zettel gemacht, als ich das gelesen habe. Das geht hin und her, da werden irgendwelche Gehirne aus Oputschi geholt und dies und jenes. Man weiß eigentlich nicht so richtig, worum es geht.
Und jetzt ist die zentrale Idee zu sagen, nee, das machen wir nicht, sondern wir haben einen Helden, eine Heldin, in dem Fall ist es jetzt ein Held, der auf eine Reise geht. Und wenn man im Wissen um Joseph Campbells Modell mal den ersten gedrehten Teil von Star Wars anschaut, dann ist es fast witzig zu beobachten, dass die Stationen, die Joseph Campbell beschreibt, tatsächlich in Star Wars zu finden sind.
Ich habe mich lange Zeit im Kreis gedreht und versucht, mir Geschichten auszudenken, und das Skript hat sich überschlagen, sodass ich am Ende hunderte von Seiten hatte. Bei »Der Heros in tausend Gestalten« habe ich einfach 500 Seiten genommen und gesagt, »Hier ist die Geschichte. Hier ist das Ende. Hier ist der Fokus. Hier ist die Art und Weise, wie das alles aufgebaut ist. Es war alles da, und das schon seit tausenden von Jahren, wie Herr Campbell betonte. Und ich dachte, das ist es.«
George Lucas setzte Campbells Stufen der Heldenreise quasi eins zu eins um. Bei einer ersten Vorführung im engsten Kreis ist die Stimmung noch verhalten. Einzig Steven Spielberg glaubt an den Film. Doch dann entwickelt sich Krieg der Sterne zum Kassenschlager und Kultfilm und schließlich zu einer milliardenschweren Weltmarke. »Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis.«
Krieg der Sterne. Star Wars Episode 4
Neue Hoffnung. Es herrscht Bürgerkrieg. Die Rebellen, deren Raumschiffe von einem geheimen Stützpunkt aus angreifen, haben ihren ersten Sieg gegen das böse Galaktische Imperium errungen. Während der Schlacht ist es Spionen der Rebellen gelungen, Geheimpläne über die absolute Waffe des Imperiums in ihren Besitz zu bringen, den Todesstern.
Eine bewaffnete Raumstation, deren Feuerkraft ausreicht, um einen ganzen Planeten zu vernichten. Verfolgt von den finsteren Agenten des Imperiums jagt Prinzessin Leia an Bord ihres Sternschiffs nach Hause. Als Hüterin der erbeuteten Pläne, die ihr Volk retten und der Galaxis die Freiheit wiedergeben könnten.
Nach dem Erscheinen von Krieg der Sterne entdecken in Hollywood immer mehr Drehbuchberater Campbells Modell der Heldenreise für den Film. Darunter auch Christopher Vogler.
Sein Buch »The Writer's Journey – Mythic Structure for Writers« gehört heute zur Standardliteratur von Filmschaffenden. Nicht nur Autorinnen, auch Marketingfachleute und Storyteller nutzen es für ihre Arbeit. In Deutschland kam es 1998 unter dem Titel »Die Odyssee des Drehbuchschreibers« heraus.
Sie dürfen sich jetzt nicht vorstellen, dass die Autoren und Autorinnen zu Hause sitzen und sich das Modell hinlegen und das wirklich stationenhaft abarbeiten. Das merkt man sofort. Das merkt man so bei so schlechten Weihnachtsfilmen, die so im Schwung kommen oder bei so, sage ich mal, drittklassigen Romantic Comedys, merkt man sofort, da hat jemand das Muster erfüllt und dann interessiert einen das auch nicht weiter. Und natürlich sagen wir vor allen Dingen, bitte, bitte bedienen Sie nicht die Muster.
Aber um jemandem, der jung ist, zu erklären, was das eigentlich heißt, das Muster. Also wenn man ihm sagt, bitte, bitte bedienen Sie nicht die Muster, müssen Sie ja irgendwie auch mal erfahren, was die Muster sind. Das spielt Joseph Campbell tatsächlich eine Rolle und zwar in verschiedensten Ausprägungen. Das Originalbuch wird zum Teil unterrichtet.
Viele aber nehmen Bearbeitungen des Modells von Joseph Campbell, zum Beispiel Christopher Vogler, Die Reise des Helden. Da gibt es das ja auf den Film angewandt. Das heißt also, es gibt Kolleginnen und Kollegen, die bereits die Brücke geschlagen haben zur Filmpraxis.
Wie Campbell zahllose Mythen und Märchen studierte, so untersuchte Christopher Vogler tausende erfolgreiche Filme des 20. Jahrhunderts. Und er kannte in ihnen die Stationen von Campbells Heldenreise wieder. Inklusive der archetypischen Figuren, die auch schon in Homers Odyssee auftreten, wie der Held, der Herold, der Mentor, der Schwellenhüter, der Trickster und natürlich der Gegenspieler. Christopher Vogler nennt ihn den Schatten.
Im Krieg der Sterne trägt er schwarz. Darth Vader. Anhand von Krieg der Sterne und anderer Blockbuster wie Der Zauberer von Oz und E.T. gibt Christopher Voakler eine praktische Einführung in Campbells Modell der Heldenreise. Er reduziert dabei die 17 Stationen der Campbellschen Heldenreise auf 12. Erste Station, gewohnte Welt.
Die meisten Geschichten lassen den Helden aus seiner gewohnten Umgebung in eine andersartige, neue und fremde Welt aufbrechen. Und bevor Luke Skywalker, der Held aus Krieg der Sterne, ins Weltall aufbricht, können sie ihn dabei beobachten, wie er sich auf der heimischen Farm auf dem Wüstenplaneten Tatooine zu Tode langweilt. Musik
Auch in Der Zauberer von Oz vergeht zunächst geraume Zeit mit der eingehenden Schilderung von Dorothys ganz alltäglichem Leben in Kansas, bis der Sturm sie endlich in die Wunderwelt des Landes Oz weht. Zweite Station, Ruf des Abenteuers.
Hier wird der Held mit einem Problem konfrontiert. Er steht vor einer Herausforderung oder muss sich auf ein Abenteuer einlassen. Wie dieses Ziel nun im Einzelnen beschaffen ist, lässt sich oft aus einer Frage entnehmen, die sich bei der Aufforderung stellt. Werden E.T. oder Dorothy wieder nach Hause zurückkehren? Wird Luke die Prinzessin Leia retten und Darth Vader besiegen?
Dritte Station. Weigerung. Der widerstrebende Held. Hier dreht es sich um Angst. Ist der Ruf erst einmal an den Helden ergangen, so zögert er nicht selten, die Schwelle zum Abenteuer auch wirklich zu übertreten. In Krieg der Sterne sieht die Weigerung so aus, dass Luke auf Obi-Wans Bitte nicht eingeht und zur Farm seines Onkels und seiner Tante zurückkehrt.
Erst als er sie dort von den Sturmtruppen des Imperiums niedergemetzelt vorfindet, zögert er nicht länger, dem Ruf zu folgen und sich auf die Suche nach Leia zu machen. Das Böse des Imperiums hat für ihn nun eine persönliche Bedeutung. Er hat ein Motiv. Vierte Station, der Mentor. An diesem Punkt tritt in vielen Geschichten eine besondere Gestalt, eine Art Merlin in Erscheinung, der Mentor des Helden.
In Der Zauberer von Oz weist die gute Hexe Glinda Dorothy den Weg und gibt ihr die roten Schuhe, die sie am Ende wieder nach Hause bringen. In Krieg der Sterne erhält Luke von Obi-Wan das Lichtschwert seines Vaters, ohne dass er die Kämpfe mit den Mächten der Finsternis nicht bestehen könnte. Was ist das? Das Laserschwert deines Vaters. Die Waffe eines Jedi-Ritters. Nicht so plump und so ungenau wie Feuerwehr. Pssst!
Eine elegante Waffe aus zivilisierteren Tagen. Weder hat sich von der dunklen Seite der Macht verführen lassen. Der Macht? Die Macht ist es, die dem Jedi seine Stärke gibt. Es ist ein Energiefeld, das alle lebenden Dinge erzeugt. Es umgibt uns, es durchdringt uns, es hält die Galaxis zusammen. Fünfte Station, Überschreiten der ersten Schwelle.
Nun ist der Held endlich bereit, sich auf das Abenteuer einzulassen. An diesem Punkt beginnt das eigentliche Abenteuer. Der Ballon steigt auf, das Schiff sticht in See, die Liebesgeschichte fängt an, das Flugzeug oder das Raumschiff hebt ab. Filme lassen sich häufig in drei Akte teilen. Entscheidung, des Helden zu handeln. Im zweiten geht es um die Handlung selbst und im dritten um die Konsequenzen, die daraus entstehen.
Wie konnten wir so einfach an denen vorbeikommen? Ich dachte, es wäre aus. Die Macht kann großen Einfluss haben auf die geistig Schwachen. Und hier sollen wir einen Piloten finden, der uns nach Alderaan bringt? Nun, das ist der Treffpunkt der besten Frachterpiloten, aber sei auf der Hut. Hier kann es ziemlich rau zugehen. Ich kann nichts einschüchtern. Sechste Station, Prüfungen, Verbündete und Feinde.
Sobald der Held die erste Schwelle überschritten hat, steht er freilich vor neuen Herausforderungen. Er gewinnt Verbündete, macht sich Feinde und begreift allmählich die Regeln in der anderen Welt. Kneipen und schäbige Bars scheinen für derlei Geschäfte wie geschaffen zu sein. So ist im Film Casablanca Ricks Café der Ort, an dem Allianzen geschmiedet werden und Feindschaften entstehen. In Krieg der Sterne kommt der Kneipe diese Funktion zu.
Hier wird das wichtige Bündnis mit Han Solo geschlossen. Hier bahnt sich die nicht minder wichtige Feindschaft mit Jabba the Hutt an. Natürlich ist die Bar nicht der einzige Schauplatz. In vielen Geschichten handelt es sich hier um Begegnungen entlang des Weges. Musik
So stößt Dorothy in Der Zauberer von Oz auf den gelben Weg auf ihre zukünftigen Gefährten. We're off to see the wizard, the wonderful wizard of Oz.
Siebte Station, Vordringen zur tiefsten Höhle, zum empfindlichsten Kern. Schließlich gelangt der Held in die unmittelbare Nähe eines gefährlichen Ortes, der nicht selten tief im Untergrund verborgen ist und an dem sich das Ziel seiner Wünsche befindet.
In den alten Mythen entspricht die tiefste Höhle oft dem Reich der Toten. Der Held muss, wie Orpheus, in die Unterwelt hinabsteigen, um seine Geliebte zu retten, oder, wie Siegfried, in einer Höhle mit einem Drachen kämpfen, um einen Schatz zu erlangen. In Der Zauberer von Oz wird Dorothy von der bösen Hexe in dem unheimlichen Schloss gefangen gehalten. Und ihre Gefährten müssen sich dort hineinschleichen, um sie wieder zu befreien.
Im modernen Mythos von Krieg der Sterne geraten Luke Skywalker und seine Gefährten beim Vordringen zur tiefsten Höhle in das schwere Feld des Todessterns, auf dem sie schließlich Darth Vader gegenüberstehen und Prinzessin Leia retten können. Achte Station. Entscheidende Prüfung. Hier ereilt den Helden nun sein Schicksal und in einer letzten direkten Konfrontation muss er seine größte Angst bezwingen.
Für das Publikum ist diese entscheidende Prüfung ein kritischer Moment, denn wir sind im Ungewissen und voller Spannung, ob der Held überleben oder sterben wird. Der Held befindet sich hier, wie Jonas, im Bauch des Walfischs. In Krieg der Sterne kommt dieser Horror auf Luke, Leia und ihre Gefährten zu, als sie sich in den Katakomben des Todessterns befinden und in eine gigantische Abfallmühle geraten.
Luke wird dort von dem krakenartigen Untier, das in den Abwasserkanälen lebt, unter Wasser gezogen und so lange festgehalten, dass man sich fragen muss, ob er nicht womöglich schon tot ist. In Der Zauberer von Oz werden Dorothy und ihre Freunde von der bösen Hexe gefangen gehalten. Und es will so scheinen, als gäbe es kein Entkommen. Neunte Station, Belohnung, Ergreifen des Schwertes.
Nachdem er die Todesgefahr überlebt hat, gibt es für den Helden und für das Publikum einen Grund zum Feiern. Er nimmt nun seine Belohnung in Besitz, den Schatz, um dessen Willen er aufgebrochen war. Luke rettet nicht nur die Prinzessin Leia, sondern gelangt auch in Besitz der Pläne des Todessterns, die im künftigen Kampf gegen Darth Vader noch eine wichtige Rolle spielen werden.
Dorothy entkommt aus dem Schloss der bösen Hexe und gelangt dabei in den Besitz der roten Schuhe und des Hexenbesens. Dinge, die für ihre Heimkehr wichtig werden. Musik
Zehnte Station, Rückweg. Nun beginnt der dritte Akt, in dem der Held sich den Konsequenzen stellen muss, die sich aus seiner Begegnung mit den dunklen Mächten ergeben haben. Einige der besten Verfolgungsszenen entwickeln sich aus dieser Situation. So sehen sich auch Luke und Leia der wütenden Nachstellung Darth Vaders ausgesetzt, nachdem ihnen die Flucht vom Todesstern gelungen ist.
In E.T. ist dies die Szene, in der Elliot und E.T. bei Mondlicht auf dem Fahrrad vor Keyes, dem Repräsentanten der repressiven Regierungsmacht, fliehen und sich dabei in die Lüfte erheben. Dieses Stadium der Handlung markiert den Punkt, an dem der Held den Entschluss fasst, in die gewohnte Welt zurückzukehren. Elfte Station Auferstehung.
Krieg der Sterne spielt durchgehend mit diesem Element.
Und aus jeder dieser Prüfungen geht Luke Skywalker mit neuem Wissen und einer gesteigerten Befehlsgewalt über die Macht hervor. Seine Erfahrungen haben ihn zu einem anderen Menschen werden lassen. Zwölfte Station. Rückkehr mit dem Elixier. Nun kehrt Deheros also in die gewohnte Welt zurück.
Doch seine Reise wäre sinnlos gewesen, hätte er nicht aus der anderen Welt ein Elixier, einen Schatz oder neu erworbenes Wissen mitgebracht. So kehrt Dorothy in dem Wissen, dort geliebt zu werden, nach Kansas zurück und kann sagen, nirgendwo ist es so schön wie daheim.
E.T. kann nach seiner Heimkehr vom Erlebnis der Freundschaft mit den Erdlingen berichten. Luke Skywalker besiegt zumindest vorläufig Darth Vader und stellt im Universum wieder Ruhe und Ordnung her.
Soweit die Stationen der Heldenreise aus Christopher Voglers »Die Odyssee des Drehbuchschreibers«. Bei Christopher Vogler finden wir eine sehr überschaubare und gut handhabbare Übersicht in zwölf Stufen, die der Heros durchläuft.
Das ist deshalb natürlich besonders populär geworden und vielfach findet man auch im Internet Darstellungen von Joseph Campbell, die sich aber tatsächlich auf Vogler beziehen.
Das ist für Dramaturgen sehr nützlich, für Autoren, die die dramaturgische Kompetenz oder Funktionalität ihrer Drehbücher oder Romane und so weiter überprüfen wollen. Was allerdings vollkommen fehlt, ist die transzendente Dimension. Denn bei Campbell bezieht sich ja
Die ganze Hellenreise, also sämtliche Stufen, die er durchläuft, immer auf ein Transzendentes, was im Weltnabel symbolisiert wird. Der Weltnabel, das ist...
In den Mythen oft die Quelle am Fuße eines Weltbaumes sozusagen, wo ja der Held auch oft eine Göttin trifft. Dieses Motiv taucht immer wieder in allen Mythen der Welt auf und der Weltnabel ist eine von vielen Symbolisierungen der Zeit und namenlosen Transzendenz, aus der alles kommt, das Universum und wir mit ihm und in das alles wieder eingeht.
Nicht etwa das Nichts, denn aus dem Nichts könnte ja nichts werden. Im Buddhismus wird es oft als Leere oder Leerheit beschrieben. Dann wird aber auch oft darauf hingewiesen, dass man es genauso gut als eine Fülle bezeichnen könnte, also eine Potentialität bezeichnen.
Etwas, das werden könnte, in dem alle Möglichkeiten vorhanden sind. Da haben wir auch wieder diese Nähe zu der heutigen modernen Physik, den Quantenphysikern, über die manchmal gesprochen wird, diese Verbindung zwischen Mystik und Naturwissenschaft. Das alles ist in gewisser Weise vorweggenommen im Heldenmythos, wie Campbell das aufgearbeitet hat. Und wie hat Joseph Campbell selbst »Krieg der Sterne« rezipiert?
Jenes Film-Epos, das direkt aus seinem Modell der Heldenreise konzipiert wurde? In der Geschichte geht es um das Wirken von Prinzipien, nicht um das Handeln von einer Nation gegen eine andere. Die ungeheuerlichen Masken, die manche in Krieg der Sterne aufhaben, stellen die wirkliche Ungeheuerlichkeit in der modernen Welt dar. Wenn Darth Vader die Maske abgenommen bekommt, sieht man einen ungeformten Menschen. Jemanden, der sich als menschliches Individuum nicht entwickelt hat.
Was man sieht, ist ein undifferenziertes Gesicht, das fremd und mitleiderregend wirkt. Darth Vader hat seine eigene Menschlichkeit nicht entwickelt. Er ist ein Roboter. Er ist ein Bürokrat, der nicht sein eigenes Leben führt, sondern nach einem übergestülpten System lebt. Das ist die Bedrohung für unser Leben, der wir uns heute alle gegenübersehen. Lässt man sich von dem System verflachen und seiner Menschlichkeit berauben, oder ist man imstande, es für menschliche Zwecke zu benutzen?
In den 80er Jahren führte der Moderator Bill Moyers eine Reihe von Interviews mit dem Mythenforscher. Auf der Luke Skywalker Ranch von George Lucas. Und dabei kamen die transzendenten Aspekte der Campbellschen Heldenreise zur Sprache. Wie etwa der Weltennabel oder die Bedeutung der Station im Bauch des Wals. Halt! Halt! Halt!
Meine Lieblingsszene war die, als sie in der Müllpresse waren und die Wände sich zusammenschoben und ich dachte, das ist das, was ich hier sehen kann.
Das ist wie im Bauch des Wals, der Jona verschluckt. Genau dort waren sie. Der Bauch ist der dunkle Ort, an dem die Verdauung geschieht und neue Energie erzeugt wird. Die Geschichte von Jona im Wal ist ein mythisches Motiv, das praktisch universell ist. Das Motiv des Helden, der in den Bauch eines Fisches steigt und zuletzt wieder verwandelt daraus hervorgeht.
Es ist ein Abstieg in die Finsternis. Psychologisch verkörpert der Wal die im Unbewussten eingeschlossene Lebenskraft. Metaphorisch ist Wasser das Unbewusste und das Wesen im Wasser ist das Leben oder die Energie des Unbewussten, das die bewusste Persönlichkeit überwältigt hat und entmachtet, überwunden und beherrscht werden muss.
Im ersten Stadium eines Abenteuers dieser Art verlässt der Held das Reich des Bekannten, über das er ein gewisses Maß von Kontrolle besitzt, und kommt an eine Schwelle, sagen wir den Rand eines Sees oder Meeres, wo ihm ein Ungeheuer der abgründigen Tiefe begegnet. Es gibt dann zwei Möglichkeiten. In einer Geschichte vom Typ Jonah wird der Held verschlungen und in den Abgrund gezogen, um später wieder aufzuerstehen. Eine Variante des Motivs von Tod und Auferstehung.
Die bewusste Persönlichkeit ist hier mit einer Ladung unbewusster Energie in Berührung gekommen, die es nicht zu bewältigen vermag und muss jetzt alle Prüfungen und Offenbarungen einer entsetzlichen Nachtmehrfahrt über sich ergehen lassen, wobei sie lernt, wie sie mit dieser Kraft der Finsternis ins Reine kommt und zuletzt in eine neue Art zu leben auftaucht.
Die andere Möglichkeit ist die, dass der Held beim Zusammenstoß mit der Kraft der Finsternis diese überwindet und tötet, wie Siegfried und Sankt Georg es taten, als sie den Drachen töteten. Aber wie Siegfried erfuhr, muss er dann das Drachenblut kosten, um etwas von dieser Drachenkraft in sich aufzunehmen. Als Siegfried den Drachen getötet und das Blut gekostet hat, hört er den Gesang der Natur.
Er hat seine Menschlichkeit überstiegen und sich wieder mit den Kräften der Natur verbündet, die die Kräfte unseres Lebens sind und von denen unser Denken uns entfernt. Nicht wahr? Dieser Verstand meint, dass er den Ton angibt. Aber er ist ein untergeordnetes Organ und darf sich keine Herrschaft anmaßen.
Wenn er sich die Herrschaft anmaßt, bekommt man einen Menschen wie Darth Vader in Krieg der Sterne. Den Mann, der zur bewusst willensbestimmten Seite überläuft. Musik
Das Muster der Heldenreise lässt sich natürlich nicht nur im Film, sondern auch in der Beltriss-Dick finden, bevorzugt in Krimis und Fantasy-Romanen. Aber auch in Klassikern wie Moby Dick von Herman Melville oder in den Romanen von Jane Austen.
Nicht jedem gefällt die Existenz eines solchen Erzählmusters. Wie etwa dem Science-Fiction- und Fantasy-Autor Neil Gaiman, dessen Romane häufig als mustergültige Beispiele für die Heldenreisen-Struktur angesehen werden. Ich habe »The Hero with a Thousand Faces« etwa zur Hälfte durchgelesen und gedacht, wenn das wahr ist, will ich es nicht wissen. Ich möchte es einfach nicht wissen.
Zur Ausbildung von Drehbuchautoren indes gehört die Kenntnis der Stadien der Heldenreise dazu.
Wenn Sie jungen Filmemachern und Filmemacherinnen dieses Muster beibringen, haben Sie es relativ leicht, weil da sind Sie sehr viel im Unterhaltungskino auch unterwegs. Da zeige ich dann beispielsweise immer noch Tutsi, also der funktioniert immer noch sehr gut mit Dustin Hoffman. Oder ich zeige das Schweigen der Lämmer, um ein ganz anderes Genre zu bedienen. Oder eine Romantic Comedy wie Moonstruck, das heißt, Sie haben einen großen Fundus anstatt,
An einfach aufgebauten oder klar aufgebauten, einfach sind die ja gar nicht, klar aufgebauten Geschichten, Reizreaktionsschema, Handlung gegen Handlung, das unterrichtet sich quasi, möchte ich sagen, so weg. Und dann kommt der entscheidende Tag, ich lehre an einer Kunsthochschule, wo die Begegnung mit Arthaus funktioniert.
Dann schaut man dann seinen ersten Fellini und denkt La Dolce Vita, das wird doch jetzt lustig werden. Der Film ist drei Stunden und Sie sehen die Studierenden dieser neuen Anfang-20-Generation, die das noch nie gesehen haben und erwarten jetzt, dass da die Post abgeht. Das passiert halt nicht. Es gibt keine Reise des Helden, es gibt kein Reiz-Reaktionsschema, sondern das Entscheidende ist halt, unser Held, unsere Heldin lernt einfach nichts des
Das Kino der Moderne entscheidet sich sehr häufig dafür, dass unsere Protagonisten und Protagonistinnen eben nichts lernen können. Denn dass wir immer was lernen können, immer besser werden können, ist natürlich auch Ideologie und eine in Amerika besonders gern geglaubte Ideologie.
...
Die Heldenreise ist ja ein Muster, was wir vielleicht deshalb gerne sehen, weil es so absehbar ist und weil wir uns manchmal auch gerne beruhigen lassen. Das ist ja auch legitim.
Aber diese grundsätzliche Erzählung, du kannst dich eben verändern, du kannst eine andere werden, du kannst überwinden, was dir in der Vorgeschichte passiert ist, das ist natürlich ideologisch gesehen problematisch. Fangen wir mal damit an, dass in Heldenreisen ganz oft diese Backstory Wounds, also diese Verletzungen geheilt werden.
Jeder, der sich mit Therapie befasst hat, weiß, dass es nicht ausreicht, etwas zu sagen oder einmal noch zu durchleben, dass das was ganz anderes ist. Und es ist ja sogar umstritten, ob man das überhaupt heilen kann und ob nicht manchmal Verdrängung sogar die bessere Methode ist. Das ist ja nicht so eindeutig.
Das Classical Cinema erzählt dann beispielsweise unsere Hauptfigur, sagt, was ihr wieder erfahren ist und dann setzt der gedankliche Prozess ein und die Sache ist heilbar. Du kannst eine andere werden, du kannst ein anderer werden.
Und das Kino der Moderne sagt natürlich, das wollen wir nicht, das ist ja Ideologie, so funktioniert das nicht. Menschen sind eben keine Figuren. Und wenn wir über Menschen erzählen wollen und nicht nur über Figuren, dann müssen wir sie in ihrer Widersprüchlichkeit, Nichtteilbarkeit und in ihrem Nichtmusterhaften begreifen. Insofern gibt es also auch genügend Platz für das Kino, was sagt, okay, das stimmt, das ist ein tradiertes Muster,
Es funktioniert auch, aber wir müssen es eben nicht immer bedienen. Bestes Beispiel für Figuren des New Hollywood, an denen alle Therapien hoffnungslos zu verpuffen scheinen, sind die Protagonisten der Filme von Woody Allen. Musik
Woody Allen ist ein Meister darin, die
Backstory wohnt und die Geschichte so anzudeuten, dass es eine innere Reise gibt, aber in Wahrheit diese innere Reise nicht vollziehen zu lassen. Das heißt, Woody Allen gehört ja zu New Hollywood und New Hollywood zeigt ja eigentlich immer wieder das Scheitern der Wandlung des Helden der Heldin und in seinem Fall ist es das Scheitern der Wandlung. Das gelingt halt nicht. Die Figur kann sich eben nicht wirklich ändern. Sie bleibt so, wie sie ist und
Und insofern haben diese Filme dann doch was mit der Reise des Helden zu tun, weil sie sie eben verweigern und nicht bedienen. Und im komödiantischen Bereich kennen wir das doch selber auch so gut. Wir nehmen uns vor, ganz andere zu werden, aber in Wahrheit bleiben wir, wer wir sind.
Eine Ausnahme macht Woody Allens Film »Play It Again, Sam«. Hier absolviert die Hauptfigur Alan eine Heldenreise im Sinne einer Entwicklung des Protagonisten. Wenn auch mit doppeltem cineastischem Boden. Denn in dieser Komödie begegnen sich New Hollywood und Classical Cinema, Leben und Kunst.
In Gestalt des Filmkritikers Alan und seinem Vorbild Bogart, Humphrey Bogart, mit Hut und Trenchcoat, so wie ihn der Zuschauer als Rick aus Casablanca kennt. Der Held und sein Mentor. Alan ist eine Art Anti-Held, schmächtig, ängstlich und hypochondrisch, frisch verlassen von seiner Frau.
Er wird getröstet von seinem Freund Dick, einem erfolgreichen Börsenmakler. Und dessen Frau Linda. In ihr findet Alan eine Seelengefährtin. Er muss sie sehr geliebt haben, Dick. Ich fang gleich an zu heulen. Wieso fängst du an zu heulen? Ein Mann investiert etwas und geht damit baden. Ich krieg Kopfschmerzen. Hast du ein Aspirin, Alan? Er steht vor dem Nervenzusammenbruch und du wirst krank. Ist doch kein Grund, sich aufzuregen.
Ich rege mich absolut nicht auf, aber ich hatte heute einen harten Tag. Willst du auch ein Aspirin haben? Nein. Ach, die habe ich ja alle geschluckt. Wie wäre es mit Navan? Ja, das ist auch gut. Das hat mir mein Psychiater mal gegen Migräne verschrieben. Ich hatte früher auch Migräne, aber die hat mein Psychiater geheilt. Jetzt kriege ich bloß noch einen nervösen Ausschlag. Ach, ich kriege sie immer noch. Besonders schlimm, wenn ich mich aufrege. Mir kann, glaube ich, nur ein Chirurg helfen. Mit einer Gehirnoperation. Wisst ihr was? Heiratet doch und zieht zusammen ins Krankenhaus.
In Allens Tagträumen tauchen zwei Figuren auf. Seine Ex-Frau Nancy, die ihn verspottet und bemitleidet.
»Dir genügen eben Filme, weil du im Leben nur Zuschauer bist. Ich bin da anders. Ich bin ein Akteur. Ich will leben. Ich will immer dabei sein.« Und Bogart, welcher ihn, nur für Ellen sichtbar, als Berater in Liebesding zur Seite steht, auch bei der Annäherung an Linda. »Ich fühle mich wirklich beschwingt. Der Sekt steigt mir schon ganz schön zu Kopf.« »Los jetzt, Küssi.«
»Ich kann nicht.« »Sie wartet drauf.« »Wie willst du das wissen?« »Verlass dich auf mich, ich weiß es genau.« »Sie sträubt sich dagegen.« »Na siehst du denn nicht, dass sie darauf wartet. Jetzt vermassle es nicht schon wieder. So, und jetzt rutsch mal ein bisschen näher.« »Wie nahe denn?« »Stell dich nicht so dumm auf Lippenlänge.« »Das ist aber sehr nahe.« »Komm, Junge, nun mach schon.«
»Und was jetzt?« »Jetzt, jetzt sagst du ihr, dass sie irgendwas in deinem Inneren auslöst, das stärker ist als du.« »Das ist doch nicht dein Ernst.« »Los jetzt.« »Bei mir klingt das so kitschig.« »Aber sie frisst es.« »Sieh mal, Fred Astaire sieht im Frack toll aus und ich...« »Komm, bleib mit Fred Astaire vom Hals und sag jetzt endlich was.« »Ich bin am allerliebsten mit dir zusammen.« »Ich bin auch sehr gerne mit dir zusammen.«
Ich habe das einfach so. Ich wollte das mit den Auslösern und so weglassen. Ja, ja, das machst du prima, Junge. Hör zu, jetzt sag ihr, dass sie die verwirrendsten und schönsten Augen hat, die du je gesehen hast. Du hast, du hast die verwirrendsten Augen, die ich je gesehen habe, Linda. Du hast... Deine Hände zittern ja. Das macht nur deine Nähe. Wie beliebt. Das sollst du ihr sagen. Das macht nur deine Nähe. Du verstehst es aber gut, Alan.
Eine heimliche Romanze entwickelt sich. Doch als Alan mitbekommt, dass sein Freund Dick Linda wirklich liebt, bekommt er ein schlechtes Gewissen. Am Flughafen kommt es schließlich, wie in Casablanca, zum Showdown. Ich muss dir noch was sagen, bevor ihr abfliegt. Alan, ich brauche keine Erklärung, auch nicht von dir. Ich werde es aber trotzdem tun, weil es eines Tages für dich wichtig sein wird.
Du sagtest, du wüsstest, dass Linda ein Verhältnis hat. Ja. Aber du wusstest nicht, dass sie bei mir war letzte Nacht, als du sie anriefst. Sie kam als Babysitter rüber, weil ich mich einsam fühlte. Stimmt es nicht, Linda? Ja. Im Laufe der letzten Woche habe ich mich in sie verliebt und ich hoffte, dass sie meine Gefühle erwidert. Ich habe alles Mögliche versucht, aber sie sprach nur von dir. Verstehe, Ellen. Hoffentlich, Dick. Ja.
Das war großartig. Du entwickelst ja allmählich einen eigenen Stil. Ja, einen klein wenig Stil habe ich auch. Weißt du, ich glaube, du brauchst mich in Zukunft nicht mehr. Ich wüsste nicht, was ich dir noch sagen könnte, was du nicht schon weg hast. Ja, stimmt wohl. Der Witz ist, dass ich ich selbst bin und nicht du. Ich meine, du bist nicht gerade groß und keine Schönheit, aber verdammt nochmal, ich bin selbst klein und hässlich genug, um mich durchzusetzen. Na dann, Hals- und Beinbruch, Kleiner.
Ein Kinoheld als Coach? Kunst als Lebenshilfe? Im Film funktioniert es. Die Begegnung mit Joseph Campbells Werk war, und hier erging es mir genauso wie vielen anderen Menschen, eine bedeutende und prägende Erfahrung.
Einige Tage der Beschäftigung mit dem Labyrinth seines Buches »Der Heros in tausend Gestalten« bewirkten eine elektrisierende Neuorientierung meines Lebens.
Christopher Vogler ist nicht der Einzige, der in Joseph Campbells Modell der Heldenreise mehr als nur eine Erzählstruktur fand.
Wenn man mich fragt, ob man Joseph Campbell auch aufs Leben anwenden kann, dann sage ich, was habe ich denn für eine Ahnung vom Leben? Ich bin Filmwissenschaftlerin. Vom Leben weiß ich gar nichts. Ich weiß was über Figuren, aber sehr wenig über Menschen. Und wer das tun will, bitteschön, ich kann Ihnen sagen, im Film funktioniert es. Ob es im Leben funktioniert, ich weiß es nicht. Wenn die Maschine startet und du bist nicht bei ihm, wird es dir mal leid tun. Und wenn nicht heute, dann morgen oder übermorgen. Aber glaub mir, der Tag wird kommen. Oh, Alan.
Das hast du wunderbar gesagt. Das ist aus Casablanca. Ich habe meinen Lebtag darauf gewartet, es zu sagen.
Es gibt eine Art wiederkehrende und unvermeidliche Abfolge von Erfahrungen, wenn man sich aufmacht, seinem Abenteuer zu folgen. Ganz gleich, ob in der Wirtschaft, in der Kunst oder beim Spiel.
Da ist das Gefühl eines großen Potenzials. Man tappt im Dunkeln. Dann tauchen seltsame kleine Helfer auf, wie Feengeister oder Zwerge. Dann ist da das Gefühl von Gefahr, großer Gefahr, weil niemand diesen Weg zuvor gegangen ist.
Und der Wind weht und du befindest dich in einem Wald aus Dunkelheit. Joseph Campbell war nicht nur ein Mythenforscher. Er war zugleich Philosoph, Pädagoge, Psychologe, Poet und Lebenskünstler.
Und Campbell war ein Romantiker des 20. Jahrhunderts. Ein Romantiker in der Tradition eines Novales, dessen Devise, die Welt muss romantisiert werden, zielt auf eine Kunst als ganzheitliches Lebenskonzept. Eine weitere Devise von Novales lautet, der Weg geht nach innen. Mythologie sagt uns, wo du stürmst, ist dein Treue.
Mythologie lehrt uns, dass dort, wo du stolperst, dein Schatz liegt. Es gibt so viele Beispiele, wie das aus Tausend und einer Nacht. Jemand pflügt ein Feld und sein Pflug bleibt stecken. Er gräbt nach und entdeckt eine Art Ring. Als er ihn anhebt, erblickt er eine Höhle voller Juwelen.
Und so ist das auch in unserer eigenen Psyche. Unsere Psyche ist eine Höhle mit Juwelen darin. Und dort, wo es am herausforderndsten erscheint, liegt die größte Einladung, tiefere und größere Kräfte in uns selbst zu bekommen. Als ich vor 40 Jahren über den Ruf schrieb, schrieb ich aus dem heraus, was ich gelesen hatte. Jetzt, da ich ihn gelebt habe, weiß ich, dass er richtig ist.
Joseph Campbell in einem der Interviews, die der Moderator Michael Toms über zwölf Jahre hinweg für den Radiosender New Dimensions mit dem über 70-Jährigen geführt hat. Wie man einem Ruf zum Abenteuer folgt, das lässt sich auch an Campbells eigener Lebensgeschichte studieren. Musik
Als 1929 der Börsencrash und damit die große Depression in den USA einsetzte, nutzt der 25-Jährige die Zeit, um zu lesen. Fünf Jahre lang lebte er so in einer kleinen Hütte in Woodstock, ohne fließend Wasser. Campbell kam mit sehr wenig Geld aus und konnte sich als freiberuflicher Saxophonist durchschlagen.
Auf Ausflügen lernt er den Schriftsteller John Steinbeck und den Biologen Ed Rickett kennen, die ihm zu inspirierenden Freunden werden. Jedes Detail aus dieser Zeit ist in meiner Erinnerung. In Goethes wunderbarem Buch Wilhelm Meisters Lehrjahre gibt es die Idee des Aufeinanderprallens mit Erfahrungen und Leuten, während man umherzieht.
Auf diese Weise lernt man wirklich das Leben kennen. Nichts ist Routine. Nichts wird als gegeben betrachtet. Alles steht für sich selbst, weil alles eine Möglichkeit darstellt. Alles ist ein Schlüssel. Alles spricht zu dir.
Durch eine Empfehlung kommt der 30-Jährige 1934 an das Sarah Lawrence College in New York, wo er knapp 40 Jahre lang unterrichten wird. Hier lernt er auch seine spätere Ehefrau Jean Erdmann kennen, eine bekannte Tänzerin und Choreografin des zeitgenössischen Tanzes, mit der er in den 70er Jahren das Theater of the Open Eye in New York gründete.
In den 40er Jahren half Campbell Swami Nikilananda bei der englischen Ausgabe von »The Gospel of Sri Ramakrishna« und er gab die Posthumenwerke von Heinrich Zimmer heraus, einem Indologen, den Campbell als seinen Guru bezeichnete. Darunter den Klassiker »Philosophie und Religion Indiens«. Danach arbeitete er vier Jahre lang an »Der Heros in tausend Gestalten«.
Als weiteres Hauptwerk folgten in den 60er Jahren die vier Bände »The Masks of God«, »Die Masken Gottes«. »Die Masken Gottes« ist eine Reihe von Büchern, von vier Büchern. Erstmal »Die Mythen der Urzeit« und dann »Mythen des Westens« und »Mythen des Ostens« und dann noch »Die kreative Mythologie«. Damit meint er die Kunst, vor allem auch der moderne in der Literatur, aber auch bildende Kunst.
Und das war eine Reihe, wo er eigentlich ganz anders als in allen anderen Büchern und in seinen Vorträgen einmal ganz ausführlich die Geschichte historisch dargestellt hat. Das ist natürlich immer noch relativ wenig, obwohl es etliche hundert Seiten sind und er wurde auch dafür stark kritisiert.
Aber es war eigentlich der erste Versuch, den es gibt, die Weltmythologie einmal ganz historisch darzustellen über alle Zeiträume und Kulturen, ähnlich wie der Mircea Eliade das mit seiner Geschichte der Religionen gemacht hat. Und insofern war das auch ein wichtiger Schritt, dass man einmal die Weltmythologie,
Mythen nicht vergleicht interkulturell, sondern wirklich ganz ausgeht entlang der Historie, entlang der geschichtlichen Entwicklung. Also Joseph Campbell ist mir in meiner Ausbildung tatsächlich, also in meinem Studium tatsächlich nicht begegnet. Er war nicht Gegenstand der Seminare oder so, aber Personen, auf die er sich bezieht. Also zum Beispiel Carl Gustav Jung, das war auch Teil meines Studiums.
Also ein Begriff, würde ich sagen, ist er auf jeden Fall. Er ist bekannt. Er ist aber im religionswissenschaftlichen Diskurs nicht mehr als ein, wie soll man sagen, ernstzunehmender Theoretiker anerkannt. Also seine Theorie vom Monomythos zum Beispiel, das wäre eher ein Gegenstand der Forschung und als solche sehr interessant.
aber nicht als eine Theorie, mit deren Hilfe man jetzt versucht, Forschungsgegenstände zu beschreiben. In der Wissenschaftsszene ist es immer noch gespalten. Joseph Campbell wird relativ selten zitiert, aber es gibt durchaus Autoren, die eine große Aufgeschlossenheit zeigen. Und in den USA wird es ohnehin nicht ganz so stark getrennt. Es gibt ja das Pacifica Graduate Institute,
in Santa Barbara in Kalifornien, wo man auch Mythologie studieren kann, wo Campbell eine bemerkenswerte Rolle auch spielt und auch geschätzt wird von den Dozenten dort und von den Studenten. Ich
Ich glaube, in Kalifornien und überhaupt an der Westküste, da gibt es eine viel größere Durchdringung dieser beiden Bereiche, also des Esoterischen sozusagen oder das, was so ein bisschen verächtlich oft als New Age bezeichnet wird. Das gibt es dort als innere Reise, als erfahrungsorientierte Psychologie und es gibt den akademischen Bereich der seriösen historischen Mythenforschung. Dort wird eigentlich beides praktiziert und
Und die Menschen haben eigentlich weniger Probleme damit, als es teilweise bei uns noch üblich ist.
Eine Universitätslaufbahn kam für Joseph Campbell ohnehin nicht in Frage. Er wollte lieber frei sein in seiner Betrachtungsweise, aus der Vogelperspektive herausschreiben, ohne die akademischen Fesseln von Fußnoten. Für ihn bestand eine der grundlegenden Funktionen des Mythos darin, als eine Art Reiseführer zur, wie er es nannte, Glückseligkeit zu dienen. Es gibt zwei Möglichkeiten, ein mythologisch fundiertes Leben zu führen.
»Der eine Weg ist der, den ich den Weg des Dorfes nenne, bei dem man in seinem Umfeld bleibt. Das kann ein kraftvolles und edles Leben sein. Es gibt jedoch Menschen, die meinen, dass dies nicht alles sein kann. Wenn ein Mensch jedoch den Ruf vernommen hat, das Gefühl, dass ein Abenteuer auf ihn wartet und dem nicht folgt, dann trocknet das Leben aus.«
Und dann kommt er gen Ende der Lebensmitte zur Einsicht, er hat die Spitze der Leiter erreicht und dabei erkannt, dass sie an der falschen Wand steht. Es gibt einen wunderbaren Aufsatz von Schopenhauer, in dem er darauf hinweist, dass in einem bestimmten Alter, dem Alter, in dem ich mich jetzt befinde, man beim Rückblick auf sein Leben den Eindruck haben kann, dass es so strukturiert ist wie ein Roman.
Und so wie in Dickens Romanen sich kleine zufällige Begegnungen als wichtige Wendepunkte herausstellen, so ist es auch im Leben. Was zunächst wie ein Fehler aussieht, entpuppt sich im Nachhinein als richtungsweisende Krise. Und dann fragt Schopenhauer, wer hat diesen Roman geschrieben? Das Leben scheint geplant zu sein. Und es gibt etwas in uns, das das verursacht, was man als unfallträchtig bezeichnet. Das ist ein Mysterium.
Schopenhauer stellt schließlich die Frage, kann einem etwas zustoßen, auf das man nicht vorbereitet ist? Ich blicke heute auf bestimmte Ereignisse zurück, die mir damals als echte Katastrophen erschienen, die sich aber im Nachhinein als die Gestaltung eines wirklich großartigen Aspekts meines Lebens und meiner Karriere herausstellten. Wenn du deiner Freude folgst, wirst du deine Freude haben, ob du Geld hast oder nicht.
Wenn du dem Geld folgst, verlierst du vielleicht das Geld und dann hast du nicht einmal das. Der sichere Weg ist in Wirklichkeit der unsichere. Und der Weg, auf dem sich der Reichtum der Suche ansammelt, ist der richtige. Wenn man aber den Mut hat, dem Risiko zu folgen, dann öffnet sich das Leben. Ich bin nicht abergläubisch, aber ich glaube an spirituelle Magie, könnte man sagen. Ich glaube, wenn man dem folgt, was ich Glückseligkeit nenne, dann ist das Leben.
Das, was einen wirklich berührt, dann öffnen sich die Türen. In meinem Leben haben sie sich geöffnet und in vielen anderen Leben ebenso. Follow your bliss. Das war die Devise von Joseph Campbell. Was man mit Folge deiner Freude oder mit Folge deiner Bestimmung nur vage übersetzen kann. Folge deiner Glückseligkeit trifft es eher. In Anlehnung an die Sanskrit-Worte Sat Chit Ananda.
Sein Wissen Glückseligkeit oder auch sein Bewusstsein Freude. Das ist laut indischer Philosophie die Essenz Gottes, die Essenz der Weltenseele und damit zugleich die Essenz jeder einzelnen Menschenseele. Ein heldenhaftes Leben zu führen heißt, dem Ruf dieses Mysteriums zu folgen.
Bis heute inspiriert Joseph Campbell und seine Heldenreise Menschen rund um den Globus. In Deutschland liegt zur Zeit nur der Heros in tausend Gestalten in Übersetzung vor, aber die Joseph Campbell Foundation wird auch weitere Bücher wieder veröffentlichen und es gibt eine Community, die dafür zugänglich ist.
Ich habe ja 25 Jahre für die Campbell Foundation gearbeitet und auch international mich ausgetauscht mit Menschen in aller Welt, hauptsächlich natürlich in den USA, aber auch in Südamerika, auf allen Kontinenten, in Südafrika, aus Indien. Wir hatten in Indien eine Gruppe, die sich im Namen von Joseph Campbell getroffen hat. Das heißt, es gibt überall dieses Bedürfnis,
an die eigene mythische Tradition anzuknüpfen. Und da ist manchmal der fremde Blick dienlich und genauso wie Joseph Campbell in der deutschen Kultur bei Goethe und bei Wolfram von Eschenbach und Heinrich Zimmer und vielen anderen Schriftsteller,
seine eigene Stimme gefunden hat. Genauso ist es heute für uns wichtig, den Blick von außen wahrzunehmen. Und ich glaube, deshalb ist Campbell, weil er eben ein Amerikaner ist und weil er auch ein Außenseiter ist, sowohl in der Unterhaltungsindustrie als auch in der akademischen Welt, jemand, der einen Blick von außen bringen kann und dadurch uns auf Dinge stoßen kann, die wir vielleicht übersehen haben, weil wir zu nah dran sind.
Für mich ist die Heldenreise mittlerweile ein elementarer Bestandteil meines Lebens geworden. Ich weiß, ich befinde mich in einer Heldenreise, in der nächsten Heldenreise, an mehreren Heldenreisen gleichzeitig. Für mich ist das wie geführt werden. Geführt werden vom großen Ganzen von Gott oder wie auch immer man den Autor oder die Autoren dieser Heldenreise bezeichnen möchte. Die Heldenreise ist für mich...
das Leben selbst, der Wandel selbst und immer wieder neu geboren werden. Michael Dahl ist freiberuflicher Coach und Gründer eines Coaching-Zentrums in Potsdam. Das Wichtige bei der Heldenreise ist, dass man sich nicht vornehmen kann, eine solche Heldenreise anzutreten, sondern eigentlich wird die Heldenreise erst zu einer solchen, wenn einen das Lebensschicksal dazu verschlägt, dass man sich
Eine Situation stellen muss, die man so eigentlich noch gar nicht gekannt hatte. Wenn ich von vornherein einen Plan habe, wie das Ganze durchläuft, wie ich mich verhalten möchte, was ich bewirken möchte, welche Ziele ich habe, dann ist es am Ende keine Hildenreise, sondern dann ist es vielleicht eher so etwas, was man im Management ein klassisches Projekt bezeichnen würde.
Zur Heldenreise wird das erst, wenn ich vor einer Situation stehe, in der mir meine aktuellen Mittel nicht mehr helfen, sie zu lösen, sondern ich auf Fähigkeiten zurückgreifen muss, die ich bisher noch gar nicht in mir gefunden habe. Und das ist genau dieser Initiationsprozess.
30 Jahre lang war Michael Dahl als Unternehmensberater in verschiedenen Konzernen tätig, bis er in einen schweren Burnout geriet. Das war 2010, als ich als Geschäftsführer einer großen Unternehmensberatung unten in Schwaben zurückgekommen bin nach Berlin und zwar in einem sehr schweren Burnout.
Und ich bin dann in Berlin in den Buchladen gegangen, auf der Suche nach Büchern, die einem helfen, aus diesem Burnout wieder rauszukommen. Und da bin ich Joseph Kimbles' Heros in tausend Gestalten begegnet. Das Buch hat mich fast im Buchgeschäft angestrahlt, sodass ich gar nicht umhinkam, mir dieses Buch mitzunehmen. Und das hat mich von den ersten Seiten auf relativ schnell gepackt.
Ich habe dann lesen können und nachempfinden können, dass nicht nur jedes Märchen und jeder Epos eine Heldenreise ist, sondern dass ich mich selbst sehr tief in einer solchen Heldenreise befinde und dass die vielen Symboliken, die einem in dieser Phase des Burnouts auftauchen, nichts weiter sind als die symbolischen Fabelgestalten, die man dann auch in den großen Mythen dieser Welt findet.
Nachdem ich die Heldenreise dann kennengelernt habe, habe ich angefangen, bestimmte Lebensphasen, die ich halt durchgemacht habe, anhand dieser Heldenreise zu reflektieren. Auch eben die Krisen, die man da durchmacht. Und Krisen sind immer Heldenreisen. Und habe erkannt, dass jede Krise am Ende einen wichtigen Ausklang gefunden hat. Nämlich eine Veränderung in meiner eigenen Persönlichkeit. Etwas, was man während der Krise so für sich gar nicht reflektieren kann und auch gar nicht reflektieren mag.
Aber diese Erkenntnis, dass jede Krise, eben auch der Burnout, und davon hatte ich ein paar gehabt im Laufe meines Lebens, dass das immer in eine Art von Happy Ending führt, in Form einer Weiterentwicklung der eigenen Persönlichkeit. Das hat mich dann zur Erkenntnis gebracht, dass eigentlich auch alle Krisen, die zukünftig auf mich zukommen werden oder die, denen ich mich gerade befinde, wahrscheinlich ebenso diesem Heldenreisenmuster entsprechen. Was mir ab diesem Zeitpunkt immer noch,
die Angst davor nimmt vor Veränderungen, die Angst vor Krisen, sondern im Gegenteil, ich suche fast schon Veränderungen und Krisen, weil ich weiß, dass das die notwendigen Auslöser dafür sind, sich in etwas weiterentwickeln zu können, was man nie geworden wäre, wenn man die Krisen nicht durchgemacht hätte. Als ich mich 2011 selbstständig gemacht hatte in Berlin,
hatte ich keine Kunden gehabt. Und die ersten Anstellungen, die ich bekommen hatte als Freiberufler, waren über das Jobcenter im Rahmen von Maßnahmen für Langzeitarbeitslose. Und die Langzeitarbeitslosen, das waren Damen und Herren, die schon seit fünf oder zehn, vielleicht sogar 20 Jahren keine Arbeit mehr gehabt haben. Dementsprechend war die Stimmung sehr gedrückt. Und das ist dann sehr häufig so ein Lichtblitz, der im eigenen Leben auftaucht, dann
wo man erkennt, dass man eigentlich in einer tiefen Krise ist, in die man im Heldenreisenschritt hineingekommen ist, dann aber auch die Hoffnung hat, da auch wieder rauszukommen. Musik
Eine im Jahr 2023 im Journal of Personality and Social Psychology veröffentlichte Studie bestätigt, dass die Betrachtung des eigenen Lebens aus dem Blickwinkel der Heldenreise zu mehr Wohlbefinden und Widerstandsfähigkeit führen kann. Unsere Forschung führt zu zwei wichtigen Erkenntnissen. Erstens zeigt sie, dass unsere Lebensgeschichten nicht nur ein Spiegel unseres Lebens sind, sondern auch die Art und Weise prägen, wie wir es wahrnehmen.
Es gibt zwar Grenzen, wenn man seine Lebensgeschichte umgestalten will, aber wenn man sich mit starken Geschichten identifiziert und sie auf sein eigenes Leben anwendet, kann man seine Erfahrungen mit einem größeren Sinn verbinden. Wir haben die Macht, eine bessere Lebensgeschichte zu gestalten, indem wir auf Erzählformen zurückgreifen, die wir instinktiv kennen und die mit unseren Werten übereinstimmen.
Zweitens zögern die Menschen oft aus verschiedenen Gründen, sich selbst als Helden zu sehen, aber das könnte eine verpasste Gelegenheit sein. Ein Held zu sein, kann viele Formen annehmen. Und zu erkennen, wie man in seiner eigenen Geschichte ein Held ist, kann psychologische Vorteile bringen, ohne dass man sich als unecht oder übermäßig egozentrisch fühlt.
wenn man sich als epischer Held sieht, erklärt Studienautor Benjamin Rogers vom Boston College. Aber natürlich gäbe es auch Grenzen, räumt Rogers ein. Wir erkennen an, dass es wahrscheinlich Grenzen gibt, wer seine Geschichte in diesem Rahmen sehen kann. Insbesondere diejenigen, die sich in wirklich schwierigen Lebenssituationen befinden, haben vielleicht nicht das Gefühl, dass die Elemente der Heldenreise in ihrem Leben präsent sind.
Das Schwierige an der Heldenreise ist, dass man den Ausklang nicht kennt. Also in dem Moment, in dem eine Veränderung passiert, der ich mich stellen muss, in deren Sog ich gezogen werde, aber ich weiß nicht, wie die Welt nach der Veränderung aussehen wird, wo ich nicht weiß, wie es mich verändert, das ist die Essenz der Heldenreise. Das Leid, was man erfahren hat, das wird dadurch nicht geschmälert, aber...
Es wird in die eigene Geschichte mit eingebettet als wichtiger, notwendiger Schritt, um diesen Wandel für sich abzuschließen und in der Zukunft Fähigkeiten zu haben, um ähnlichen Situationen anders entgegenzutreten. Musik
Im Jahr 1968 war ich 37 Jahre alt. Ich hatte ein eigenes kleines Theaterensemble. Ich war Regisseur, Produzent und Direktor in einer Person. Ich hatte den Traum meiner Jugend verwirklicht.
»An diesem Abend spielte ich den Prinzen in dem Stück »The Sleeping Prince« von Terence Rattigan. Meine Hauptdarstellerin hatte gerade eine Pointe gebracht, also ließ ich den ungefähr 2000 Menschen im Publikum eine kurze Lachpause. Plötzlich kam mir ein erschreckender Gedanke. Was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Das war kein geeigneter Moment für solch einen Gedanken. Hier stand ich vor 2000 Menschen und wartete auf einen Lacher,
»War es das wirklich, was ich mir von meinem Leben erwartete?« »In diesem Augenblick verabschiedete sich ein wesentlicher Teil von mir für immer vom Theater.« »Ich war genug Profi, um das Stück zu Ende zu spielen, aber etwas hatte sich unwiderruflich verändert.« »Nach diesem Abend brach ich zu einer stürmischen Reise der Selbstfindung auf.«
Diese Reise sollte für mich durch eine äußerst beunruhigende Phase führen, durch eine Phase, die unsere Gesellschaft, da sie keinen genaueren Begriff dafür hat, einen Nervenzusammenbruch nennt und die mein Freund Stan Groff als spirituelle Krise bezeichnet. Emotionale, psychologische und mythische Eindrücke brachen über mich herein und katapultierten mich in eine fremde, manchmal erschreckende Welt, über die ich keine Kontrolle hatte.
Aber es gelang mir, von dieser Reise durch den Wahnsinn Wissen mitzubringen und den Kern des Materials, aus dem dann später die Heldenreise wurde. So berichtet Paul Rebello in seinem Buch »Die Heldenreise – Das Abenteuer der kreativen Selbsterfahrung«.
Der Schauspieler begegnete noch im selben Jahr Joseph Campbell am Asselin Institute in Big Sur, Kalifornien. Hier war der Mythologe zu einem Vortrag eingeladen worden über Schizophrenie.
Campbell erkannte im schizophrenen Zusammenbruch eines Menschen wiederum die Muster einer Heldenreise. Eine nach innen und zurückführende Reise, um etwas Versäumtes nachzuholen oder etwas Verlorenes wiederzugewinnen, um das Leben wieder ins Lot zu bringen. Statt die Psychose im Frühstadium zu unterdrücken, plädierte Campbell in seinem Vortrag dafür, »Wir sollten den Reisenden gehen lassen«.
Er hat den Sprung getan und sinkt nun. Vielleicht ertrinkt er, doch wie in der alten Sage von Gilgamesch und seinem langen, tiefen Hinabtauchen auf den Grund des Weltenmeeres, um dort das Wunderkraut der Unsterblichkeit zu pflücken, so liegt auch bei ihm das grüne Gold seines Lebens dort unten. Man darf ihn nicht davon wegreißen, sondern muss ihm dahin verhelfen.
Aus der Begegnung mit Campbell und seiner Heldenreise entwickelte Rabelow das Konzept, Mythen nicht nur zu lesen, sondern nachzuerleben, sie zu inszenieren, gemeinsam mit anderen, eine gestalttherapeutische Gruppentherapie.
Also es gibt verschiedene Formate, die sich diese Struktur von Joseph Campbell zunutze machen und das umsetzen. Die sind sozusagen unterschiedlich tief, kann man sagen. Also sie variieren hinsichtlich ihres Blicks auch auf den Körper und wie sie ja zum Beispiel der Körper auch Teil des therapeutischen Geschehens sind.
Das hängt natürlich so ein bisschen auch vom therapeutischen Paradigma ab, von dem man da jeweils ausgeht. Die Religionswissenschaftlerin Stefanie Grebendruck-Schädel hat die Heldenreise als therapeutische Methode untersucht.
Und dabei besonders die religiösen Aspekte der zeitgenössischen Coaching- und Therapieszene in den Fokus genommen. Also so gibt es zum Beispiel die Bibliotherapie, die eben vor allem mit Texten arbeitet, also mit Textvorlagen, also wo sich KlientInnen selber ein Buch aussuchen können, das eben eine konkrete Beziehung,
Umsetzung auch dieses Motivs der Heldenreise darstellt und dann ihre Geschichte, ihre persönliche Geschichte, ihre Lebensgeschichte in Bezug setzen zur Erzählung, die da gelesen wird. Und das ist eben ein bibliotherapeutischer Ansatz, das gibt es zum Beispiel. Dann gibt es im Coaching-Bereich zahlreiche Varianten der Umsetzung der Heldenreise,
Eine zum Beispiel ist die systemische Heldenreise. Also das Format, wo sozusagen die Heldenreise die tiefste Umsetzung findet, ist eben dann das Gestalttherapeutische. Da zum Beispiel ist auch der spirituelle oder religiöse Aspekt am bedeutsamsten und wird am intensivsten auch mitbedacht im therapeutischen Geschehen.
Ursprünglich dazu gedacht, Ärzten und Schwestern in psychiatrischen Einrichtungen Einsicht in die Welt ihrer psychotischen Patienten zu ermöglichen, entwickelte sich die gestalttherapeutische Heldenreise schnell zu einer Gruppentherapie auch außerhalb des klinischen Bereichs weiter und ist seit rund drei Jahrzehnten auch in Europa angekommen. So eine Gruppentherapie
Gestalt therapeutisch geprägte Heldenreise ist eine Angelegenheit, die sich auf jeden Fall über mehrere Tage erstreckt.
Also im Durchschnitt ist es aber eher auf drei Tage ungefähr angesetzt und beinhaltet eben unterschiedliche Phasen, die diesem Schema der Heldenreise, so wie Paul Rebillot das beschrieben hat in seinem Buch, dann eben auch entsprechen und dieses Schema nachvollziehen. Das heißt...
Ein wichtiger Schritt besteht darin, dass man die Heldenfigur zunächst mal aufbaut. In dem Sinne, dass man therapeutisch daran arbeitet, was ist denn für mich heldenhaft? Also was sind zum Beispiel auch, was sind Figuren aus meiner Kindheit, die ich als heldenhaft gesehen habe? Wie hat sich meine Vorstellung vom Heldenhaften verändert auch im Zuge des Erwachsenwerdens? Und das Wichtige ist, dass man diese Figur dann nicht nur verwendet,
Und das ist das, was ich mir als Frau vorgestellt habe.
Also das ist ein ganz wichtiger Teil des Prozesses, diese Figur aufzubauen, die einen dann ja eben auch stark macht. Also die gestalttherapeutische Version der Heldenreise ist als Gruppentherapie tatsächlich gedacht. Also es ist auch ganz entscheidend, dass das als Gruppe vollzogen wird, wobei es natürlich Teile in diesem Prozess gibt, die man alleine vollzieht. Also wenn man seine Heldenfigur aufbaut, macht man das natürlich erst mal für sich selbst.
Aber es geht dann zum Beispiel auch darum, dass man sich als Held, der man geworden ist, der Gruppe dann auch zeigt. Und auch die Gruppe darauf reagiert, auf die Figur, die man geworden ist. Also die Gruppe hat eine ganz entscheidende Rolle in dem ganzen Prozess.
Und für Paul Ribiot war das tatsächlich auch so eine Art ritueller Kreis. Zusätzlich zu ihrer Lehrtätigkeit hat Stefanie Griependruck-Schädel eine zweite Ausbildung zur Beraterin gemacht. Die Heldenreise war Teil dieser Ausbildung. Und das stand unter der Überschrift, dass man sich eben auseinandersetzen sollte, auch mit dem, was man als den eigenen Schatten vielleicht beschreiben könnte.
Also die Auseinandersetzung eben mit Teilen auch der eigenen Persönlichkeit, die man vielleicht nicht so gerne haben möchte oder die man ganz gerne auch mal abspaltet. Also unter dieser Überschrift haben wir damals in der Ausbildung diese Heldenreise über drei Tage gemacht. Und ich fand das eine sehr, sehr intensive und großartige Erfahrung. Ich glaube, wie erwähnt, man muss der Typ dazu sein. Also man muss zum Beispiel sehr gut auch...
sich Dinge vorstellen können, weil sehr viel eben mit kreativer Trance gearbeitet wird. Also dass man in Bilderwelten, in innere Bilderwelten hineingeführt wird. Und mir hat das wahnsinnig Spaß gemacht und ich habe da ganz viel gesehen und erleben können. Und aber anderen in meiner Gruppe zum Beispiel, denen ist das gar nicht geglückt. Also die konnten keine solche inneren Bilder aufbauen und dann ist es natürlich auch schwieriger, so einen Prozess zu durchlaufen.
Also für mich war das ein sehr einschneidendes Erlebnis, würde ich sagen. Und ich habe auch Lust, das noch einmal wieder zu machen. Paul Rebelow ist als Therapeut von dem Konzept der Heldenreise überzeugt. Nachdem sie die Heldenreise durchlebt haben, stellen viele Menschen fest, dass sie das Muster des Übergangs erkennen.
Wenn dann in Ihrem Leben unvermeidliche Veränderungen bevorstehen, fühlen Sie sich davon nicht länger bedroht. Sie wissen, dass die Veränderung einem bestimmten Ablauf folgt. Sie haben eine Karte.
Also das Besondere an der Heldenreise, wie sie eben in der Gestalttherapie umgesetzt wird, ist sicherlich der spirituelle oder auch religiöse Aspekt. Das ist etwas, was tatsächlich auch auf Joseph Campbell selber zurückgeht, für den die Heldenfigur eigentlich eine zutiefst spirituelle Beziehung
Also auch das, was die Heldenfigur erlebt, die Prozesse, die die Heldenfigur durchläuft, sind Prozesse, die letzten Endes an das Sakrale rühren, an das Größere, an das Große Ganze. Und so ist es eben auch dann in der gestalttherapeutischen Umsetzung der Heldenreise, wo der spirituelle Aspekt ein ganz entscheidender Aspekt ist. Also Paul Rebillot schreibt in seinem Buch, es ist eigentlich das, worum es sich letzten Endes dreht.
Das ist konstitutiver Bestandteil. Es wird auch gesagt, das ist das, wovon die Heilung ausgeht letzten Endes.
Was genau das Spirituelle daran sei, das ließ Paul Rebillot offen. Er folgte keiner bestimmten religiösen Richtung, so wie Joseph Campbell auch. Für ihn waren alle Vorstellungen und Konzepte Gottes als Maskierungen eines Mysteriums zu verstehen. Eines Mysteriums, das sich jeder Verbildlichung und Versprachlichung entzieht.
Nach althergebrachter christlicher Denkweise dürfen wir uns nicht mit Jesus identifizieren. Wir sollen ihn nachahmen. Aber zu sagen, ich bin Gott, wie Jesus sagte, gilt als Blasphemie.
Im Thomas-Evangelium sagt Jesus jedoch, Wer von meinem Mund trinkt, wird werden wie ich. Ich selbst werde zu ihm werden,
Und was verborgen ist, wird sich ihm offenbaren. Das ist Buddhismus. Wir alle sind Manifestationen des Buddha-Bewusstseins, nur wissen wir es nicht. Und das Wort Buddha bedeutet derjenige, der aufgewacht ist, der zu der Tatsache aufgewacht ist, dass er Buddha-Bewusstsein ist. Und das sollen wir alle tun.
unseren Jesus in uns erwecken. Das ist die Essenz des Gnosticismus und des Thomas-Evangeliums. Und der Himmel und das gewünschte Ziel der meisten Menschen ist in uns? Alle Götter, alle Himmel, alle Welten sind in uns.
Sie sind vergrößerte Träume. Und Träume sind bildliche Manifestationen der Energien des Körpers. Energien, die miteinander in Konflikt stehen. Und das ist es. Der Mythos ist eine Manifestation symbolischer Bilder, metaphorischer Bilder der Energien in uns. Energien, die miteinander in Konflikt stehen.
Wobei wir wieder bei jenem Zentrum wären, das Campbell in seiner Heldenstudie den Weltnabel nennt. Ein Bild für die Quelle allen Seins, die transzendente Kraft, die in allem lebt und webt, die Fülle des Guten wie des Bösen beinhaltend. Es geht um Bewusstwerdung der eigenen unbewussten Anteile, um das Erkennen wiederkehrender Muster, um das Blicken hinter das Geschehen.
Campbell zitiert in der Heros in tausend Gestalten eine Geschichte der Yoruba in Westafrika über den Gott Echu. Zwei Menschen waren einmal Freunde. Echu sah es. Echu sagte...
»Diese beiden sind die besten Freunde. Diese beiden werde ich auseinanderbringen, und damit wird ein guter Anfang für ein ganz großes Idja, ein Rechtsfall, ein Palaver gegeben sein.« Die beiden Freunde hatten ihre Felder nebeneinander, ein Weg führte zwischen beiden hindurch.
Als Etschu nun den Streit beginnen wollte, machte er sich eine Mütze aus grünem, schwarzem, rotem und weißem Stoff, sodass sie von jeder Seite betrachtet eine besondere Farbe zeigte. Die Farben bezeichnen die vier Himmelsrichtungen. Etschu ist also eine Personifikation des Mittelpunktes, der Axis Mundi oder des Weltnabels. Diese Mütze setzte er eines Morgens auf, als er sich auf den Weg durch die Felder machte.
Beide Freunde arbeiteten auf ihren Feldern. Sie sahen einen Augenblick auf. Etchu rief ihnen einen Gruß zu. Die Freunde antworteten und arbeiteten dann sogleich weiter. Nachher gingen die beiden Freunde gemeinsam nach Hause. Der erste sagte, »Er hatte heute nicht eine schwarze, sondern eine weiße Kappe auf.« Der andere sagte, »Du musst blind sein, oder hast du geschlafen? Er hatte eine rote Kappe auf.« Der erste sagte, »Ich habe eine weiße Kappe auf.«
»Du musst heute Morgen schon Palmwein getrunken haben.« Der eine zog sein Messer und schlug auf den anderen ein. Der andere bekam eine Wunde. Er zog sein Messer und schlug es dem einen über den Kopf. Ed Schuwe war inzwischen zum König der Stadt gegangen. Er sagte zum König, »Frage doch nur einmal die beiden Freunde, was sie haben. Sie haben sich die Köpfe mit Messern blutig geschlagen.« Die beiden Freunde wurden gerufen.
Nachdem sie ihre gegenseitigen Anschuldigungen vor dem König wiederholt hatten, gab Edschu sich zu erkennen. Der König fragte, wer kennt den alten Mann? Edschu zog seine Mütze hervor und sagte, ich habe diese Mütze aufgesetzt. Jeder sah mich auf seiner Seite anders. Die beiden Freunde mussten sich streiten. Das habe ich getan. Streit verbreiten ist meine größte Freude. Musik
In Pathways to Bliss – Mythology and Personal Transformation, einem Buch, das auf Campbells späten Vorträgen basiert, schreibt er über Künstler und den Monomythos. Künstler sind magische Helfer. Indem sie Symbole und Motive hervorrufen, die uns mit unserem tieferen Selbst verbinden, können sie uns auf der heroischen Reise unseres eigenen Lebens helfen.
Der Künstler soll die Gegenstände dieser Welt so zusammenstellen, dass wir durch sie jenes Licht erfahren, jenes Strahlen, das das Licht unseres Bewusstseins ist. Die Reise des Helden ist eines der universellen Muster, durch die dieses Strahlen hell zum Vorschein kommt. Ich glaube, dass ein gutes Leben eine Heldenreise nach der anderen ist. Immer wieder wird man in das Reich des Abenteuers gerufen, man wird zu neuen Horizonten gerufen.
Jedes Mal steht man vor demselben Problem. Wage ich es? Und wenn man es dann wagt, gibt es die Gefahren, die Hilfe, die Erfüllung oder das Fiasko. Es gibt immer die Möglichkeit eines Fiaskos, aber es gibt auch die Möglichkeit der Glückseligkeit.
Der Held ist letztendlich jemand, der ähnlich wie der Mystiker aus dem Traum oder der Verschleierung erwacht, indem er seine höhere Bestimmung erkennt.
Und es gibt ein sehr schönes Zitat von seiner Frau Jean Erdmann, das Campbell immer benutzt hat, wenn er über die Kunst und den Künstler gesprochen hat. Dann hat er immer damit angefangen, dass Jean, die Choreografin und Tänzerin, gesagt habe, der Unterschied zwischen dem Künstler und dem Mystiker ist, dass der Künstler ein Handwerk hat. Also als Handwerker, als jemand, der an den sinnlichen Dingen arbeitet,
gelangt er letztendlich zu denselben Erkenntnissen oder spielt mit denselben Einsichten, die auch der Mystiker oder der Erleuchtete hat. Und wer weder Mystiker noch Künstler ist, dem empfahl Campbell das, was er selbst auch tat. Lesen, lesen, lesen. Das war mein Hauptberuf, das Lesen. Ich erinnere mich, dass Alan Watts mich einmal fragte, Joe, wie meditieren Sie? Ich sagte, ich meditiere, indem ich Sätze unterstreiche.
Ich bevorzuge den schrittweisen Weg, den Weg des Studiums. Ich habe das Gefühl, dass sich mythische Formen im Laufe des Lebens allmählich offenbaren, wenn man weiß, was sie sind und wie man auf ihr Auftauchen achten kann. Meine eigene Einweihung in die mythischen Tiefen des Unbewussten geschah durch den Verstand, durch die Bücher.
Kempel hat mal geantwortet auf die Frage nach seiner eigenen spirituellen Disziplin oder Yoga-Disziplin. Das ist das Anstreichen von Sätzen in Büchern. Das war natürlich ein bisschen ironisch, die Anspielung in Bezug auf seine Gelehrtentätigkeit, die eben nicht ein bloßer akademischer Gelehrtenstatus ist, sondern immer diesen Lebensbezug hat.
Aber er wäre sehr stark auch beeinflusst durch die fernöstlichen Religionen, vor allem der Buddhismus mit seiner Vorstellung der Leerheit. Und dann hat der Hinduismus eine große Rolle gespielt, die hinduistische indische Götterwelt, wie sie ja bei Heinrich Zimmer, seinem großen Lehrer, dem Indologen, eine Rolle spielt. Die hat ihn sehr bewegt.
weil die indischen Mythen in sehr einfachen Mythen und ein sehr einfacher volkstümlicher Sprache nachvollziehbar macht, wovon die Mythen und die Mystik letztlich auch in ihrer letzten Erkenntnis handeln. Und er hat gesagt, im Indien und im Hinduismus ist eigentlich schon 900 Jahre vor Christus klar gewesen, was wir erst heute erkennen, dass nämlich im Grunde genommen in der Psyche und im Geiste
der eigentliche Ursprung des Mythos ist und in aller Götter, die in unserem Geist und in unserer eigenen Psyche zu Hause sind, wir deshalb in uns gehen müssen, um die zu erkunden. Also nicht so sehr als Fakten in der äußeren Wirklichkeit, sondern in unserer eigenen geistigen, psychischen Wirklichkeit. Das ist alles dort vorweggenommen.
Sigmund Freud verweist in seinen Schriften auf die große Bedeutung der Übergänge und Schwierigkeiten in der ersten Hälfte des menschlichen Lebenszyklus, unserer Kindheit und Jugend, wenn unsere Sonne sich im Aufstieg zu ihrem Zenit befindet. C.G. Jung betont dagegen die Krisen der zweiten Lebenshälfte, in der die strahlende Sonnenscheibe ihren Abstieg hinnehmen und schließlich im dunklen Schoß des Grabes verschwinden muss.
Die üblichen Symbole unserer Wünsche und Ängste verkehren sich während dieses Nachmittags unserer Lebensgeschichte in ihr Gegenteil. Denn nun bildet nicht mehr das Leben, sondern der Tod die eigentliche Herausforderung. Wir vollenden einen vollen Kreis. Vom Grab des Mutterschoßes zum Schoß des Grabes.
Ein ambivalenter, rätselhafter Ausflug in eine Welt aus fester Materie, die uns bald wieder zerrinnen wird wie der Stoff eines Traumes. Im Rückblick auf einen Lebensweg, der unser ganz eigenes, unvorhersagbares und gefahrvolles Abenteuer zu sein versprach,
So hatte Joseph Campbell in »Der Held in tausend Gestalten« geschrieben. »Das Leben, eine göttliche Tragikomödie«. Joseph Campbell nahm es mit Humor. Auch Alter und Krankheit und nahenden Tod.
Seine beiden Biografen, Stephen und Robin Larson, die bis zuletzt engen Kontakt zu den Campbells hatten, hielten einige Campbellsche Bonmos in ihrer Biografie fest. Sie wissen, dass sie älter werden, wenn man alle Antworten kennt, aber niemand die Fragen stellt. Das Leben gleicht einem Geiger, der versucht, ein Solo vorzutragen, noch während er die Noten und sein Instrument studiert. Musik
Das Alter ist wie ein altes Auto. Der Kotflügel ist verbeult, ein Scheinwerfer geht kaputt, die Stoßstange fällt ab und man muss sie einfach loslassen. Trauern Sie, wenn eine Glühbirne durchbrennt? Es ist das Licht, die Energie dahinter, nicht die Glühbirne, die zählt. Musik
Mit Anfang 80 plagten Joseph Campbell immer wieder gesundheitliche Probleme. Dennoch ging er seinen Pflichten nach, reiste unermüdlich von seinem Alterswohnsitz auf Hawaii, der ursprünglichen Heimat seiner Frau Jean, zu Vorträgen und Interviews. Mit Grateful Dead veranstaltete Campbell 1986 noch eine Konferenz mit dem Titel »Ritual and Rapture from Dionysus to the Grateful Dead«.
Im Sommer 1987, wenige Wochen vor seinem Tod, erhielt er dann die Diagnose Speiseröhrenkrebs. Diese Körper, die vergänglich heißen, gehören dem, was ewig ist, dem verkörperten Selbst, das unzerstörbar und unermesslich ist. Im herannahenden Tod sah er sein größtes Abenteuer. Sein innigster Wunsch, ihm bewusst und wach begegnen zu können, sollte in Erfüllung gehen.
Am 30. Oktober 1987 war er nach einem längeren Krankenhausaufenthalt zur Palliativbehandlung nach Hause entlassen worden. Campbell wollte sich jedoch nicht ausruhen, trotz großer Schwäche. Er stand auf, um zum Schreibtisch zu gehen und in dem Moment hörte sein Herz auf zu schlagen.
Vor seinem Tod hatte er noch die Dreharbeiten zu einer Reihe von Interviews mit Bill Moyers abgeschlossen, die im darauf folgenden Frühjahr unter dem Titel »The Power of Myth« ausgestrahlt wurden. Sie sollten ihn posthum einer breiten Öffentlichkeit bekannt machen. Es ist einmal sehr gut so ausgedrückt worden, die Mythologie sei die vorletzte Wahrheit. Die vorletzte, weil die letzte nicht in Worte gefasst werden kann.
Sie ist jenseits von Worten, jenseits von Bildern, jenseits jenes Grenzrandes des buddhistischen Rades des Werdens. Die Mythologie schleudert den Geist über diesen Rand hinaus, in das, was erkannt, aber nicht mitgeteilt werden kann. Daher ist sie die vorletzte Wahrheit. Es ist wichtig, dass man das Geheimnis des Lebens und sein eigenes Geheimnis im Leben erfährt und erkennt.
Das verleiht dem Leben eine neue Strahlkraft, eine neue Harmonie, einen neuen Glanz. Mythologisch zu denken, hilft einem, sich mit den Unvermeidlichkeiten dieses Jammertales zu versöhnen. Man lernt die positiven Werte in dem Erkennen, was die negativen Momente und Aspekte des eigenen Lebens zu sein scheinen. Die große Frage ist, ob man es fertig bringt, zu seinem Abenteuer ein beherztes Ja zu sagen. Dem Abenteuer lebendig zu sein.
Die Entdeckung der Heldenreise. Eine lange Nacht über Joseph Campbell. Von Sabine Fringes. Es sprachen Tom Jacobs, Thomas Krause, Rebecca Madita-Hund, Thomas Ballou-Martin und Hildegard Meyer. Ton und Technik Hendrik Manuk und Lukas Fehling. Regie die Autorin. Redaktion Hans-Dieter Heimendahl.
Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine Reise nach Bad Kissingen. Lernen Sie eine Stadt an der Fränkischen Saale und ihre Geschichte kennen und seien Sie gespannt auf eines der ältesten Bäder Deutschlands, in dem mitentwickelt wurde, was sich als Kuraufenthalt in ganz Europa etabliert hat.
Sie können alle langen Nächte der letzten Monate auch in der Deutschlandfunk-App nachhören. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche.
