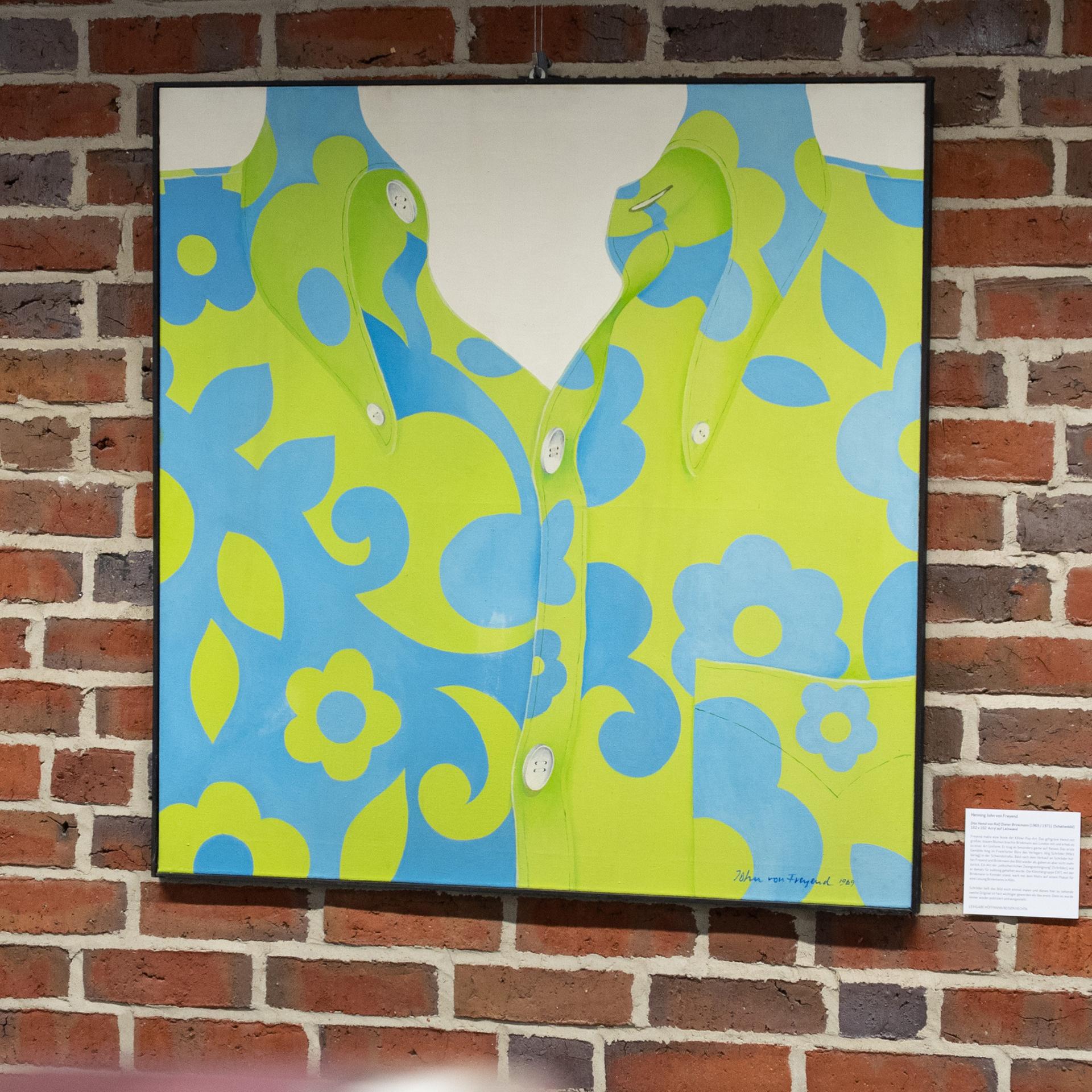
Rolf Dieter Brinkmann - Mit Zweifel an allem und Wut auf fast alles

Lange Nacht
Shownotes Transcript
An Rolf-Dieter Brinkmann scheiden sich die Geister. Für die einen ist er ein wüterig, der gern provoziert, der radikal-subjektiv zwar alles in Frage stellt, sich dabei aber in wachsendem Maße in ich-bezogene Tiraden hineinsteigert, in die nichts und niemand ungeschoben davonkommt. Und für die anderen ist er ein beispielhaft Suchender.
der in großer Radikalität den Augenblick freizulegen und literarisch zu fassen versucht und auf originelle Weise mit verschiedenen medialen Formen experimentiert. Am Anfang seines Weges stand die Kritik an das Abräumen von Konventionen, der Poesie und des Schreibens, des Lebensstils und der Lebensführung. Rolf-Dieter Brinkmann hat diesen Weg erweitert.
in gewisser Weise sich selbst dokumentierend, publizistisch und literarisch vollzogen. Von der Herausgabe einflussreicher Sammelbände mit zeitgenössischer amerikanischer Lyrik, die ihm den Namen eines Poppoeten eingetragen haben, bis zu dem letzten eigenen Gedichtband Westwärts 1 und 2, mit dem er als Autor eine zweite, dritte oder vierte Häutung vollzieht und einen ganz eigenen lyrischen Weg einschlägt.
Rolf-Dieter Brinkmann selbst hat das Erscheinen dieses Gedichtbandes nicht mehr erlebt. Wenige Tage zuvor ist er bei einem Autounfall am 23. April 1975 ums Leben gekommen. 50 Jahre ist das schon her. Sein Ton, seine Radikalität und das Projekt der Unmittelbarkeit auf der Spur zu sein, erscheinen mir noch immer wie zeitgenössisch. Seien Sie gespannt auf die lange Nacht über Rolf-Dieter Brinkmann von GISA Funk.
Die dritte Stunde der Langen Nacht bilden Ausschnitte eines Abends mit Gesprächen über Rolf-Dieter Brinkmann. Mit der Weggefährtin Linda Pfeiffer, der Biografin Alexandra Baza und dem Literaturwissenschaftler Roberto Di Bella, den wir gemeinsam mit und in dem Literaturhaus in Köln gestaltet haben. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl. Ich bin der Redakteur der Langen Nacht. Sie erreichen mich wie immer unter langenacht.de.
Nächste Woche erwartet Sie in dieser Stelle eine lange Nacht über den Mythenforscher Joseph Campbell, der aus Ursprungserzählungen, Märchen und Sagen der ganzen Welt das Schema einer Heldenreise destilliert hat und damit eine Vorlage geliefert hat, an der sich Kinoproduzenten in Hollywood ebenso wie Therapeuten und Coaches orientieren. Seien Sie gespannt. Sie können alle lange Nächte der letzten Monate auch in der Deutschlandfunk-App nachhören.
Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche. Der Wagenverkehr erinnert mich immer an Krieg. An endlose kriegerische Wagenkolonnen, die irgendwo hinziehen, zerstören, ausnutzen, kaputt machen, Geld verdienen, sich zerstören, wieder zurückfahren. Ein Schwachsinn. Ein Schwachsinn an Geräuschen, ein Schwachsinn an Tätigkeiten.
Alles ist doch da. Warum diese Hast? Wohin wollen sie denn überall? Ich weiß es nicht. Ein Mann geht fluchend durch die Stadt. Man schreibt den Herbst 1973. Der Mann heißt Rolf-Dieter Brinkmann und ist zu diesem Zeitpunkt ein 33-jähriger Schriftsteller in der Schreibkrise. Und die Stadt, durch die er an diesem grauen Herbsttag vor sich hinschimpfend läuft, ist Köln.
Der WDR hat Brinkmann kurz vorher mit einem Hörspiel beauftragt. Darum hat er sich ein Tonbandgerät um die Schulter gehängt und stapft damit nun los, quer durch die Kölner Innenstadt. Wobei er alles, was ihm auf seinem Spaziergang auffällt oder spontan durch den Kopf geht, ins Mikrofon spricht. Schreiben ist etwas völlig anderes als sprechen. Sprechen, dazu gehören Situationen.
Beim Schreiben gehört Stille dazu. Und ein langsames Zerlegen von winzigen Augenblicken in die einzelnen Bestandteile. Wenn ich alleine spreche, dann fällt mir meistens nichts ein. Sind andere Leute da, lass ich mich gerne anregen. Gerade geht eine Jalousie runter. Wieder ein Auto. Tatsächlich, Schreiben an der Schreibmaschine ist etwas völlig anderes als Sprechen. Schreiben kann man nur allein. Sprechen macht man mit vielen Leuten.
Wenn man sich heute die erst 2005 postum veröffentlichten Tonaufnahmen von Rolf-Dieter Brinkmann anhört, fällt einem neben dem typisch motzigen Brinkmann-Sound die geradezu kindliche Begeisterung des 1975 verstorbenen Kultautors auf.
Die Möglichkeit, seine momentanen Eindrücke und Gedanken sofort unkompliziert auf Tonband festzuhalten, statt sie erst mühsam aufzuschreiben, begeisterte den Alltagschronisten aus Köln hörbar. Schließlich hatte es sich Brinkmann zum Ziel gesetzt, die bewusst erlebte Gegenwart so ungefiltert und unverfälscht wie möglich zu erfassen.
Eine ganz neue Form der autobiografischen Literatur wollte er erschaffen. Eine wachsam den Alltag mitprotokollierende, aber doch radikal subjektive Art des Schreibens. Abseits üblicher Sprachklischees.
Manchmal entdeckte der Großstadtflanneur Rolf-Dieter Brinkmann dabei zwar kleine Wundermomente. Meistens jedoch blieb sein protokollanten Blick bei den Hässlichkeiten und Schmutzecken seiner Künstlerexistenz hängen.
So auch bei seinen Kölner Herbstspaziergängen 1973 mit dem WDR-Aufnahmegerät. Als er einmal am innerstädtischen Aachener Weiher eine Pause einlegte und seine Beobachtungen aufs Band sprach. Rentner, alte Frauen, alte Männer führen ihre Tiere an dem verseuchten Stadttümpel entlang. Dieser kleine Tümpel, wo die Eisenbahn fährt, ein klapperndes Geräusch vor der Innenstadt.
Diese Wasserfläche, wo tote Fahrräder liegen, kaputte Fische schwimmen, auf dessen Oberfläche Tiere entlang paddeln, wo ein Blaulicht entlangfährt, ein winziges kleines Stückchen Gegenwart, künstlich gefärbt, zerfallen, geriffelt, von einem endlosen Verkehr umgeben, Krieg, künstliche Farben, eine schmierige Kölner Nacht, ohne einen hohen Himmel, eine niedrige, matschige Nacht,
Smog-hafte Ecke, da bewege ich mich hindurch und ich komme mir ganz fremd vor. Tja, woher kam das? Er war manchmal over the top kritisch und hat sich gewehrt, weil er kam los. Ich habe es nicht immer nachvollziehen können, ich habe da nicht immer mitgemacht. Es war immer alles radikal, es gab keine fließenden Übergänge, alles war eigentlich radikal bei ihm.
Ralf Rainer Regula hat Brinkmann und dessen dauerempörte Haltung schon 1960 kennengelernt. Während der gemeinsamen Lehrzeit in der katholischen Münster Buchhandlung in Essen. Ich kam nur im April 1960. Da war der Zufall, dass da ein Mitlehrling von mir, nicht nur Mitlehrling war, sondern auch Mitbewohner im Haus.
Das war Rolf-Dieter Brinkmann, der sich ja jemals Dichter präsentierte. Mit allem, was dazu gehört. Auch mit dem Pathos. Er war Dichter und das war seine Leidenschaft. Er war jetzt 19, ich war 16, ein halb.
Und ich war begeistert und ich habe ihn von Anfang an bewundert. Die beiden jungen Lyrik-Fans verstanden sich auf Anhieb und wurden während der Buchhandelslehre quasi unzertrennlich.
Sie lasen sich gegenseitig aus Büchern und Gedichten vor, diskutierten nächtelang über Literatur und Regula war zu dieser Zeit immer der Erste, dem Brinkmann seine neuen Texte präsentierte. Es ist ja auch so, dass ich sofort auch konfrontiert wurde mit seinen Texten, weil er sie vorgelesen hat sofort und weil er sie geschrieben hat in diesem Heimat, hat er so Plätze gesucht im Billardraum, im Vorfeldraum.
Sportraum und Plätze, wo er schreiben konnte. Das hat mich alles sehr fasziniert. Er war oft laut und rabiat und er hat ja auch einige Auftritte hingelegt, die sozusagen fast schon legendär geworden sind. Resümiert auch Michael Töteberg. Zusammen mit Alexandra Waser hat der Hamburger Filmjournalist kürzlich eine Biografie über Rolf-Dieter Brinkmann vorgelegt.
Endlich, muss man sagen. Denn es ist die erste Biografie. Knapp 50 Jahre nach Brinkmanns tragischem Unfalltod in London am 23. April 1975. Mit nur 35 Jahren. Nein, er hatte sich selbst da nicht so unter Kontrolle. Also dieses Erregungspotenzial, da konnte sich auch richtig hineinsteigern. Darunter litten dann auch natürlich die Freunde. Also das ist so...
Man konnte ihn dann auch nicht zügeln. Also das war schon eine ziemliche Zumutung auch. Ein gelb-schmutziger Himmel, ein gelb-schmutziger Himmel, ein gelb-schmutziger Himmel über mir, ein gelb-schmutziger Himmel, ein gelb-schmutziger Himmel über mir, ein gelb-schmutziger Himmel, ein gelb-schmutziger Himmel, der überhaupt nicht aufhört, ein gelb-schmutziger Himmel, der überhaupt nicht aufhört in diesem Augenblick, ein gelb-schmutziger Himmel, ein gelber-schmutziger Himmel,
Ein gelber, schmutziger Himmel. Ein gelber, schmutziger Himmel. Ein mieser, gelber, dreckiger, schmutziger Kölner Himmel. Eine von Brinkmanns Kölner Spaziergangsaufnahmen aus dem Herbst 1973 wurde später berühmt, nachdem er sie für sein Hörspiel »Die Wörter sind böse« verwendet hatte.
Dabei handelt es sich um eine besonders heftige Wut-Tirade, die trotz aller Aggressivität auch ungemein komisch wirkt. Denn Brinkmann steigert sich darin völlig absurd in eine Verfluchungsoada auf den Kölner Nachthimmel hinein. Ein mieser Himmel, ein verdammter Scheißdreck von Himmel, ein mieser, gelber, schmutziger Kölner, verfluchter, elender Kackhimmel.
Ein von Lichtfetzen verkackter Himmel, ein mieses Stück
Von Himmel, ein Kackhimmel, ein riesiges Scheißdreck von Himmel jetzt in diesem Augenblick. An dieser Bahnstelle, entlang der Bahn, zwischen diesen toten Bäumen, vor der Stadt, rings um Häuser, Kästen. Ein elendes Missstück von Himmel, ein mistig gefärbter Scheißdreck. Er sieht diese ganzen Erscheinungen in der Gegenwart und findet eigentlich alles schrecklich.
Und wenn man viele Briefe und viele Postkarten von Brinkmann liest, dann denkt man, ach, der Mann kann eigentlich überall unglücklich sein. Es ist eigentlich egal, wo er ist. Also man darf es sozusagen gar nicht nur alles auf Köln beziehen. Es ist aber auch so, dass irgendwie ahnt er es auch und schreibt das irgendwie auch mal so. Es fällt ihm schwer, über die Schönheit zu schreiben. Und was schön ist, es fällt ihm sehr viel leichter, darüber herzuziehen, was alles so schrecklich ist.
Die Wut-Tirade als kreativer Beschleuniger. Ähnlich wie andere Literatur-Provokateure seiner Zeit, etwa der österreichische Skandalautor Thomas Bernhard, nutzte Rolf Dieter Brinkmann seine Erregbarkeit wohl auch als literarisches Hilfsmittel. Im Zustand der Rage fiel es ihm einfach leichter, seine inneren Ängste und Hemmungen beim Schreiben zu überwinden.
Entsprechend trat er in seinen Texten und bei öffentlichen Auftritten gern schimpfend auf, vergriff sich dabei allerdings mit der Zeit immer häufiger im Ton und beleidigte fast jeden. Das trug ihm dann schnell den Ruf eines Bad Boys und Skandal-Krawallos ein.
Doch würde man ihm Unrecht tun, wenn man ihn nur auf dieses Image des Wüterichs reduzierte. Das merkt man spätestens, wenn man eins seiner Bücher aufschlägt. Dort begegnet man auch einem anderen Brinkmann, einem hochempfindlichen, stellenweise geradezu sanftmütigen und verblüffend hellsichtigen Autor, den man jedoch allzu oft übersah und bis heute übersieht, glaubt Michael Töteberg. Er war gleichzeitig doch auch ein
Ja, höchst sensibler und sehr genauer beobachter. Und zwar durchaus mit einem Blick auch für die Schönheit des Beiläufigen. Also da wäre dieses Bild von dem Wüterich doch etwas zu korrigieren.
Woher kam überhaupt diese maßlose, ungeheure Wut von Rolf-Dieter Brinkmann, die ihn oft völlig hemmungslos auf seine Mitmenschen losgehen ließ? Sein Biograf Töteberg glaubt, dass dieser Jähzorn aus einem frühen Kriegstrauma herrührt. 1940, zu Beginn des Zweiten Weltkriegs, in der nordwestdeutschen Kleinstadt Vechta geboren, habe Brinkmann wie viele seiner Altersgenossen die als Kleinkind erlittene Todesangst niedergelassen.
Nie ganz verwunden. Man muss sich einfach vorstellen, die Mutter war Köchin im Fliegerhorst. Das war ein paar hundert Meter entfernt. Als der Krieg näher kam, wurde dieser Fliegerhorst in einer Nacht vollkommen durch Bomben ausradiert.
Das ist etwas, was immer wieder aufscheint, weil man diese Erinnerung hat, wie sozusagen da die Bomben einschlagen und wie alles dunkel ist und wie er in dieser Wohnung ist, sich zu orientieren versucht und die Marmeladegläser schwanken. Das sind Bilder, die ihn eigentlich gar nicht wieder losgelassen haben. Diese Art, einer Unsicherheit in der Welt zu sein, immer dieses ständige Bedrohungsgefühl zu haben.
Nachts mit kaltem Schweiß auf der Stirn aufgewacht. Pinkeln, halbbewusste Träume. Wie ich als Dreieinhalbjähriger voll Schrecken nachts aus dem Bett klettere. Hatte das bis dahin nie gekonnt. Konnte nicht einmal über den Tisch sehen und da sitzt sie, die Mutter. Fremd unter der verhangenen Lampe, die Fenster verhangen in der ängstlichen Stille. Alles ist still. Angst, Angst, Krieg, Bombenangriff und sie sitzt da und strickt.
Erinnerte sich Brinkmann Jahrzehnte später in seinem Collage-Tagebuch Erkundungen für die Präzisierung des Gefühls für einen Aufstand mit Aufzeichnungen von 1971, das seine Witwe Marleen nach seinem Tod 1987 herausgegeben hat. Er war ja eigentlich so ein bisschen wie ein Tier im Käfig. Also er konnte nicht so richtig mit seiner ganzen Sache durchkommen. Und dieses kurz vorm Platzen war halt sehr oft angesagt.
Und er hat das nicht anders bewältigen können. Linda John von Freyend, geborene Pfeiffer, war jahrelang eng mit dem ungestümen Autor befreundet, nachdem sie ihn 1967 als Mitstudentin an der Pädagogischen Hochschule in Köln kennengelernt hatte.
Einige Jahre später erlebte Pfeiffer hautnah den heftigen Karriereabsturz von Brinkmann mit. Nachdem er 1970 in eine schwere Schreib- und Lebenskrise geraten war.
Damals mussten sie und ihr Lebenspartner, der Maler Henning John von Freiend, dem verzweifelten Schriftsteller oft Mut zusprechen. Als Nachbarn in der Engelbertstraße. Das war wirklich sehr dramatisch. Dieses dauernde Strom abstellen und Telefonen, wieder kein Geld und wieder kein Geld. Und dann in diesem Literaturbetrieb da dauernd jeden 100 Mark hinterher zu rennen. Das ist natürlich eine Folter.
Er wollte seine Wahrnehmung, seine Sicht der Dinge, seine Gefühle, wollte er, dass die mal anerkannt und akzeptiert werden und dass das auch literarisch umgesetzt wurde und eben auch entsprechend veröffentlicht und honoriert. Also er war in einer gewissen Situation, die ihn nicht richtig voll aufblühen ließ.
Der wüterig Rolf-Dieter Brinkmann, also als verkanntes, allzu oft missverstandenes Genie, tatsächlich ist auch an dieser These etwas dran. Man könnte die wechselhafte Karriere des einstigen Skandalautors durchaus auch als eine Abfolge unglücklicher Missverständnisse und falscher Zuschreibungen erzählen, die ihn auf die Dauer immer wütender machten.
Dabei fing alles geradezu märchenhaft an. Kurz vor Abschluss seiner Buchhändlerlehre wurde der 22-jährige Brinkmann 1962 von Renate Matthei entdeckt, einer Lektorin des Kiepenheuer & Witsch Verlags. Gemeinsam mit ihrem Lektorenkollegen Dieter Wellershoff war Matthei auf der Suche nach einer neuen, frischen Stimme für den Kölner Verlag.
Und genau diese neue Stimme glaubte sie nun, nach Durchsicht vieler Manuskripte, im jungen Brinkmann entdeckt zu haben.
Danach ging es schnell bergauf für den ehrgeizigen Newcomer. 1962 veröffentlichte Brinkmann seine erste vielbeachtete Erzählung »In der Grube«. 1965 folgte sein erster Erzählungsband »Die Umarmung«, der von niemand Geringerem als Marcel Reich-Ranitzky persönlich in der Zeit besprochen wurde.
Und auch wenn diese lange Zeitungskritik von Reich Ranitzky nicht durchgehend positiv ausfiel, so klang sie doch so verheißungsvoll, dass sie den Debutanten aus Köln auf einen Schlag bekannt machte. Kam der Chefkritiker der Nation darin doch zu dem Schluss? Hier lehnt sich ein junger Schriftsteller mit Wut und Besessenheit gegen die biologischen Gegebenheiten des Daseins unmittelbar, gegen das Körperliche und das Kreatürliche auf.
Gewiss, noch kein bedeutendes Buch, aber doch eine wichtige Publikation, weil sie große Möglichkeiten ankündigt. Besser als mit diesem wohlwollenden Urteil des einflussreichen Kritikers konnte man in den 60er Jahren als Neuling nicht starten. Umso mehr, als Brinkmann bereits vorher, im Oktober 1963, eine Einladung der Gruppe 47 erhalten und abgelehnt hatte.
Ein glatter Affront, dem weitere folgten. Weil Richter auch danach noch zweimal erfolglos versuchte, Brinkmann einzuladen. Warum sich der junge Kiwi-Autor, damals so stur der Gruppe 47, verweigerte, erklärt sein ehemaliger Kumpel Rigola so. Das waren eingeschworene Kreise, Literatur, die unter sich bleibt.
Ich meine, auch diese Gruppe 47 hatte auch eigentlich noch diesen Charakter, dass wir und wir sortieren uns aus und wir sagen, wer ein Dichter ist und wer ein großartiger Prosa-Autor ist. Wir bestimmen das. Brinkmann hatte auch sich geweigert, da mitzumachen. Einmal aus diesen Gründen, dass er nicht zu dieser traditionellen Literaturelite gehören wollte,
Vielleicht war er auch unsicher.
Ob er dort besteht, für ein Verhalten gibt es ja selten nur einen Grund. Schon diese scharfe Ablehnung der altgedienten Literaturelite wies früh auf die Radikalität des jungen Brinkmann hin. Bzw. auf einen früh ausgeprägten Hang zum jugendlichen Größenwahn, der sich mit Brinkmanns ebenfalls ausgeprägtem Ehrgeiz nicht immer gut vertrug. Das ist ein großer Widerspruch, dass er ...
von Anfang an eigentlich gesagt hat, ich möchte nicht Teil des Literaturbetriebs sein, der ist ja sowieso so schrecklich. Aber natürlich war er sofort Teil des Literaturbetriebs und hat diesen auch bedient. Das war ein Autor, der mit seinen ersten Erzählungswänden gleich war
überall besprochen wurde?
Mit einer derart vermufften Oldie-Literatur wollte der junge Literaturrebell nichts zu tun haben. Die war ihm zu altbacken, zu akademisch abgehoben und vor allem viel zu verkopft lebensfern mit moralisch-didaktischen Botschaften aufgeladen. Zusammen mit seinem Kumpel Regula plädierte Brinkmann stattdessen für eine andere Kultur. Die nicht-Kultur.
diesen Distiktionslevel braucht, diesen akademischen Hochkulturstatus braucht und der eben sagt, jeder kann schreiben, jeder könnte Dichter sein. Und das hereinnehmen von Alltäglicherem, von der Konsumwelt, von Musik auch. Musik
I feel free. I feel free. I feel free. I feel free. Vienna, I dance with you. Evil's like the sea. For all I want to know.
Auf ihrer Suche nach einer weniger elitären, lebensprallen und jugendlich unverkrampften Literatur kam Brinkmann und Regula dann 1963 unverhofft der Zufall zu Hilfe. Denn Regula erhielt in jenem Jahr nach Abschluss der Buchhandelslehre seinen Einberufungsbefehl.
Da er den Wehrdienst aber nicht antreten wollte, bewarb er sich kurzentschlossen in London. Und zwar nicht in irgendeinem Buchladen, sondern bei der damals offiziell größten Buchhandlung der Welt. Das war Foyles, Charing Cross Road. Und die haben tatsächlich dann gesagt, ja, ich soll mal kommen, ich soll also vorsprechen und reden.
Ich habe Glück gehabt und ich konnte diesen Job antreten und dort habe ich dann gearbeitet. Regula traf 1963 punktgenau zum Ausbruch der Swinging Sixties in London ein und bekam als Booksearcher von Foyles nun direkt mit, wie sich vor seiner Nase nicht nur gesellschaftlich und popmusikalisch, sondern auch literarisch eine Jugendrevolte formierte.
Neben den US-Beat-Poeten rund um Jack Kerouac, Allen Ginsberg und William Burroughs bliesen damals auch die jungen Lyriker der New York School wie Frank O'Hara, Ted Berrigan oder Ron Padgett zum Angriff auf die Hochkultur und warfen dafür nicht nur die alten Schreibkonventionen über Bord, sondern machten in ihren Gedichten plötzlich auch ungeniert ihren eigenen Alltag zum Thema.
Erstmal haben wir einfach gelesen und haben uns faszinieren lassen von diesem neuen Ton in der Literatur, von dieser Vorstellung, dass Gedichte nicht unbedingt ein Ausdruck der höchsten Hochkultur sein müssen, sondern so zurückgebracht werden sollten auf Weltkultur.
Das ist eine Ebene, die jeder bewerkstelligen kann, die jeder zu einem Ziel führen kann. Also jeder sollte zum Dichter werden. Das war irgendwie so die Utopie. Ron Padgett, wieder mal du. Ich glaube, ich rauche zu viel, zu viele Zigaretten. Und warum gehe ich mit meiner Halsentzündung, die sich ankündigt, nicht zu Bett und sehe immer noch Spätfilme an? Es gibt ja einige gute heute Abend.
Unkonventionell rotziger, von jeder Metrik und Versform befreite Alltagsgedichte wie »Wiedermal du« von Ron Padgett begeisterten den Lyrik-Fan Ralf Rainer Regula. Er
Er entdeckte sie in London in sogenannten Little Macs. In billig produzierten, aus kopierten Blättern zusammengehefteten Heftchen, die vor allem in der Szene-Buchhandlung Better Books auslagen. Plötzlich war eine lose Blättersammlung mit Texten, die ich so vorher auch nie gehört habe. Und es war eben nicht nur eine andere Publikationsform, sondern auch andere Inhalte. Und es waren aber in erster Linie amerikanische Sachen.
Und das hatte damit dieser jetzt mittlerweile berühmt gewordenen Buchhandlung Better Books zu tun. Und die lagen einfach nur 100 Meter entfernt von meinem Arbeitsplatz. Und dieses Better Books, die hatten eine Kooperation mit dem City Lights Bookshop in San Francisco, den der Selegetti betrieb.
Dadurch hatten die eben auch Autoren und Bücher und Hefte, die es sonst nirgendwo gab.
Und ich hatte das Glück, die zu entdecken und mich zu wundern und habe natürlich das alles mitgeteilt meinem Freund, der mittlerweile in Deutschland plötzlich regissierte als Autor. Wow! Wow! Wow! Wow!
Ähnlich wie die rebellischen Rockmusiker jener Zeit, etwa The Doors, The Rolling Stones oder Cream, riefen auch die anglo-amerikanischen Underground-Poeten zum Traditionsbruch und zur sexuell-hedonistischen Befreiung auf.
Eine Botschaft, die auch den jungen Rolf-Dieter Brinkmann in Köln sofort elektrifizierte, nachdem Regula ihm einige Little-Mac-Häftchen aus London zugeschickt hatte. Brinkmann hat die Dinger verschlungen, die ich ihm geschickt habe gelesen. Und die Sache war die, ich soll es übersetzen. Und er würde sich darum kümmern, dass er es irgendwo unterbringt, dass er irgendwie das zur Veröffentlichung bringen kann. Es war fast ein Erweckungserlebnis für Brinkmann, verurteilt.
vermittelt durch Regula, was da an moderner Literatur stattfand und was alle möglichen Tabus auch brach, inklusive dessen, dass es plötzlich, was auch dann in Deutschland völlig schockierend war, dass da plötzlich in der Lyrik drin stand, ficken, ein Wort, das man eigentlich doch...
Gar nicht sagt und schon gar nicht schreibt und schon gar nicht in der Lyrik. Durch die absichtliche Verwendung von vulgär obszönem Vokabular und Schmuddelwörtern wollten die Little Mac-Autoren die damals vorherrschenden sexuellen Tabus aufknacken. Das war ganz sicherlich eine Möglichkeit zu schockieren, aber auch eine Möglichkeit, um sich abzusetzen. Über Sex wurde nicht gesprochen.
Und Pornografie war verboten. Und deswegen in diesen Texten, in dieser Literatur, die da so vervielfältigt wurde, mit Kopierern oder so, das wurde ausgesprochen. Es wurde auch direkt darüber gesprochen, also auch in der vulgärsten Art und Weise. Das war auch eine Message dieser Inhalte. Wenn Sie gegen etwas rebellieren wollen, dann müssen Sie natürlich Tabus brechen. Musik
Der Ajax-Supermann hat die Gasometer aufgedreht, um langsam die eigene Schwere loszuwerden. Und dann hielten die roten Busse nicht länger. Die Wimpy-Bars sind überfüllt.
To Love Thee With Love heißt ein von Rolf-Dieter Brinkmann am 11. April 1965 verfasstes Gedicht, das heute offiziell als erstes deutsches Pop-Gedicht gilt. Er hat es bei einem seiner wiederholten Besuche bei Regula in London geschrieben. Sicht- und hörbar inspiriert von der rotzigen US-Underground-Lyrik.
Allerdings war Brinkmanns Schulenglisch zunächst viel zu schlecht, um die neu entdeckten Texte professionell übersetzen zu können. Trotzdem fasste er mit Regula sofort den Plan, sie in Westdeutschland als Buch herauszubringen.
Doch beim konservativ geführten Kippenheuer & Witsch Verlag winkte man indigniert ab. Woraufhin Brinkmann dann abermals der Zufall zu Hilfe kam. Denn er verstand sich gut mit dem damaligen Presseschef des Kiwi-Verlags, einem gewissen Jörg Schröder.
Dieser wechselte 1965 den Job und wurde erst Verlagsleiter beim Kölner Melzer Verlag, bevor er 1969 in einer abenteuerlichen Handstreichaktion den bis heute legendären, linksradikalen Merz Verlag in Frankfurt am Main gründete. Für Brinkmann und Rigoula ein echter Glücksfall.
Denn mit dem 1938 geborenen Jörg Schröder fanden sie einen fast gleich alten, unkonventionellen Verleger, der wie sie von der Jugendrevolte begeistert war. Und sich leidenschaftlich für eine Literatur des Tabubruchs einsetzte. Die Zeit war reif für Veränderung. Die Zeit war reif für so was Hochkultur und Literatur angeht, neue Definitionen zu finden.
Neue Wege, neue Aussicht, neue Hoffnung. Es war alles mit dabei. Es war eine Aufbruchzeit. You're gonna burn.
Unter den skandalträchtigen Titeln Fuck You, Acid und Silver Screen brachten Regula und Brinkmann schließlich zwischen 1967 und 1969 unter Schröders Ägide gleich drei Anthologien mit angloamerikanischer Underground-Literatur heraus. Oder genauer gesagt, drei Sammelbände, die neben Texten auch Comics und Fotos von barbusigen Schönheiten in eindeutigen Posen enthielten.
Also prall gefüllt waren mit Sex, Drugs and Rock'n'Roll, was auf dem westdeutschen Buchmarkt dann prompt zündete. Vor allem der zweite Collageband, Acid, sorgte 1969 für Aufsehen, als er, perfektes Timing, zeitgleich zum Hippie-Mythos Woodstock erschien. Das Buch wurde daraufhin zum Bestseller und zur Kultlektüre der westdeutschen Protestjugend.
Und es machte seine beiden Herausgeber schlagartig zu Stars einer nun plötzlich neu ausgerufenen deutschen Pop-Literatur. Es ist natürlich eine Zeit, wo viele Sachen aufgebrochen sind. Wir haben eigentlich ein Brüdes, ein
ein bisschen Hingeschlepptes noch aus der Adenauerzeit. Und plötzlich brach etwas auf und es waren junge Leute da, die Langhaarigen. Darüber konnte man sich damals aufregen, über Langhaarige. Das war so provozierend. Und natürlich, Fesset spielte auch da auf Rauschgift an.
Es gab sozusagen sehr viele sich überlagernde Wellen. Es gab die Sexrevolution, von der wir heute wissen, dass sie so revolutionär auch nicht war. Die Drogenwelle, die bewusstseinserweiternden Drogen. You walk into the room with your pencil in your hand. You see somebody naked and you say, who is that man?
Mr. Jones
Für kurze Zeit stieg Rolf-Dieter Brinkmann jetzt zu einem umschwärmten Kultautor auf und wurde von Fans in Köln regelrecht belagert, erzählt Michael Töteberg. Er ist insofern tatsächlich ein Popstar, als er so eine Clique um sich versammelt hat, die, wenn Brinkmann in die Spätvorstellung im Kino geht, dann geht er nie allein, sondern hat immer seine Leute dabei auch, ne?
Die einen auch bewundern und das sind nicht nur Literaten. Er ist in dem Sinne schon irgendwie so eine Figur, an der sich andere Leute orientieren, über die man auch schreibt. Also es ist so ein kleiner Kosmos für sich, ein kleiner Underground-Kosmos in Köln. Der blitzartige Aufstieg zur Kultfigur hatte allerdings seinen Preis.
Weil Brinkmann nun aufs Image des rebellischen Pop- und Generationsautors festgelegt war. Man muss sich Brinkmann schon als einen manischen Arbeiter vorstellen, der sozusagen morgens aus dem Bett fiel und anfing zu schreiben und am Abend immer noch schweb. Es gibt eine Periode, in der sozusagen...
wahnsinnig produktiv ist, auch viel aufnimmt von dem Ausland, aber auch sehr viel davon umsetzt. Da kommt ein Band nach dem nächsten und in manchen Jahren auch gleich mehrere Bücher gleichzeitig und zwar in den beiden Verlagen. Wahrlich eine äußerst beeindruckende und geradezu ungeheuerlich anmutende Kraft und Kreativleistung. Doch trotz dieser enormen Anstrengungen blieb am Ende nicht allzu viel Geld beim chronisch klammen Autor hängen.
Entsprechend ernüchtert fiel seine Bilanz im Hörspiel »Die Wörter sind böse« aus. Doch immerhin gelang Brinkmann 1968 ebenfalls ein Bestseller. Und eine weitere Skandalpublikation.
Nach zwei erfolgreichen Erzählbänden verlangte man nun von Verlagsseite dringlich einen Roman von ihm. Und den lieferte der junge Fließbandschreiber prompt mit »Keiner weiß mehr«, so der anspielungsreiche Titel. Dieser erste und einzige Roman von Rolf-Dieter Brinkmann war, wie eigentlich sein gesamtes Werk, deutlich autobiografisch inspiriert.
Nachdem er 1964 die Buchhändlertochter Marleen Kramer geheiratet hatte und im selben Jahr Vater eines geistig behinderten Sohns geworden war, legte er mit Keiner weiß mehr einen Ehekrisenroman vor, in dem ein junger, namenloser Erzähler vor allem darüber klagt, wie sehr er sich durch Frau und Kind in seiner Selbstentfaltung eingeschränkt fühlt. Ja, regelrecht erstickt.
Besonders schockierend an diesem langen Klagemonolog eines frustrierten Ehemanns war und ist, wie detailliert drastisch dieser hier immer wieder von Gewalt und Mordgelüsten gegenüber seiner eigenen Kleinfamilie spricht. Musik
Das Kind hatten sie weder gewollt noch verhindert, dass es zu leben angefangen hatte, als ein schleimiges, ungenaues Ding in ihr drin. Zäh und beständig, langsam zunehmend. Mit einer gekrümmten Stricknadel wäre es so leicht herauszuholen gewesen, dass sie sich nicht mehr in die Hand genommen hätten.
Warum sie es dennoch nicht getan hatten, mit der Stricknadel in heißem Wasser ausgekocht? Darüber konnte er sich immer noch nicht richtig klar werden. Er sah es sich an, ein Kind von ihm. Ihr Kind davor ihnen, das von jetzt an immer weiter da bleiben würde. Einen Tag, noch einen Tag, den nächsten Tag und den nächsten, ohne einfach wieder verschwinden zu können. Aufgelöst, ohne Rest, wie nie vorher dagewesen. Es war da, blieb da.
und bedrückte ihn weiter, wie er sich langsam eingestand. Allein durch die Anwesenheit, mit der er immer noch sehr wenig anfangen konnte und die ihm immer dasselbe zeigte, dass er das Kind, ein Kind gezeugt hatte und dass er das wieder konnte, wenn er nicht genau aufpasste. Er rieb sich an ihr, sieh ihn mit der Hand, das war besser. In einem kleinen, stoßartig verkrampften Pulsieren sah er es aus sich heraus kommen.
Weißlich-grau als Schleim, der darauf an ihren Händen klebte. Mit seinem Freund Gerald hatte er sich unterhalten, wie lästig das doch eigentlich sei. Dass es jedes Mal so glibberig kam, als schleimige Flüssigkeit. Etwas wolkig-trüb, wie sie auf der Hand lag oder verklebt im Haar hing. Musik
Man kann sich leicht vorstellen, wie hochgradig empörend solche Zeilen aus Keiner weiß mehr auf sogenannte Anstandsbürger des Jahres 1968 gewirkt haben müssen. Brinkmanns Debütroman landete umgehend auf dem Index. Was bedeutete, dass man ihn erst nach Erreichen der Volljährigkeit mit 21 Jahren kaufen konnte und beim Kauf eines sogenannten Verpflichtungsschein unterschreiben musste, das Buch nicht an Jugendliche weiterzugeben.
Der Kölner Oberstaatsanwalt erwog zeitweise sogar ein Publikationsverbot, was dem Erfolg des Skandalromans 1968 natürlich keinen Abbruch tat. Ganz im Gegenteil. Keiner weiß mehr, verkaufte sich prächtig und schaffte es auf die Bestsellerliste. Und Brinkmann stieg damit endgültig zum Angry Young Man der Literaturszene auf.
Doch egal, wie gelungen man den kalkulierten Tabubruch von Brinkmann in »Keiner weiß mehr« auch beurteilen will, aus heutiger Sicht zumindest fragwürdig wirkt, wie auffällig der Autor darin die weibliche Perspektive quasi komplett ausgeblendet hatte. Die junge Ehefrau seines Erzählers kommt mit ihrer Meinung nämlich gar nicht zu Wort.
Das fiel auch Wolfgang Pehnt, damals Literaturredakteur beim Deutschlandfunk, auf. Und so sprach er Brinkmann im Studiogespräch direkt auf dieses Manko an. Sie haben bisher zwei Bände mit kurzen Erzählungen gemacht, Herr Brinkmann. Was mir aufgefallen ist, ist, dass die Reflexion eine sehr viel größere Rolle jetzt in diesem neuen Text spielt, als sie das in ihren früheren Erzählungen getan hat. Das ist also eine Reflexion hier in unserem Fall herausgekommen,
Hervorwiegend aus der Perspektive dieser Ehefigur, die keinen Namen hat. Es ist Reflexion aus der Perspektive des Freundes, das geht ineinander über. Merkwürdigerweise nicht aus der Perspektive der Frau. Ist das in dem ganzen Buch so? Ja, die Frau ist ein passives Moment in dem ganzen Buch. Mir scheint dieses Prinzip, dass die Frau eben keine eigenständige Bewegung in diesem Buch hat, einfach wahrer.
Also wahrer als Ehrlichkeit des Autors, der von seinem Erfahrungshorizont her schreibt.
Würden Sie eine Gefahr darin sehen, dass die Reflexion, die ja nun sehr stark und sehr pronunziert vorgetragen wird, also etwa im Zorn auf Frauen, liegt da nun eine Gefahr darin, dass das unter Umständen als Kommentar des Autors genommen werden könnte und nicht an dieser tragenden Ehrfigur dieses Textes festgemacht ist? Ich glaube, dass ein Roman in manchen Passagen sehr grob geschrieben sein muss.
um einfach auch sich zu sträuben gegen eine schnelle, voreilige Aufnahme des Themas und des Dargestellten. Es muss in dem Leser selbst Widerstand hervorrufen. Obwohl heftig umstritten, gelang Brinkmann mit »Keiner weiß mehr« 1968 der literarische Durchbruch.
Danach war er als Autor gesetzt und galt als eine der interessantesten jüngeren Stimmen der deutschsprachigen Literatur neben anderen provokanten Autoren wie Peter Handke oder Thomas Bernhard. Ein Triumph, der sich mit dem Erfolg von Acid 1969 dann noch einmal verfestigte. Vordergründig hatte es Brinkmann noch keine 30 Jahre alt geschafft.
Er hatte erreicht, wovon er als Jugendlicher in Vechta sehnlich geträumt hatte und war zu einem national berühmten Schriftsteller geworden. Doch so richtig froh machte ihn dieser Erfolg merkwürdigerweise nicht. Stattdessen reagierte er nun immer gereizter und sorgte mit immer heftigeren Wutausbrüchen für Eklats.
Er habe sich damals mit seinem Image des Pop- und Generationsrebellen einfach nicht wohlgefühlt, erklärt Linda Pfeiffer. Das macht einen großen Unterschied, ob Sie selbst aus eigener Motivation heraus etwas machen, was Ihnen 100 Prozent am Herzen liegt, oder ob Sie langsam eingeordnet werden in ein Gebiet, weiter jetzt produktiv sein sollen und wo man bestimmte Erwartungen an Sie hat.
Also das ist schwieriger, weil man ist nicht mehr wirklich frei. Es erscheint paradox. Je erfolgreicher Rolf-Dieter Brinkmann wurde, desto mehr fühlte er sich offenbar missverstanden und falsch vereinnahmt. Denn als offizieller Angry Young Man des Literaturbetriebs weckte Brinkmann nun auch Erwartungen, die er nicht erfüllen konnte.
Dazu gehörte, dass viele ihn vorschnell als Sympathisanten der linken Studentenrevolte einschätzten. Obwohl Brinkmann tatsächlich nie allzu viel mit Politik im Sinn hatte und von der zunehmenden Politisierung der 68er-Bewegung dann schon bald regelrecht angewidert war. In seinen Erkundungen schrieb er,
Jetzt geht's los, dachte ich, als die ersten wilden Aufstände anfingen. Kölner KVB-Streik, angehaltene Straßenbahnen, Wasserwerfer später, sich duckende Gestalten. Jetzt geht's los. Überall, auf allen Gebieten eine Bewegung. Neue Filme, neue Bücher, neue Malerei, neue Musik würde entstehen. Die Redaktion durchlässig für Bewegung. Die alten Fetzen aus der Nachkriegszeit würden verschwinden. Der ganze muffige Angstüberbau.
Aber die zärtlicheren, wilden Gefühle, die die Gegenwart übernehmen sollten, gingen in entsetzlichem politischem Geschwätz unter. Mit der Abrichtung auf politische Fragen sind sie alle kaputt gegangen. Keine Schönheit mehr, zerredete Träume, einkasanierte Gedanken. Ohne viel zu erklären und das Ende der Geschichte abzuwarten, verabschiede ich mich.
Wir sind mitgelaufen bei manchen Demonstrationen. Ich weiß noch, als da ohne Sorg erschossen wurde, da waren wir auch auf der Straße. Erinnert sich Ralf Rainer Regula. Es gab so eine Abwehrbewegung. Das hatte was mit der Sprache zu tun. Also die politische Sprache war nicht eine Sprache, die wirklich...
eine Veränderung bewirken könnte. Das war unsere Ansicht. Es muss noch mehr sein. Die politische Sprache hat immer auch so etwas Bewarndes und nicht die Aussicht auf etwas völlig Neuem.
Das war die Haltung. Deswegen waren wir nie so deutlich politisch wie jetzt die Vertreter der Studentenbewegung. Das waren wir nicht. Nachdem er zunächst begeistert bei den Studentenprotesten mitgelaufen war, wurde Brinkmann die immer klassenkämpferische auftretende 68er-Bewegung bald suspekt.
Er fing deswegen an, sich mit immer schärferen Worten von ihr zu distanzieren, was ihm viele seiner damals mehrheitlich links- bis linksextrem eingestellten Autorenkollegen übel nahmen. Allen voran Martin Walser, damals noch KPD-Mitglied, der dem Kölner Autor 1971 in einem Kursbuchaufsatz »Faschistische Tendenzen« unterstellte.
Dabei war alles im Grunde ein Missverständnis. Der anarchische Brinkmann war zwar ein leidenschaftlicher Freiheitsverfechter, aber eben kein klassischer 68er, der an die Befreiung durch die Weltrevolution glaubte. Oder wie es Linda Pfeiffer ausdrückt. Also 68er liefen ja genug rum. Aber die waren natürlich ideologisch geprägt. Und das war ja genau das, was wir nicht wollten. Wir hatten ja ganz andere Interessen.
Und das fand ich genau, wie Rolf das sah. Die waren dann alle irgendwie so verbohrt und ideologisch eben. Das verstellte den Blick.
Und da war Brinkmann natürlich planlos. Das war dem alles egal. Das hat ja alles in die Ecke getreten. In seinem überschäumenden Zorn aber verlor der Literaturrebell Brinkmann bald völlig das Maß und den Überblick. Hatte er zunächst vor allem gegen das Establishment der Vorgängergeneration angewettert, nahm er nun immer unberechenbarer auch seine eigenen Altersgenossen ins Visier –
Und machte mit seinen Attacken schließlich auch vor seinen Freunden und Förderern nicht mehr Halt. Bis er sich geradezu wahllos, um sich beißend, in einen destruktiven Allesbeschimpfer verwandelt hatte, der quasi jeden und jede, je nach Tagesform, anpöbeln und heftig beleidigen konnte.
Trauriger Höhepunkt dieser Mutation Brinkmanns zur wandelnden Schimpfgranate war sein Auftritt am 17. November 1968 in der Akademie der Künste in Berlin. Dort sollte er mit den beiden prominenten Kritikern Harald Hartung und Marcel Reich-Ranitzky eigentlich vor Publikum über seinen Roman »Keiner weiß mehr« diskutieren.
Aber schon bald rastete er auf der Bühne völlig aus und drohte den beiden Kritikern an, sie mit einem Maschinengewehr erschießen zu wollen. Dieser Amok-Auftritt war so schockierend, dass Reich-Ranitzky sich noch 22 Jahre später, 1990, in einem Interview lebhaft daran erinnern konnte. Er wollte einen Skandal haben, er war mit Dynamit geladen.
An irgendeiner Stelle hat er gesagt, ich sollte mit euch hier überhaupt nicht reden, sondern ein Maschinengewehr haben und euch über den Haufen schießen. Man hat mir nachher erklärt, das sei der Vaterhass, er habe in mir eine Art Vaterfigur gesehen und gegen diesen Vater oder Übervater oder weiß ich, musste er rebellieren.
Am Ende aber konnte so viel Hass erfüllt, rausgebellte Wut für den gerade erst etablierten Schriftsteller Brinkmann nicht gut gehen. Und so war er es im Grunde selbst, der durch seine immer unerträglicheren Verbalattacken den eigenen Karriereabsturz einläutete und sich selbst ins Abseits beförderte. Ich glaube, es ist ihm alles zu viel geworden. Nicht nur der Druck aufs Herz.
dauernd zu produzieren. Und er hat sich da natürlich auch selbst sehr unter Druck gesetzt. Das erinnerte ihn auch an Fassbinder, der so und so viele Filme in einem Jahr am Anfang macht und so und so viele Bücher bringt man in einem Jahr. Und er hat, wenn man so will, durch diese Sachen selbst dafür gesorgt, dass er draußen steht. Ich glaube nicht, dass ihm das so wirklich passiert ist. Er will tatsächlich selbst raus. Das ist durchaus bewusst ein Rückzug
Aber wohin soll der eigentlich führen? Das wusste Brinkmann selbst, glaube ich, nicht. Als quasi von allen nur noch gefürchtetes Enfant terrible zog sich Brinkmann dann abrupt 1970 aus dem Literaturbetrieb zurück und gab danach fast fünf Jahre lang kein Buch mehr heraus.
Nach einer achtjährigen Hochproduktionsphase fühlte er sich ausgebrannt, missverstanden und von allen verraten und war sich seiner eigenen Schreibberufung unsicher geworden.
Als er am 13. Januar 1972 schließlich auch noch eigenmächtig den Optionsvertrag mit Kippenheuer und Witsch aufkündigte, wurde er endgültig zu einem Autor im freien Fall ohne jede finanzielle Absicherung und musste sich danach als Literat noch einmal neu erfinden. When the music's over, when the music's over, when the music's over, the light, turnin' out the light.
Geboren zu Anfang des Krieges in Nordwestdeutschland, Fechter im südlichen Oldenburg, einer Kleinstadt von 15.000 Einwohnern, ein Schweinelandstrich, leeres Moor, hellbraunen Torfstechen, Mücken und Wacholder. Viel krüppeliges Grünzeug, katholisch verseucht, darin aller Schrecken einer wahnhaften Erziehungssucht gewesen ist, bis in die lächerlichen altphilologischen, philologischen Riten einer sogenannten höheren Bildungsanstalt.
Anstalt? Bereits diese Bezeichnung disqualifizierte die Ausbildung. Der Schrecken, jeden Montagmorgen in die Schule zu gehen, war allgemein. So, jetzt kommen wir direkt in die Bibliothek rein. Ah ja, da ist er ja schon. Ein Bild von Rolf Diethorn. So, das ist auch beleuchtet. Man kann das hier anschalten. Ja.
Das ist überlebensgroß. Also so groß war er nicht. Ach, so groß war er nicht, aber er ist relativ klein, ne? Ja, also ich glaube 1,58 oder so. Aber das ist hier etwas größer als Lebensgröße. Das Foto stammt von Günther Knipp in Rom, in der Villa Massimo. Das war 72, Oktober 72. Da haben wir die Fotoserien. Die hat Knipp uns zur Verfügung gestellt. Spannend.
Schon vor seinem Tod ist er 2019 gestorben. Und das ist eines dieser berühmtesten Fotos von Brinkmann. Damals ist er immer mit Anzug und Krawatte aufgetreten. Auf den Spuren von Rolf-Dieter Brinkmann bin ich nach Vechta gefahren. In seine Geburts- und Herkunftsstadt, der sich der Autor zeitlebend in inniger Hassliebe verbunden fühlte. Der Literaturprofessor Markus Fauser leitet hier die Rolf-Dieter Brinkmann-Arbeitsstelle der Universität.
Neben dem Literaturarchiv Marbach ist sie der Ort in Deutschland, an dem die meisten Nachlassdokumente von Brinkmann lagern. Einige davon kann man sich hier in einer von Markus Fauser kuratierten Ausstellung in der Unibibliothek anschauen. Im ersten Ausstellungsraum führt mich Fauser zu einer Vitrine mit Schulzeugnissen. Hier sieht man die Zeugnisse, die Katastrophe, die gleichzeitige, also die
Mit dem Tod der Mutter, September 57, endet auch die schulische Leistung. Die Noten fallen ab, mehrere Fünfen.
In einzelnen Fächern. Und dann ist das Ende der Schullaufbahn im Antonianum auch erreicht. Welche Fächer waren schlecht? Chemie, vor allem Physik, Mathe, auch Latein und so weiter war schwierig. Es ging in allen Fächern eigentlich runter. Und dann war also keine Möglichkeit mehr, das Abi zu machen. Als Schüler konnte der junge Brinkmann nur im Fach Deutsch glänzen. In allen anderen Fächern war er mau bis schlecht.
Und als seine Mutter 1957 schwer an Brustkrebs erkrankte, sackten seine Noten noch einmal deutlich ab, sodass er in der 10. Klasse nicht versetzt wurde.
Sein Vater, der Finanzangestellte Josef Brinkmann, nahm den 17-jährigen Sohn daraufhin vorzeitig vom Gymnasium. Ohne Abitur. Was war das für eine Schule? Das Antonianum hier sieht man. Das Gebäude aus den 50er Jahren, eine Postkarte, sieht aber heute noch genauso aus. Das ist das zentrale und älteste Gymnasium hier gewesen, an dem die ganzen späteren Elitenfechtas ausgebildet wurden. Er hat auch Griechisch und Latein gelernt.
Konnte sogar griechisch ein bisschen, das ist durchaus nachweisbar. Aber wie gesagt, scheichert an der 10. Klasse und muss dann abgehen. Das graue Gefühl am Montagmorgen vor der Schulmesse und während der Schulmesse. In der Endlos sein Schulchor lateinische Gesänge herunterdrückte, vom staubigen, braun-grauen, eichenen Orgelboden. Und man kannte schon die Woche im Voraus. Die Schreckstunden, immer wieder, immer wieder.
sah die keuchenden asthmatischen Gestalten, die mit diffusen Erklärungen von Grammatik ankamen. Erinnerte sich Rolf-Dieter Brinkmann später mit Grausen an seine Schulzeit zurück. Als sensibler, musisch begabter Teenager litt er unter den autoritären Lehrmethoden am Antonianum. Immer wieder schwänzte er den Unterricht und streunte alleine stundenlang durch die Wälder und Moore der Umgebung. Und ...
Brinkmann war schon als Jugendlicher ein fanatischer Leser. Am liebsten las er Gedichte. Vor allem die nihilistischen Verse von Gottfried Benn, der für ihn früh zum Schreibvorbild wurde.
Gottfried Ben war nun mal nach dem Kriege der Shootingstar. Der war ja schon in seinen 60ern vorgerückten. Ein alter Lyriker, der 1910 mit den ersten Erfolgen aufschlug und nun 50 Jahre später wieder aus der Versenkung kam, aus dem inneren Exil.
Das hat schwer beeindruckt. Ja, nicht nur Brinkmann, auch Peter Rümkopf und andere, ich sage bekannt, waren stark beeindruckt von Gottfried Ben. Brinkmann schreibt in den Briefen immer wieder, er will Dichter sein, nicht Schriftsteller. Auch das ist interessant. Also da ist der Einfluss Hesse, Ben, auch Hölderlin liest er in der Zeit natürlich nachweisbar. Es überrascht, wie romantisch-schwärmerisch der jugendliche Brinkmann war.
Seine frühen Gedichte, die man hier im Original bewundern kann, widmete er vor allem seiner großen Jugendliebe Elisabeth Piefke, der Schwester eines Schulfreunds. Sie strotzen noch vor Gefühligkeit und schiefen Metaphern. Ebenso die langen Liebesbriefe, die er der angebeteten Elisabeth schrieb.
Um ihr Herz zu erobern, verzierte der Schüler sie öfter mit eigenen, erstaunlich stilsicheren Zeichnungen. Viel jugendliche Liebesmühe also, die jedoch tragischerweise keinen Widerhall fand. Kommen wir zu der Liebesgeschichte mit Elisabeth Piefke. Das ist ein Teil dieses gewaltigen Nachlasses.
den Elisabeth Piefke uns verkauft hat. Hier sieht man beispielsweise ein solches Briefbuch. Da beschreibt er auf fast 100 Seiten in einer Art Briefroman seine Liebe zu Elisabeth, die aber schon beendet war. Also sie hat das gestoppt. Er wollte sie heiraten und das hat sie abgelehnt.
Dann aber schreibt er endlos Texte und Briefe an sie. Auch hier diese schön kolorierten Exemplare, die selber gemalten Umschläge, die Postkarten oder die grafisch gestalteten Briefe.
Wake up to reality, sagte Elisabeth damals im Winter 1957 zu mir bei einem langen Spaziergang und später fielen Schneeflocken vor dem Fenster des Dachbodenzimmers des Mietergeschäfts und der eiserne Ofen bollert und langsam wurde das Zimmer dunkelblau. Und wir lagen auf dem Bett und drückten unsere Geschlechtsteile aneinander. Und hinterher tat mir der ganze Unterleib weh vor langer Erregung, ohne zu ficken, weil da irgendwelche Vorstellungen waren, sie nicht zu berühren. Und sie das wahrscheinlich auch so arrangiert hat.
Und dann die Poesie des Augenblicks? Oh, ich erinnere mich, wie ich zitternd und halb gelähmt vom Stuhl bzw. von ihren breiten Schenkeln rutschte, auf denen ich saß, und wir uns lange küßten. Und dann drückte und saugte sie an meiner Halsschlagader und ich rutschte bewegungsunfähig von ihr ab auf den Boden. Musik
Noch Jahrzehnte später konnte sich Brinkmann in seinem Collagetagebuch Erkundungen genauestens an die erlittene Zurückweisung durch Elisabeth Piefke erinnern. So tief war er davon verletzt. Trotzdem brach er den Kontakt zu ihr nie ab. Der hat sie ja bis zuletzt gekannt und sogar besucht. Also der letzte Besuch datiert vom Februar 1975, das ist zwei Monate vor seinem Tod.
Da besucht er sie in Osnabrück, in ihrem großen Haus, quartiert sich dort ein und will gar nicht mehr ausziehen. Also sie werden ihn kaum los, sie müssen ihm noch viel Geld geben, damit er geht. Und dann muss er leider und geht dann nach London, Cambridge zu der Lesung, von der er nicht zurückkehrt. Aber bis dahin hat er Elisabeth nochmal besucht und ihren Mann. 1957. Schulabbruch. Erster Liebeskummer. Schließlich der Krebstod seiner Mutter.
Wahrlich ein Jahr voller Heimsuchungen für den Jugendlichen bringt man. In seinen Erkundungen schrieb er, »Mir ging's ziemlich an den Kragen in der Schule. Und ich war ganz wirr wegen des Sterbens meiner Mutter, mit der ich so viele Krächer hatte. Sie warf immer mittags Putzlapp nach mir, prügelte mich oft. Ich musste fegen und spülen, hasste das.«
Und doch gab es in diesem Jahr der Erniedrigungen, wie Brinkmann es später nannte, für den 17-Jährigen auch einen kleinen Lichtblick. Nämlich die Rhetorica Fechtensis. Das war ein freiwilliger Vortragskurs an seinem Gymnasium, in dem er mit seinen Talenten auftrumpfen konnte. Das waren etwa 20 Schüler, die sich außerhalb des Unterrichts sonntags morgens getroffen haben, als sie normalerweise in die Kirche hätten gehen sollen.
Die haben sich lieber in der Rhetorika getroffen. Und dafür hat er Vorträge gemacht. Und diese Vorträge hatte Elisabeth Piefke in dem Nachlass. Also die hat er ihr überlassen, teilweise in Durchschlägen. Hier sieht man so einen getippten Durchschlag. Und dadurch sind diese ganzen Vorträge erhalten. Da sieht man hier zum Beispiel im Mai 1956 der Existenzialismus und sein geistiges Konzentrat, ein Überblick. Und dann interessant, zehn Bücher geschrieben.
Heidegger, Sartre, Camus, Max Benze. Also...
Die Creme des Existenzialismus der 40er und 50er Jahre hat er zur Kenntnis genommen. Also dass er alles verstanden hätte, würde ich nicht behaupten. Aber er bemüht sich um diese philosophischen Theorien. Und da sieht man also, was ihn umtreibt. Speziell ist, das bringt man eigentlich so radikal, sagt, ich bin Dichter, dass ihn eigentlich schon gar nicht mehr die Schule interessiert. Weil das...
Das ist eigentlich für einen Dichter nicht so ganz wichtig. Resümiert Biograph Michael Töteberg die gescheiterte Schulkarriere. Es gibt in dieser Schule in Vechta auch noch so einen Arbeitskreis, die Rhetoriker. Und das ist für ihn viel wichtiger, dass er da auftritt, dass er da Vorträge hält, dass er da Gedichte vorliest. Auch eine Reibungsfläche findet, weil natürlich, wir sind im katholischen Vechta, natürlich in einer katholischen Rhetorik.
Und er fängt da immer an mit Zartra, dann sucht er auch eine Reimungsfläche. Aber diese Rhetorika ist ihm eigentlich viel wichtiger als Schule. In der Rhetorika trainierte der angehende Dichter früh seine polemischen Fähigkeiten. Denn schon hier liebte Brinkmann das Spiel mit der Provokation und brachte seine katholischen Mitschüler wiederholt mit Vorträgen zum atheistischen Existenzialismus zur Weißglut. Was ihm zwar keine Sympathiepunkte einbrachte, aber Respekt.
Kurz vor seinem Schulabgang 1957 gelang ihm dann sogar ein richtiger Coup. Denn die Rhetoriker führte jedes Jahr im Metropoltheater in Vechta ein Theaterstück auf. Diesmal fiel die Wahl auf ein Stück von Wolfgang Borchardt. Das Kriegsheimkehrer-Drama »Draußen vor der Tür«.
Und ausgerechnet der aufmüpfige Brinkmann ergatterte die Hauptrolle des Beckmann. Das ist ein Foto vom Vater, 1957 bei der Rhetorika-Aufführung. Und Brinkmann hat damals in Wolfgang Borcherts »Draußen vor der Tür« den Unteroffizier Beckmann gespielt. Und hier haben wir den Originalflyer von der Schülergruppe mit den Unterschriften der Mitspieler.
Der 17-jährige Brinkmann steigerte sich bei den Theaterproben 1957 dann dermaßen leidenschaftlich in die Rolle des ausgestoßenen Beckmann hinein, dass er sie anschließend quasi für sich selbst übernahm und sich immer mehr zum einzelgängerischen Dichtergenie stilisierte. Weil er sich mit diesem Unteroffizier Beckmann, also mit dieser tragischen Figur der Heimkehrer aus dem Kriege, der nach Hause kommt, überall verschlossene Türen findet,
der entsetzlich in die Runde ruft, hört mich denn keiner, also nimmt mich denn keiner mehr wahr. Damit konnte er sich identifizieren und das führt dann dazu, dass er wochenlang mit diesem alten Soldatenmantel in der Stadt Fechter herumrannte. Und die Leute haben sich gewundert, wieso läuft er jetzt mit einem Kriegermantel durch die Stadt.
Derart von der eigenen Außergewöhnlichkeit überzeugt, hatte der Teenager dann auch keine Bedenken, seine ersten Gedichte gleich an die wichtigsten Zeitschriften für Lyrik zu schicken. An die Akzente in Köln und den Merkur in München. Also es ist schon dieses, ich bin Dichter und das heißt auch, ich schreibe doch nicht für eine Schülerzeitschrift.
Sondern ich schicke meine Verse sofort an die Akzente und an die Zeitschriften Merkur. Also an das Höchste, sozusagen das Renommierteste. Kriegt dieses natürlich auch immer wieder zurück. Und schicke das dann auch an den Surkamp-Verlag, natürlich an Peter Surkamp persönlich. Kriegt wieder eine Absage. Ja, muss ja auch leider gestehen, dass er im Maschineschreiben nicht so gut ist.
Er ist auch noch nicht so gut in der Rechtschreibung, aber das ist ja alles nicht so schlimm. Aber er lässt einfach nicht nach und er schreibt sehr viele Verse und findet dann doch seinen eigenen Ton. Das enorme Selbstbewusstsein des jungen Autodidakten ist erstaunlich. Kahn bringt man doch aus einer eher bildungsfernen, kleinbürgerlichen Familie, die ständig mit Geldsorgen kämpfte und in der man wenig Verständnis für hochfliegende Literaturpläne hatte. Als
Sein Vater ist Angestellter beim Finanzamt, der Verwaltungstätigkeiten macht. Also ganz nieder angesiedelt nach dem Kriege. Vor dem Kriege war der bei der Wehrmacht Flieger.
Und seine Mutter ist ja Küchenhilfe gewesen. Also die Familie hat nicht wirklich Geld. In Vechta kann also sich kein eigenes Haus leisten, lebt zur Miete und kommt auch so schwer durch. Also da gibt es immer wieder Nachfragen des Vaters beim Finanzamt auf Gehaltsvorschuss und ähnlichem. Wissen wir alles, ist dokumentiert.
Das zeigt aber, man kommt aus prekären sozialen Verhältnissen. Das traumatischste Erlebnis seiner Jugend aber war für Brinkmann sicherlich das qualvolle Sterben seiner Mutter. 1957 an Krebs, mit nur 51 Jahren. Krebs, damals schwierig, nicht behandelbar und das dauert Monate, diese Sterbephase. Die Mutter soll laut geschrien haben, stundenlang im Haus schreien.
Er hält es auch nicht mehr aus und ich muss dann gucken, dass er da wegkommt aus dieser bedrückenden Atmosphäre. Also man kann das nachvollziehen, dass es da für einen 17-Jährigen ein extremes Entwicklungsproblem auch gibt. Während der Sohn damals seine ersten sexuellen Erfahrungen machte, musste er zu Hause hilflos mit ansehen, wie seine geliebte Mutter unter Höllenschmerzen starb.
Ein Zusammentreffen höchst widersprüchlicher Empfindungen, das für Brinkmann prägend wurde und als Motiv in seinem Werk immer wieder auftaucht. Auch dort ist die Beschreibung von weiblicher Erotik und Sexualität auffällig oft mit Bildern von Tod und körperlicher Versehrtheit verknüpft. Für den 17-Jährigen war das Muttersterben wohl umso traumatischer, als er kurz darauf auch noch sein Zuhause verlor.
Auf Drängen des Vaters begann der Schulabbrecher nämlich jetzt eine Ausbildung beim Finanzamt Oldenburg, 60 Kilometer von Vechta entfernt. Ein Job, den Brinkmann dann jedoch schnell wieder nach drei Monaten hinschmiss. Völlig entnervt von der Zahlenrechnerei. Wurde nach Oldenburg auf das Finanzamt geschickt, um zu lernen, mich selbst zu ernähren. Verließ den Job nach einem Vierteljahr.
der aus Abhaken von Zahlen bestand und dem Anhören älterer Männer ihren vergammelten Erlebnissen außerhalb der Arbeitszeit. Versuche, die Schule weiter zu besuchen, aufgegeben. Um sechs Uhr morgens mit dem Fahrrad durch das winterlich starre Moor gefahren, Busfahrten, Rumgelungert, Gelegenheitsarbeiten und Lesen.
Der jugendliche Brinkmann wirkt in dieser Phase orientierungslos. Nach Vechta zurück zu seinem Vater, mit dem er sich nie gut verstanden hat, wollte er nicht. Schon gar nicht, nachdem dieser relativ kurz nach dem Tod der Mutter wieder neu geheiratet hatte, erzählt Markus Fauser. Es gibt ja harte Auseinandersetzungen mit dem Vater. Er geht dann auch zeitweise gar nicht mehr nach Hause, sondern versucht bei Freunden unterzukommen.
1958 lebt er dann bei Herbert Piefke, dem Bruder von Elisabeth Piefke, in Neuringe für drei Monate. Die Mutter ist tot und sein Vater heiratet zum zweiten Mal. Kommt eine neue Frau ins Haus, mit der er sowieso nichts anfangen will. Also es ist eine ziemlich schwere persönliche Situation.
Umso dringlicher wollte Brinkmann jetzt aus Vechta weg, seine traumatische Vergangenheit hinter sich lassen und irgendwo anders, am besten in einer anonymen Großstadt, quasi noch einmal ganz von vorne anfangen.
Beim Angebot Lehrling in der katholischen Buchhandlung Münster in Essen zu werden, griff er darum sofort zu. Auch wenn sich die Stelle als ausbeuterische Schufterei herausstellte und als höchst glanzloser Aufbruch aus der Provinz. Buchhändlerlehre von 1959 bis 1962 in Essen, Ruhr, Heimleben, kein Geld. Ich lehne mir Schuhe am Samstagabend von anderen, um auszugehen.
ausgewiesen aus dem Heim für Lehrlinge, in dem es jeden Samstagabend Kakao, Dosenfisch, Weißbrot, kalten Salat gab und Tischordnungen 10 Uhr Licht aus. Lehre eines kaufmännischen Gehilfen mühsam beendet, nach zweieinhalb Jahren Bücherpackens in einem lichtlosen Keller. Gar nicht so übel. Viel gelesen, zweieinhalb Jahre lang. Unterhaltungen mit Putzfrauen, Botengänge durch die Stadt essen.
Doch so sehr sich Rolf-Dieter Brinkmann auch bemühte, das so oft von ihm verspottete Vechta hinter sich zu lassen, er kam nie ganz von seiner Herkunftsstadt los. Er war fast jährlich in Vechta, das wissen die meisten nicht. Also er hat seine Großmutter gerne besucht, Oma Therese. Brinkmann war für ihn so eine Art Ersatzmutter nach dem Tod seiner leiblichen Mutter.
Also da gab es ein sehr gutes Verhältnis zu ihr. Und wenn er dann nach Vechta kam, hat er sie vor allem besucht, nicht den Vater, der 1967 dann auch schon gestorben ist. Aber vor allem liebt er die Landschaft. Also es gibt hinreißende Passagen über die norddeutsche Tiefebene, über den Himmel, die Wolken, die hier hinwegziehen, über die Moore. Es gibt ja einen bezeichnenden Satz von ihm, der heißt, ich komme aus dem Moor. Das ist ein Satz, zu dem er steht. Das leugnet er nie.
Die Kritik an der Stadt ist das eine, die Verbundenheit mit der Region ist aber eben doch spürbar. Als Schauplatz einer unbewältigten Vergangenheit zog es Brinkmann immer wieder nach Vechta zurück.
Und vermutlich war dieses unheilvoll aufgeladene damals auch ein Grund dafür, warum er sich später als Autor so obsessiv dem Hier und Jetzt seiner Alltagsgegenwart zuwandte. Den Alltag mitzuschreiben, den Alltag nachzuzeichnen, all die Schwierigkeiten nachzuzeichnen, die ein Leben ausmachen, das ist schon eine Idee, die er da verfolgt hat. Dass es nicht funktioniert, der hat andere Gründe, aber zunächst mal als Projektbegriff.
Als Idee oder als Vorhaben ist das durchaus beachtenswert. Das scheinbar Vertraute, Gewöhnliche des Alltags noch einmal ganz anders, genauer und quasi unschuldig neu zu betrachten und in Worte zu fassen und sich darüber der eigenen Ich-Identität zu versichern.
Diese trügerisch einfach klingende Idee nahm Brinkmann nach seinem Ausstieg aus dem Literaturbetrieb 1970 wieder auf und wollte sie nun noch radikaler verfolgen. Oder wie es Michael Töteberg formuliert. Er ist ein sehr genauer Beobachter und viele Dinge, die für uns so absolut selbstverständlich sind, geht er sozusagen ganz nah ran und will sie irgendwie erfassen. Und um dieses Erfassen geht es eigentlich immer.
Dabei wurde Brinkmann dann allerdings schon bald die eigene Sprache als Beschreibungsinstrument suspekt. Schließlich sind Wörter immer von vornherein mit abstrakten Sinnbedeutungen und Sprachbildern aufgeladen. So, dass man als Schreibender nie hundertprozentig seine Gedanken und Empfindungen mit ihnen ausdrücken kann.
Stattdessen bleibt immer eine gewisse Übersetzungslücke. Die 1902 auch schon Hugo von Hoffmannsthals berühmte Dichterfigur Lord Chandos zur Verzweiflung trieb. Ähnlich wie Lord Chandos fühlte sich auch der radikale Ich-Chronist Brinkmann durch den bloßen Gebrauch von Wörtern in seiner Kreativität eingeengt und manipuliert. Auf einem seiner Tonbandspaziergänge durch Köln klagte er darum, Was ist denn in den Büchern drin?
Doch nur Wörter. Kein Wort stimmt doch mit dem überein, was tatsächlich passiert. Und was passiert tatsächlich? Wie fühle ich mich? Wie fühle ich mich jetzt in diesem Augenblick? Ungeheuer schwierig zu sagen. Ja, eigentlich gar nicht zu sagen. Warum soll ich sagen? Quak, quak, quak macht ne Ente.
Dann wendet er sich den Filmen zu, also ist dann eher auf den Spuren Warhols unterwegs, fotografiert viel, macht die Collage-Bände und so weiter. Er versucht, sich in andere Richtungen zu entwickeln, die Ästhetik der Präsenz, wie man das heute nennt, zu verfolgen und weiterzuentwickeln. Zunehmend sprachverunsichert,
fing der leidenschaftliche Kinogänger Rolf-Dieter Brinkmann ab Ende der 1960er Jahre an, auch mit anderen Erzählmedien zu experimentieren. Er drehte Filme mit der Super-8-Kamera, nahm Fotos mit seiner Instamatic auf oder lief schließlich, wie erwähnt, mit dem Tonbandgerät monologisierend durch Köln.
Alles aus der Motivation heraus Snapshots, also momentane Schnappschüsse seiner bewusst erlebten Gegenwart, so unverstellt und pur wie möglich einzufangen. Und damit gewissermaßen der Essenz seines Daseins auf die Spur zu kommen. Er folgt also nicht den Erwartungen der Leserschaft, auch nicht den Erwartungen der Verleger.
Die gab es. Also man hatte bestimmte Ideen, was Brinkmann liefern sollte. Das hat er alles nicht erfüllt, sondern hat seinen eigenen Weg gesucht. Man kann jetzt natürlich sagen, der führte in eine Sackgasse. Die Ästhetik der Präsenz, diese Alltagskultur, mit der er sich auseinandersetzt, ist ein Irrweg gewesen. Also es gibt dieses Alltagsschreiben nicht mehr.
dem er nacheifern will, dass er sucht. Das kennen wir aus der dokumentarischen Literatur der 60er Jahre. Auch auf der Bühne hat es nicht funktioniert. Peter Weiß und andere haben das versucht. Hat nicht geklappt, als ästhetisches Modell nicht funktioniert. Brinkmann versucht es in der Prosa, auch in der Lyrik, auch mit Westwärts versucht er das, also ganz nahe am Alltag entlang zu schreiben.
Einen jener klassischen schwarzen Tangos in Köln. Ende des Monats August, da der Sommer schon ganz verstaubt ist. Kurz nach Ladenschluss aus der offenen Tür einer dunklen Wirtschaft, die einem Griechen gehört. Hören ist beinahe ein Wunder. Für einen Moment eine Überraschung, für einen Moment Aufatmen. Für einen Moment eine Pause in dieser Straße, die niemand liebt,
und atemlos macht beim Hindurchgehen. Ich schrieb das schnell auf, bevor der Moment in der verfluchten, dunstigen Abgestorbenheit Kölns wieder erlosch. Musik
Nicht nur sein letzter Gedichtband, Westwärts 1 und 2, aus dem die eben gehörte Ode an einen Kölner Wundermoment stammt, sondern auch seine späteren, posthum erschienenen Collage-Tagebücher. Erkundungen und Rom-Blicke stehen für dieses im Grunde von vornherein größenwahnsinnige und zum Scheitern verurteilte, aber doch grandiose Schreibprojekt Brinkmanns.
Dieses die Flüchtigkeit der eigenen Identität immer wieder neu umkreisende Programm war nach 1970 auch eine klare Absage des Autors an den Geschichtspositivismus der 68er-Bewegung.
Schwer enttäuscht von deren, in seinen Augen gescheiterten Revolte, zweifelte Brinkmann nun grundlegend jede Fortschrittsgläubigkeit an und erhob demgegenüber das subjektive Alltagserlebnis zur einzig gültigen Wahrheitskategorie. Das verband ihn mit anderen damaligen Chronisten einer neuen Subjektivität.
Wie etwa Hubert Fichte, Jörg Fauser oder Bernward Vesper. Oder, wie Biograf Töteberg erläutert, Das ist eigentlich in dem Begriff gab es noch nicht, aber es ist eine autofiktionale Literatur.
Und es sind sehr viele Sachen, wo man denkt, das ist ein sehr moderner Auto. So wie er einklebt, diese Bilder, diese Snapshots und so, das erinnert an die Selfies von heute oder so. Dann zeigt man auch, in welcher Umwelt er lebt. Wie sieht die Wohnung aus? Wie sieht das Wohnzimmer aus? Wie lebe ich?
Das ist auch die Errettung der äußeren Wirklichkeit. Und diese irgendwie festzuhalten, das ist natürlich eine Sache, die in der Totalität nie gelingen kann. Die Niederschrift seiner bekanntesten radikal-subjektiven Werke »Westwärts 1 und 2« und »Rohmblicke« musste sich der Alltagskronist Brinkmann dann allerdings unter schwierigsten Lebensbedingungen abbringen.
Denn nach seinem Rückzug aus dem Literaturbetrieb geriet er ab 1970 schon bald in eine bedrohliche Existenzkrise und stand als ehemaliger Erfolgsschriftsteller mit einem Mal ziemlich allein da. Mit fast allen Freunden und Unterstützern hatte er sich zu diesem Zeitpunkt zerstritten.
Darunter auch mit seinem besten Kumpel Ralf-Rainer Regoulin, der 1969 nach Frankfurt umgezogen war, um dort in Schröders März-Verlag zu arbeiten.
Fast zeitgleich kam es außerdem zum endgültigen Bruch mit dem Kiepenheuer und Witsch Verlag. Und mit seinem alten Mentor Dieter Wellershoff, dem Brinkmann zum Abschied schlimmste Beleidigungen hinterherrief, weil er sich von Wellershoff zu wenig als Dichter ernst genommen fühlte und zu sehr vereinnahmt für dessen Prosa-Konzept eines neuen Realismus.
Nicht ganz zu Unrecht, wie Markus Fauser meint. Also Wellershoff wollte ja auch eher Posa als Gedichte von ihm haben.
Wellershof selber als Prosaist, Romanschriftsteller dann geworden. Er wollte Prosa und ist natürlich von ihm dann auch beschimpft worden, wie allen. Das ist auch Wellershof nicht anders ergangen. Weitgehend isoliert geriet Brinkmann dann immer dramatischer in die Abwärtsspirale, zumal auch sein Privatleben von Katastrophen erschüttert wurde.
Nachdem lange unklar war, was seinem verhaltensauffälligen Sohn fehlt, diagnostizierten die Ärzte beim knapp fünfjährigen Robert 1969 eine schwere geistige Behinderung. Belastend hinzu kam für den beruflich strauchelnden Autor, dass auch seine Ehe mit Marleen nun immer mehr kriselte.
In dieser sich zuspitzenden Notlage wurde ein Stipendium für die Villa Massimo in Rom 1972 für Brinkmann schließlich zum entscheidenden Rettungsanker, sagt Michael Töteberg. Nicht nur finanziell, sondern einfach auch seine Rettung. Damit beginnt er sozusagen auch dieses Tagebuch, was den Ruhem Blick gewährt hat.
Es ist eigentlich sein römisches Tagebuch, aber auch in dieser Mischung aus Briefen, Ausschnitten, Restaurantrechnung, Fotos, die er gemacht hat und so. Also ein sehr unkonventionelles Buch, das ja auch nicht zurückschreckt vor Beleidigungen, Rechtschreibfehlern und so weiter. Also völlig ungeglättet und das macht auch diesen Reiz aus. Und in der Tat.
Brinkmanns bis heute verehrtes Kultbuch »Rom, Blicke«, ein kollagiertes Reisetagebuch, das er während seines Stipendienaufenthalts in Rom 1972 geführt hat, ist eine sehr ungewöhnliche, herausfordernde Lektüre. Oder mit dem damaligen FAZ-Kritiker Ulrich Greiner gesprochen, eine echte Zumutung.
Formal könnte man diese Rom-Chronik als eine sehr wilde Mischung aus Tagebuch, Reisebericht, Textbildcollage und Briefroman bezeichnen. Für Furore aber sorgte sie bei ihrer posthumen Veröffentlichung 1979 dann vor allem wegen des skandalträchtigen Inhalts.
Schwang sich Brinkmann in Rom, Blicke, doch nun auch literarisch zum großen Allesbeschimpfer auf und nahm hier vor allem das Romantikideal von Italien als Wiege der Kultur aufs Korn.
Bis dahin galt eine Reise nach Rom sozusagen auf Goethes Spuren unter deutschen Künstlern und Intellektuellen traditionell als ein läuterndes Bildungserlebnis. Doch genau mit dieser alten Wunschvorstellung räumte Brinkmann in Rom Blicke nun brachial auf, indem er schon seine Ankunft in Rom als keineswegs erhebend, sondern als Sturz in die Hölle beschrieb.
Als ich aus dem Zug gestiegen war und eine lange Reihe Wagen entlang ging zur Halle hin, verlängerte sich wieder der Eindruck einer schmutzigen Verwahrlosung beträchtlich. Wieder überall Zapffall. Eine latente Verwahrlosung des Lebens, die sich in der riesigen Menge der winzigen Einheiten zeigt. Ein grauer Zug erschlaffter Reisender. Die stumpfe Monotonie der Bahnhofshalle.
Zwischen den Ankommenden die italienischen Kulis mit großen, eisernen Schubkarren. Ratternder Eisengestelle. Serviles Verhalten, bettelnde Angebote, die aus faden, verblassten Gestalten kamen. Auch ich in Arkadien, hat Goethe geschrieben, als er nach Italien fuhr. Inzwischen ist dieses Arkadien ganz schön runtergekommen und zu einer Art Vorhölle geworden.
Und dann marschiert er tagelang, wenn er in Rom ist, durch die Stadt und fotografiert. Also in dieser Zeit nimmt er so viele Fotos auf wie nie zuvor.
Aber tatsächlich, was er über Rom sagt, ist alles abwertend. Also da gibt es eigentlich keine Passage, in der Rom irgendwie gut wegkäme. Und vor allem nicht die Hotspots des Tourismus. Die alle lehnt er einfach ab. Also das ist alles hässlich, es ist deformiert und sowieso dreckig und nicht weiter akzeptabel. Musik
Brinkmanns Collage-Chronik »Rom-Blicke« war und ist aber nicht nur ein polemisches Rom-Bashing, sondern auch eine ganz grundsätzliche Absage an den kapitalistisch-amerikanischen Lebensstil. Überall in der Stadt entdeckte der Flaneur Zeichen eines weitreichenderen Kulturverfalls, die er als Symptome einer generellen Verkommenheit der westlichen Konsumgesellschaft wertet.
Da heißt es im Buch dann etwa einmal in einem abgedruckten Brief an den Schriftstellerfreund Hermann Peter Piewitt. Lieber Piewitt, mir ist schon klar, dass unser Abendland verreckt ist. Und für mich ist es ein Jammer, fahre ich durch die Gegend und fahre ich durch Menschen, durch Orte, durch Situationen. Eine frohe Botschaft kann ich nicht mehr erblicken. Alles bloß Ramsch. Einschließlich Marx, einschließlich Freud.
Eben Todesmelodien, human verbrämt. Und wie schön, wie aufregend, wie lebenswert wäre eine Kultur, die aus vielen Einzelnen besteht, aus einer Anzahl, die über dem Durchschnitt ist, die ihre Entdeckungen auf den Tisch legen kann, ohne die Verkrüppelung zu fürchten. Musik
Es waren solche Stellen, in denen Brinkmann die Orientierung am Genie als Ausweg aus der Dekadenz empfahl, die viele, vor allem linkspolitische Leser, schockte. So auch den Adressaten des Briefes, den damaligen Marxisten Hermann Peter Piewitt.
der selbst 1979 noch so entsetzt von der Lektüre war, dass er in seiner Spiegelkritik giftete, »Das allgemeine, wenn überhaupt, Ding festmachen durch fanatisch genaues Hinsehen aufs Besondere. Das ist ein gutes Programm, keine Frage. Nur Brinkmann verwendet es in Rom, Blicke, vor allem gegen die Freunde von einst aus der Subkultur.«
Ihnen entgegenstellt er nun die vermeintlich ideologiefreie Subjektivität eines großen Einzelnen, nämlich seine, und fällt damit selbst zurück in die größenwahnsinnigste und verkommenste Ideologie vom großen Einzelnen. Um das gleich zu sagen, ich habe dieses Buch mit wachsendem Entsetzen gelesen. Und je weiter ich beim Lesen vorankam, desto fremder geworden ist mir dieser Kollege, dieser Danunzio aus Vechta-Oldenburg.
Kurzum, Piwitt hielt Romblicke für eine ideologisch brandgefährliche Lektüre und seinen die heroischen Außenseiter feiernden Autor Brinkmann für einen latenten Faschisten.
Neben dieser linkspolitischen Kritik aber war die 450-Seiten-Chronik auch wegen ihrer zahlreichen Lästereien umstritten. Plauderte Brinkmann doch auch völlig ungeniert unschmeichelhafte Interna über seine deutschen Mitstipendiaten aus.
So zum Beispiel über den linksaktivistischen Schriftsteller Peter Koschewitz, der bis 1973 in Rom lebte und nach seiner Rückkehr in die BRD dann folgendes bei Brinkmann über sich lesen musste. »Ich traf einmal den Muff-Schriftsteller Peter Koschewitz. Er hat einige gute Stellen geschrieben, die mich beim Lesen amüsiert haben, aber sonst...«
Ein langer, hässlicher Fingernagel am kleinen Finger. Damit bohrt er sich in den Zähnen herum, einen Bart- und Schnupftabak plus Dose mit Wedel. Hässlich, dass ich eine Anwandlung von Ekel, den ich selten eigentlich spüre, nicht unterdrücken konnte.
Sicherlich. Sympathisch wirken solche Lästereien von Rolf-Dieter Brinkmann nicht. Und doch verströmt seine wuchtige, formal ungewöhnliche, autobiografische Collage-Chronik bis heute eine eigentümliche Faszination. Und zwar nicht nur deshalb, weil Brinkmanns Schimpftiraden hier, ähnlich wie bei seinen Kölner Spaziergangsmonologen, in ihrer pauschalen Unmäßigkeit immer wieder ins bizarr Komische umkippen. Nein.
Das Buch fasziniert vor allem deshalb, weil man hier einem um seine Existenz kämpfenden Schriftsteller begegnet, der sich eben auch selbst in all seiner Verletzlichkeit radikal preisgibt und offenherzig über seine Vorurteile, Ängste und Sehnsüchte spricht.
Neben den Wut- und Lästerpassagen finden sich immer wieder leisere Stellen, in denen plötzlich der empfindsame Poet Brinkmann zum Vorschein kommt. Der seiner Frau Marleen täglich Postkarten aus Rom schreibt oder kurz vor Weihnachten ins Bergstädtchen Olivano aufbricht, um dem Großstadttrubel zu entfliehen und sich hier, geradezu entspannt glücklich, den Freuden des einfachen Lebens hingibt.
Viel Disperates und Widersprüchliches steckt in diesem schwer einzuordnenden Zumutungsbuch. Zeitkritiker Rolf Michaelis hatte schon vor mehr als 45 Jahren geschrieben, Von diesem Buch im Großformat kommt man schwer wieder los. Nicht nur, weil die von Brinkmann in die Texte geklebten Fotos, Postkarten, Stadtpläne, Fahrkarten, Zufallsfunde aus Werbebroschüren und Zeitungen die Fantasie anregen,
sondern weil man hin und her gerissen wird zwischen Widerspruch und Zustimmung, Wut und Bewunderung. Das zweite Werk der neuen Subjektivität, mit dem sich Rolf-Dieter Brinkmann dann nach 1970 erfolgreich in den deutschen Literaturkanon einschrieb, war und ist sein letzter Gedichtband »Westwärts 1 und 2«.
Tragischerweise, wenige Tage nach seinem Unfalltod, im Mai 1975 erschienen, war es ein Buch, das den Dichter auf einen Schlag zurück auf die große Literaturbühne brachte und die deutschsprachige Lyrik tatsächlich revolutionierte.
Denn mit traditionellen Gedichten hatten die assoziativ sprunghaften und filmschnittartig zusammenmontierten Erlebniswirbel, die Brinkmann in seinem Westwärtsband versammelt hatte, wahrlich nichts mehr zu tun.
Oder wie er selbst seinem neuen Ruwold-Lektor Jürgen Mantei mitteilte, Es ist ein subjektives Buch, ohne Rücksicht auf die herrschenden Konventionen, und kann auch ebenso gut als ein zusammenhängendes Proserbuch, Gedichtbuch wie Essaybuch gelesen werden. Abgeschaut hatte sich Brinkmann diese revolutionär neue, form sprengende und selbstreflexive Versprosa einmal mehr bei den US-Beat-Poeten.
Vor allem bei William Carlos Williams. Ähnlich wie Williams' episches Langgedicht Patterson kann man auch Brinkmanns Westwärtsgedichte wie ein einziges langes fragmentarisches Selbstgespräch lesen.
Oder auch wie eine lyrische Autobiografie aus Gedankenschnipseln, wie Töteberg meint. Diese Gedichte, häufig haben sie nicht nur verschiedene Strophen, sondern auch einzelne Teile, die auch wechseln können. Es ist sehr viel mehr Realität drin und das ist auch etwas, mit dem er experimentiert und versucht dann auch da schon mehr strengig zu arbeiten.
So wie Arno Schmidte in der Prosa teilweise dreispaltig arbeitet, so versucht er eigentlich auch schon in mehreren Teilen links und rechts zu referieren. Es ist auch ein Versuch,
eine neue Form im Gedicht zu finden. Überzeugt davon, dass Sprache als Erkenntnisinstrument letztlich nichts taugte, wählte Brinkmann für seine Westwärtsgedichte ganz bewusst das Fragment, also die sprachliche Trümmerform als zentrales Stilmittel. Und er versuchte sein Kopfkino, in dem oft gleich mehrere Gedanken auf einmal durcheinander funkten, auch typografisch als Vielstimmenchor sichtbar zu machen.
Das gilt besonders für die beiden langen, mehrspaltigen Titelgedichte westwärts, die in Anspielung auf die US-amerikanische Siedler-Track-Bewegung von hoffnungsfrohen Aufbrüchen des Dichters Brinkmann erzählen. Zum einen von seinem Aufbruch in Richtung USA, nach Austin, Texas, wo er 1974 als Gastdozent für ein Semester an der Universität unterrichtete. Zum anderen von seiner Reise zurück nach Köln, ins traurige alte Europa, wie es heißt.
In beiden Titelgedichten aber erweisen sich die Westwärtsaufbrüche für das lyrische Ich als illusionär. Brinkmanns letzter Gedichtband, 1975, ist deshalb nicht zu Unrecht als Abschied des einstigen Popdichters von der US-Popkultur gelesen worden. Ganz offensichtlich hatte sich deren hedonistisches Freiheitsversprechen für den Konsumkritiker aus Köln nicht erfüllt.
Aber trotz aller formaler Gebrochenheit und ihres desillusionierten Sounds klingt aus diesen Westwärts-Gedichten eine betörende Widerständigkeit des Dichters heraus, mit der er schon im Vorwort beteuert, allen Kränkungen zum Trotz unbeirrt weiterzumachen. Spürbar durch seine Krise verändert, findet Brinkmann in Westwärts einen neuen, zeitlos existenziellen Ton, so wie im Gedicht »Gedicht«.
Zerstörte Landschaften mit Konservendosen. Die Hauseingänge leer. Was ist darin? Hier kam ich mit dem Zug nachmittags an. Zwei Töpfe an der Reisetasche festgebunden. Jetzt bin ich aus den Träumen raus, die über eine Kreuzung wehen. Und Staub, zerstückelte Pavane, aus totem Neon, Zeitungen und Schienen. Dieser Tag, was kriege ich jetzt? Einen Tag älter, tiefer und tot.
Er hat gesagt, dass sowas Leben ist. Ich gehe in ein anderes Blau. Das hat eigentlich nicht mehr so viel mit Popliteratur zu tun. Er wird dann wirklich doch ein richtiger Lyriker und nicht nur ein Dichter, der versucht, Einflüsse aufzunehmen. Musik
Zur Tragik von Rolf-Dieter Brinkmann gehört nicht nur, dass er am 23. April 1975 quasi auf der Schwelle zu seinem Comeback starb, sondern auch, dass seine Wandlung vom Pop-Provokateur zu einem eigenständigen Lyriker viele gar nicht mehr mitbekamen, weil sein Opus Magnum westwärts eben gleich nach seinem Tod erschien und vier Jahre vor seinem Wutbuch »Rom blicke«.
Diese achronologische Publikationsgeschichte führte prompt dazu, dass Brinkmann heute vor allem als Provokateur in Erinnerung geblieben ist.
Tragischerweise, sagt Markus Fauser. Er hält die posthume Publikationspraxis der Brinkmann-Witwe Marleen, wie viele Wissenschaftler, nicht nur aus diesem Grund für fragwürdig, sondern ist auch davon überzeugt, dass Brinkmann selbst nie einer Veröffentlichung von »Rohen Blicke« zugestimmt hätte. Also das Buch hätte sicher nicht so ausgesehen, wie Marleen Brinkmann es herausgegeben hat.
Niemals hätte Brinkmann solche Bücher publiziert, die also auch ästhetisch nicht seinen hohen Erwartungen entsprachen. Denn das sind ja einfach wiedergegebene Briefe. Noch nicht mal besonders anspruchsvoll zusammengestellt. Der Buchdruck ist in Schwarz-Weiß gehalten. Also noch nicht mal die Farbe hat man investiert, um Romblicke wiederzugeben. Also schon was die äußere Erscheinung des Buches angeht, ist das eine fragwürdige Sache. Und alle späteren Publikationen auch.
Ähnlich wie ihr Mann hatte Marleen Brinkmann große Vorbehalte gegenüber Philologen, die Rolf-Dieter Brinkmann zu Lebzeiten gern als Philologen verspottete, also wie das Vieh.
In den Jahren und Jahrzehnten nach Brinkmanns Tod verwehrte sie Wissenschaftlern darum den Zugang zum Nachlass und brachte die Bücher ihres verstorbenen Mannes weitgehend eigenmächtig heraus. Leider jedoch ohne die nötige Umsicht, kritisiert Markus Fauser. Sie hat es nicht nach editorischen Prinzipien gemacht, sondern...
Sie hat das ausgewählt, was ihr gefallen hat, was sie überzeugt hat und das hat sie dann publiziert. Also wir haben hier von Einzelnen der Gedichte tatsächlich bis zu 18 verschiedene Fassungen und sie hat irgendeine genommen, die sie für erwähnenswert hielt, die hat sie publiziert.
Also so kann man das natürlich heute nicht mehr machen. Über 40 Jahre lang entschied Marleen Brinkmann nach gut Dünken, welche Texte in welcher Form aus dem Nachlass ihres Mannes veröffentlicht wurden und nahm damit großen Einfluss auf die Wahrnehmung von Rolf-Dieter Brinkmann nach seinem Tod.
Nun aber wurde kürzlich eine Wende im jahrzehntelangen Streit eingeläutet. Nachdem Marleen Brinkmann in ein Altenheim umziehen musste, hat sie den Nachlass freigegeben. Und da rief mich dann der Anwalt an. Das Anwaltsbüro hat mich gefragt, ob wir Interesse hätten an den Resten, die in dem Hause liegen. Da habe ich gesagt, selbstverständlich wollen wir das haben.
Ich musste über Nacht einen Transporter organisieren, bin sofort hingefahren und habe dann erfahren von diesem Anwalt, dass man vorher im Stadtarchiv Köln angerufen habe und das Stadtarchiv Köln hätte kein Interesse gehabt an dem Nachlass.
Ich habe dann die 20 Taschen, die ich dort vorgefunden hatte, das Haus war komplett leer. Also es war bereits von einer Entrümpelungsfirma ausgeräumt. Und man hatte nur irgendwelche Reste in Kaufhaustaschen eingepackt und in der Wohnung im Wohnzimmer stehen lassen. Die habe ich dann eingepackt und mitgenommen und dann hier zunächst in Vechta ein halbes Jahr eingelagert in unserem Archiv.
Da waren auch sehr viele Bücher dabei. Inzwischen hat Fauser die meisten dieser Dokumente ans Literaturarchiv in Marbach weitergegeben, sodass der Brinkmann-Nachlass nun nach Jahrzehnten wissenschaftlich erforscht werden kann.
Allerdings ist einiges wohl abhandengekommen. Davon berichtet nicht nur Markus Fauser, sondern auch Michael Töteberg, der die neu eingetroffenen Materialien in Marbach bereits sichten konnte. Also es fehlt sehr viel. Es fehlt auch Auffälliges, wo man sagen würde,
Das ist nicht irgendwie, weil die Leute das Zimmer geräumt haben, sondern es haben schon vorher mal Leute geplündert, die durchaus wussten, was sie da mitnahmen. Wer da vorher mal Zugang hatte, während Marlenen im Heimbau, wer da alles irgendwie mal drin war, das weiß man nicht und das kriegt man auch nicht raus. Nur ich werde nochmal irgendwann demnächst ein kleines Gutachten schreiben, wo ich dann auch schreiben werde, welche auffälligen Lücken es gibt.
Wurden also womöglich Dokumente aus dem Brinkmann-Nachlass gestohlen? Es würde auf eine makabere Weise passen zu diesem tragisch unvollendeten Schriftstellerleben. 50 Jahre nach Brinkmanns Tod ist die deutsche Literaturwelt noch lange nicht fertig mit diesem anarchisch-anstößigen, immer wieder auch frauenverächtlichen und doch erstaunlich hellsichtigen Autor. »Mit Wut auf alles und Zweifeln an allem«
Eine Sendung von GISA Funk. Es sprachen Lisa Biel, Martin Bross und Joachim Eich. Ton und Technik Christoph Rieseberg und Thomas Wittig. Regie Burkhard Reinertz. Redaktion Hans-Dieter Heimendall.
In der dritten Stunde der Langen Nacht über Rolf-Dieter Brinkmann hören Sie Auszüge aus Gesprächen, die wir anlässlich seines 50. Todestages gemeinsam mit dem Literaturhaus in Köln veranstaltet und dort am 9. April mitgeschnitten haben. Mit dabei sind die Biografin Alexandra Basar, die Weggefährtin Linda Pfeiffer und der Literaturwissenschaftler Roberto Di Bella. Musik
Mein Name ist Gisa Funk. Ich bin Literaturkritikerin, Autorin, hauptsächlich für den Deutschlandfunk. Und es geht heute um Rolf-Dieter Brinkmann, geboren am 16. April 1940 in Vechta, also in der nordwestdeutschen Provinz. Und dann leider sehr früh verstorben in London bei einem Autounfall am 23. April 1975, also mit knapp 35 Jahren.
Und jetzt gibt es endlich, muss man sagen, eine erste vollständige Biografie über den Autor und Dichter Rolf-Dieter Brinkmann. Sie heißt Ich gehe in ein anderes Blau. Geschrieben hat sie Alexandra Waser, die ich nochmal herzlich begrüßen möchte. Vielen Dank. Und Michael Töteberg, der jetzt leider heute nicht da sein kann.
Rolf-Dieter Brinkmann ist jetzt fast 50 Jahre tot. Es gab viele autobiografische Aufzeichnungen von Ihnen, nicht nur diesen Monolog. Trotzdem hat es doch relativ lange gedauert, nämlich fast 50 Jahre, bis jetzt die erste offizielle Biografie über ihn erschienen ist. Was glauben Sie, Frau Waser, als Biografin, warum hat das so lange gedauert damit? Es gibt...
Mehrere Gründe dafür, denke ich. Also das eine ist sicherlich, dass seine Frau Marlene nicht ganz einfach war und viele Anfragen abgeblockt hat. Das ist aber nur das eine. Denn es gibt auch andere Biografien, die erschienen sind, wo der oder diejenige sich geweigert hat, Auskunft zu geben.
Oder Dokumente herausdrücken. Trotzdem gab es Biografien. Das kann vielleicht auch damit zusammenhängen, dass man Verlage angeschrieben hat, die kein Interesse gezeigt haben. Also es wundert mich ehrlich gesagt und das kann man glaube ich nicht alleine auf die Witwe schieben.
Jetzt haben wir trotzdem Marleen Brinkmann schon mal erwähnt. Also es ist ja so, nachdem Rolf-Dieter Brinkmann sehr abrupt, muss man ja auch sagen, und sehr plötzlich bei diesem Autounfall in London ums Leben kam, ist der Nachlass dann an sie gegangen als Witwe. Und sie hat danach ja eigentlich lange, jahrzehntelang so die Zusammenarbeit mit Literaturwissenschaftlern, insbesondere mit Literaturwissenschaftlerinnen verweigert. Kann man das so sagen?
Das kann man im Großen und Ganzen so sagen, ja.
Wie bewerten Sie das so im Nachhinein? Es gab ja dann doch auch relativ viel Streit um diesen Nachlass, der eben bei der Witwe hier in Köln zu Hause lagerte. Niemand wusste so ganz genau, was ist denn da noch an Dokumenten? Also ich finde, das sind zwei Dinge. Als Literaturwissenschaftlerin, die ich ja selbst bin, kann ich natürlich den Ärger meiner Kollegen und meiner Kollegin verstehen. Man hätte gerne alles gut konserviert, greifbar und einsehbar.
Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass man glaube ich auch ein wenig verstehen muss, dass Marleen an den Dokumenten, die quasi ja auch für sie ihren Mann auch ausgemacht haben, gehangen hat und auch…
selbst versucht hat, Dokumente aus dem Nachlass zu veröffentlichen und das ja auch getan hat. Das ist so ein bisschen, finde ich, diese beiden Seiten, die man da berücksichtigen sollte. Hatten Sie denn auch Kontakt zu der Witwe? Ich glaube, jetzt ist ja auch so ein neues Kapitel aufgeschlagen. Also wir haben zwar zusammen die Biografie geschrieben und wir hatten auch überlegt, haben uns dann aber dagegen entschieden, weil Michael Töteberg Marleen schon seit vielen, vielen Jahrzehnten kennt.
Und wir hätten es einfach falsch gefunden, wenn da auf einmal so eine ganz neue, ihrfremde Person auftaucht. Das hat also mein Co-Autor übernommen.
Und diese Gespräche sind auch mit eingeflossen oder wie muss ich mir das vorstellen? Also ich glaube, es ist ja jetzt auch eine neue Situation dadurch, dass Marleen jetzt im Altenheim lebt und dass jetzt ja, glaube ich, auch viele Dokumente inzwischen in Marbach sind, im Literaturarchiv, oder? Genau, also die haben eine kleine Reise hinter sich, die Dokumente. Während Marleen sich im Pflegeheim befand, wurde das Haus verkauft und der Putztrupp, der das Haus gereinigt hat,
Dem sagte Gott sei Dank der Name Brinkmann etwas. Der rief wohl bei der Stadt Köln an und fragte, ob man nicht Interesse hätten, hier würden noch 30, 40 Aldi-Tüten mit Papieren liegen. Die Stadt Köln hat gesagt, ja, nur abholen könne man es leider nicht. Daraufhin hat der Reinigungsdienst des Hauses reagiert und dachte, es gibt doch diese Brinkmann-Stelle in Vechta und rief Markus Fauser an.
Der hat sich einen Kleinbus gemietet und ist sofort von Vechta nach Köln gefahren und hat die Tüten erstmal alle gesichert und eingepackt. Die wären also sonst einfach weg gewesen für immer. Also wir hatten das Glück, dass wir so einen ersten Blick in die noch ungeordneten grünen Kartons werfen durften, aber da war einfach noch nichts geordnet.
Brinkmann war ja auch ein manischer Schreiber, das heißt, das sind teilweise kleine Bierdeckel, Einkaufsbars, auf denen notiert wurde, Pizzakartons. Also alles, was wirklich noch in dieser Wohnung war, wurde in diese Kartons gepackt oder beziehungsweise in die Aldi-Tüten und ist mittlerweile in Kartons gelagert.
Also so wie ich das verfolgt habe, war ja immer die große Frage, gibt es da noch etwas, was sozusagen noch ganz unentdeckt ist? Bei Rolf-Dieter Brinkmann zum Beispiel dieser zweite Roman, den er immer schreiben wollte. Oder haben Sie was entdeckt, was nochmal spektakulär neu ist für den Autor? Also der zweite Roman ist so nicht aufgetaucht. Wir haben uns angeschaut, Romanversuche, Ansätze anzuschauen.
Also da gibt es durchaus noch einiges, aber es ist nicht so, dass es 150 Seiten zweiter Roman gibt. Und ich glaube, es gibt noch relativ viele Gedichte, die ja auch zum Teil jetzt in diesen neuen Band, also es ist nicht nur eine Biografie, wo Rolf-Dieter Brinkmann erschien, sondern auch der letzte Gedichtband Westwärts, der ist jetzt nochmal in einer neuen Edition rausgekommen und da sind, glaube ich, einige Gedichte auch neu hineingekommen. Genau.
Es gibt aber auch ganz, ganz, ganz tolle Briefe, beispielsweise in den Briefen an Henning. Und auch die sind noch nicht veröffentlicht. Rolf-Dieter Brinkmann war, glaube ich, ein manischer Briefeschreiber. Er hat, glaube ich, manchmal mehrere Briefe am Tag geschrieben. Mhm.
Ja, also war das so die Hauptquelle für Sie, für diese Biografie? Ja, also außer das Sprechen mit Freunden aus Brinkmanns Leben waren die Briefe wirklich mit eine der Hauptquellen für uns. Vielleicht sollten wir noch sagen, Henning Jond von Freyend ist ein Maler, damals gewesen ein enger Freund von Rolf-Dieter Brinkmann, vor allem dann Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre.
Gut, kommen wir doch jetzt mal auf das Leben oder zum Leben von Rolf-Dieter Brinkmann. Ich habe schon gesagt, 1940 in Vechta geboren, dann ist er ja Schulabbrecher, macht eine Buchhandelslehre und dann lernt er Ralf-Rainer Regula kennen. Und ich glaube, ohne Ralf-Rainer Regula wäre diese Karriere völlig anders verlaufen, oder? Ja.
Das kann gut sein. Also ich glaube, dass wenn man beschließt, Autor zu werden und das hat Brinkmann ja schon sehr früh getan, ich möchte Schriftsteller sein, Ausrufezeichen, und dann braucht man so einen gewissen Widerhall in der Welt. Und dieser Widerhall, der sofort geglaubt hat, ich habe es mit einem Schriftsteller zu tun, war sein Freund Ralf-Reiner Regula.
Wo haben die sich kennengelernt?
Wenn man den Schimpfenden Brinkmann sich so vorstellt, sind Zeichnungen von Brinkmann Liebeswölfchen. Also ganz, ganz herzlich, die beiden haben eine Art Geheimsprache unterhalten. Und an ihm konnte er auch seine Texte ausprobieren. Und Regula hat auch viel verbessert, korrigiert, angeregt.
Ja, was ich erstaunlich fand, als ich Ihre Biografie gelesen habe, ist, das war mir gar nicht mehr so klar, dass Brinkmann ja am Anfang unbedingt Dichter werden wollte. Also gar nicht Prosa-Autor, sondern ganz dezidiert Dichter. Das stimmt. Ja, was waren seine Vorbilder eigentlich erst mal? Das wechselt. Also der junge Brinkmann war sehr Gottfried-Benn-begeistert und schrieb auch am Anfang sehr Ben-esk, würde ich mal so sagen.
Er hat zum Beispiel auch Ben zu seinem Geburtstag ein Gratulationsschreiben geschickt, war aber als Schüler noch ein bisschen unbedarft und wusste nicht mal die Anschrift von Ben. Allerdings Ben so bekannt und berühmt in West-Berlin, es reichte also an den Schriftsteller Gottfried Ben und die Gratulation kam an, da der Postbote einfach die Anschrift ergänzt hat.
Etwas später dann war Hans-Henny Jahn, würde ich sagen, für Brinkmann unglaublich wichtig, den er auch während er sich in Rom aufhält wieder liest. Und das ist, glaube ich, schon eine etwas andere Faszination gewesen, denn das war ein sehr umstrittener Autor, dessen explizite Darstellung von Sexualität und Gewalt
ihn immer so ein bisschen zu einem Außenseiter in der Literaturszene gemacht haben. Und ich glaube, das bringt man da schon, dieses Außenseitertum sehr schätzte. Also heute bekannt vor allem ist er ja als Erfinder der deutschen Popliteratur, sagt man. Und natürlich so als Provokateur und als Wüterich der Literatur der 1960er und 70er Jahre, auch als Skandalautor vielleicht.
Bleiben wir doch vielleicht mal bei der Popliteratur, weil wir gerade schon bei Ralf-Rainer Regula waren. Ja, Ralf-Rainer Regula war dafür wichtig, dass Rolf-Dieter Brinkmann dann überhaupt die US-Popliteratur oder Underground-Literatur entdeckt hat. Von den Beat-Poeten, von der New York School of Poetry, also ja, worum ging es da? Was hat ihn so elektrifiziert damals?
Ich glaube, was ihn elektrophilisiert hat, und das ist dann auch der Sprung zu dem, was man Pop nennen könnte, war einfach die Präsenz der Gegenwart in diesen Texten. Es ging um Alltag, es ging um die eigene Sexualität, es ging darum, dass man, wie Fiedler das so schön sagte, die Grenzen geschlossen hat und populär mit Hochkultur verbunden hat.
dass man auch gemeinsam produziert hat, möglicherweise auch gemeinsam unter Drogenrausch und Einfluss produziert hat, dass die Bedeutung der Musik in den Texten, einfach weil Musik wichtig war, mit reinspielt, ebenso wie die Filme, die man schaute.
Also es war schon so Sex, Drugs und Rock'n'Roll auch irgendwo, oder? Ja. Also auch mit so expliziten Comics sind da ja auch, es sind ja nicht nur Texte, es sind ja auch Comics und so weiter. Ja, die beiden bringen dann diese Pop-Anthologien heraus, also Regula 1967 Fuck You und also schon die Titel sagen ja einiges. Und dann eben 1969 kommen dann Acid und Silver Screen, das macht dann, bringt man mit Regula zusammen. Und
Und diese Bücher, also diese auf Deutsch übersetzten US-Underground-Texte, die schlugen dann ja in Westdeutschland ein wie so eine Bombe, oder? Warum zündete das damals so? Also ich denke, dass es genau der richtige Zeitpunkt war. Es gab vorher in Deutschland schon die ein oder andere Veröffentlichung, die
Die flatterten aber so unter ferner Liefen dahin und 69 war einfach das Jahr, wo man auch in Deutschland sich für diese provokanten Themen, Dirty Speech, explizite Sexualität interessierte. Und Acid erschien wirklich genau zum richtigen Zeitpunkt.
Und war gleichzeitig auch eine absolut umfangreiche Anthologie, also 480 Seiten ungefähr. Acid wurde auch immer größer. Brinkmann und Regula wurden damit nicht fertig, weil Brinkmann ständig noch andere Texte angeschleppt hat, die er auch mit reinnehmen wollte und unbedingt musste.
Gleichzeitig war das gar nicht so einfach, das zu übersetzen, weil viel auch in dem amerikanischen Umgangsjagdgeschrieben war. Ja, wie haben die das dann gelöst, also wenn sie das nicht selber übersetzt haben? Also größtenteils hat man es selbst übersetzt, man hat Übersetzer hinzugenommen, man hat Jörg Schröder, also vor allem Brinkmann, angeschrien, er solle sich endlich um vernünftige Übersetzer kümmern, so ginge das gar nicht.
Ja, die Produktion hat sich hinausgezögert. Gleichzeitig hat man aber so sehr an den eigenen Band geglaubt, dass man bereit war, auf Honorar zu verzichten. Die beiden haben Tag und Nacht an diesem Band gearbeitet. Und das ist einfach, wer ihn vor Augen hat, es ist ein ganz liebevoller Band. Das schreiben sie auch, das Projekt hat den beiden Autoren, auch wenn sie nicht immer einer Meinung waren, in erster Linie eins gemacht, nämlich Spaß.
Ja, trotz allem glaube ich, haben die beiden sich dann ja auch irgendwann zerstritten. Also sie waren so engste Kumpels. Ich fand auch interessant, in ihrer Biografie zu lesen, das bringt man ja auch ein manischer Arbeiter wohl wahr. Also das war jetzt nicht so ein Luftikus, sondern der hat im Grunde Tag und Nacht geschrieben und gearbeitet und an diesen Texten gefeilt, oder?
Das hat auch unter anderem zum Zerwürfnis mit Ralf-Rainer Regula geführt, der gesagt hat, er kann dieses Arbeitspensum einfach nicht mehr mitgehen. Brickmann hat ständig gearbeitet, vieles immer wieder und immer wieder korrigiert, verbessert, neu arrangiert. Das muss man erst mal mitgehen. Gut, aber es war schon auch als Provokation gemeint, dieser Asset-Ban und Silverscreen. Also die wollten schon auch Tabus damit brechen, oder? Ja.
Da bin ich mir gar nicht so sicher, ob es in erster Linie darum ging, Tabus zu brechen. Meiner Meinung nach ging es darum, neue Literatur zu entdecken. Und zwar Literatur, die für diese Generation relevant ist. Fernab von dem, was man vorher so las. Also man hat das Cover nachträglich etwas sexualisiert, klar. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein Hauptgrund oder Beweggrund war. Okay, man merkt schon ein...
durchaus selbstbewusster, auch zur Radikalität neigender junger Mann, der ja dann immer mehr zu diesem wüterig und zu diesem angry young man der deutschen Nachkriegsliteratur wird. Das ist ja so das zweite Image, das Rolf-Dieter Brinkmann immer noch hat. Ja, was würden Sie sagen? Es gab ja auch einige Eklats. Also er hat sich diesen Ruf ja auch erarbeitet, oder? Ich weiß nicht, ob er wirklich daran gearbeitet hat, dass er zum Orphan-Terribel wird, aber...
Er hat schon einiges getan, dass man ihn so bezeichnet hat. Vom Bücherklau im Verlag, über Beschimpfungen seiner Verleger, wo man, finde ich, einfach sagen muss, wie tolerant man auch oder nett man gegenüberbringt man war, dass man immer wieder sich hat bepöbeln lassen oder anschreien und dann doch noch mit ihm als Autor weiterarbeiten wollte.
Also auch dieser erste und letztlich einzige Roman von Rolf-Dieter Brinkmann, Keiner weiß mehr, war ja ein Skandalroman. Also er hatte sozusagen dann auch irgendwie dieses Image weg, dieses provokanten Autors. Ja, warum war der eigentlich so skandalös, dieser Roman?
Der Roman war deshalb so skandalös, weil er unter anderem sogar nachträglich von Brinkmann und Regula aufgesext wurde. Aufgesext. Aufgesext, also man hat die Sexstellen ausgearbeitet. Und ich glaube, er war deshalb so sehr ein Skandal, weil das sehr ehrliche sexuelle Szenen sind. Also das sind weniger Sexszenen, wo ein Mann beschreibt, wie toll und potent er ist,
Sondern es geht so ans Eingemachte, an Probleme in einer Beziehung, ein Mann, der keinen hochbekommt. Die Frage, wie man in einer Beziehung oder Ehe mit Kind sexuelles Verlangen aufrecht erhalten kann. Gleichzeitig aber auch um Alternativen, die sich die Romanfigur, die sehr nah an Brinkmann ist, anschaut. Das ist die Beziehung, die sein homosexueller Freund führt.
Die sind sehr kurzweilig und für ihn auch keine Lösung. Und parallel dazu gibt es noch einen dritten Mann im Bunde, der wechselnde Partnerinnen hat und sich mit seinem Anbietern, gerade an jüngere Frauen, eigentlich lächerlich macht. Also auch das keine Option, wie man ein glückliches Leben und eine erfüllte Sexualität führen könnte.
Karls Burra sagte damals, es ist so ein erster deutscher Pop-Roman. Er hatte damit also quasi zwei Labels als Provokationsautor, Skandalautor, der also ganz offen über Sex auch drastisch sterb schrieb und eben auch als Pop-Autor. Und dann wird er ja eigentlich immer erfolgreicher und ist eigentlich gerade auf dem Höhepunkt seiner Karriere und dann kommt dieser plötzliche Rückzug ab 1970. Wie ist das zu erklären?
Also ich könnte mir vorstellen, dass Brinkmann durchaus ausgelaugt war, weil er vorher unglaublich viel gearbeitet und produziert hat. Das ist das eine. Ich halte es aber auch für wahrscheinlich, dass jemand, der so autofiktional geschrieben hat, einfach neue Themen oder neue Herangehensweisen suchte und die nicht gefunden hat ad hoc. Und es ist ja auch nicht ganz richtig, dass er in der Zeit dann gar nichts mehr gemacht hat, denn von irgendetwas musste er ja leben.
Der Rundfunk hat ihn da Gott sei Dank gerettet. Also er hat in der Zeit zwei Hörspiele geschrieben und auch erfolgreich verkauft. Im Grunde erfindet er sich ja fast nochmal neu, kann man sagen. Er sucht ja nach so einer neuen Form des autobiografischen Schreibens, kann man so sagen? Ja, das kann man sagen. Sie sagten schon, die Nebenwirkung war, dass er im Grunde auch in die Verarmung abgeglitten ist, oder? Ja.
Also besonders gut finanziell war es nie, aber ab 1970 war es wirklich verheerend. Also Brinkmann war gleichzeitig so sehr davon überzeugt, dass er weiterhin Schriftsteller, Lyriker, Künstler ist, dass er sich natürlich auch geweigert hat, einer anderen Arbeit nachzugehen. Gelernter Buchhändler wäre möglich gewesen, hat er aber nicht getan und
Das hat an allen Enden und Ecken, das Telefon wurde abgestellt, Brinkmann musste seine geliebten Bücher mehrmals verkaufen. Ich glaube, Zettelstraum viermal hintereinander, immer mit einem weinenden Auge betont.
Für Bücher hat man damals noch Geld bekommen. Ja, und dann ja auch mit Ehefrau. Und vor allem haben wir auch noch nicht erwähnt, er hatte ja ein Kind, ein schwer geistig behindertes Kind. Also er hatte wirklich auch eine große Verantwortung. Das ist ja eigentlich fast eine unerträgliche Situation dann für ihn. Ich habe mich wirklich gefragt, warum hat er dann auch noch den Vertrag bei Kiwi gekündigt letztlich? Also er war beim Kiepenheuer & Witsch Verlag.
Hatte einen Optionsvertrag, das war ja auch nicht viel Geld, aber ein bisschen Geld zumindest. 500 Mark im Monat, sicher wenigstens das. Und selbst das hat er ja dann irgendwann, ich glaube Anfang 1972 gekündigt. Er hat dann auch noch versucht, nach dieser Kündigung mit Kiwi weiterzuarbeiten. Also es gab noch einen Vertrag, für den er auch noch einen Vorschuss erhalten hat, meine blauen Wildlederschuhe.
Den hat er aber dann aber nicht mehr abgegeben und das war dann der endgültige Bruch mit dem Verlag.
Ich glaube, wir müssen zum Abschluss dieses Gesprächs unbedingt noch darauf zu sprechen kommen, dieser neue Schreibansatz im Grunde von ihm. Also das verfolgt er dann ja ganz radikal weiter, im Grunde sein Leben mit zu protokollieren im Hier und Jetzt. Also das ist ja so ein quasi dokumentarischer, aber doch radikal subjektiver Ansatz von einer autobiografischen Literatur. Oder wie würden Sie das beschreiben, was er dann eigentlich macht?
in den 70er Jahren eben auch mit den Collagebüchern und im Grunde ja dann auch mit seinem letzten Gedichtmand. Also ich glaube, man kann schon sagen, dass das, was er versucht und ich finde auch, was ihm häufig gelingt, ist wirklich sein Film in Worten.
durch minutiöse Momentaufnahmen, Zeitsprünge, die eine bestimmte Sicht ausgelöst haben und die ihn immer wieder in seine Kindheit und Jugend zurückführen. Das Einbinden von Musik, die er gerade gehört hat. Wir kommen bestimmt nachher auch noch mal darauf zu sprechen, wie im Prinzip die Fotografie thematisch das geschriebene Wort auslöst.
Also ist so auch dieser intermediale Ansatz bei ihm zu erklären. Er macht ja auch Filme, er knipst viel. Also ist das auch dieser Versuch? Ich glaube, ihn treibt dann ja auch so eine Sprachskepsis. Er will ja auch wegkommen von diesen Denkmustern und von diesen Sprachmustern. Er will ja im Grunde das pure Erleben einfangen. So habe ich das verstanden. Am Ende spricht er dann immer davon, dass er sich eigentlich nach Stille sehnt, nach wortloser Stille.
Das ist natürlich für einen Schriftsteller schon etwas merkwürdig. Oder wie würden Sie das sagen? Das klingt natürlich erstmal etwas absurd und merkwürdig. Aber tatsächlich finde ich, dass es gerade in diesen Gedichten wirklich so zarte, ruhige, stille Momente gibt, die unvermittelt auftreten und so durch das Laute, Hässliche, den Alltag verbreiten.
hindurch scheinen. Und das ist vielleicht auch kein Zufall, das bringt man sich dann wieder, der Lyrik zugewendet hat, weil er dort glaubte, diese Stille noch am ehesten finden zu können oder diese Ruhe. Wie aktuell ist diese Art des Schreibens, dieser Wunsch in Literatur quasi das
pure Erleben, die Essenz des Daseins, sage ich mal pathetisch, einzufangen. Ich würde es ein bisschen anders formulieren. Ich glaube, was man vorhin gehört hat und was so aktuell geblieben ist, ist dieser Brinkmann-Sound. Und der könnte heute gesprochen sein oder von jemandem heute, hier und jetzt. Und das ist, glaube ich, das, was ich zumindest für die Gegenwart, was mich jedes Mal wieder aufs Neue kickt und mitreißt.
Ich glaube, dass sich hinter diesem rotzigen Punking eine eigene Weltsicht verbirgt. Und dass wir diese Weltsicht gelegentlich einfach auch, dass man die teilen und mitgehen kann, zumindest ein Stück weit. Ich würde sagen, das reicht vielleicht erstmal als Einstimmung und dann werden wir gleich das Ganze nochmal in der Diskussion vertiefen. Vielen Dank.
Nach der ersten Stunde wollen wir jetzt die Diskussion um Rolf-Dieter Brinkmann etwas vertiefen an diesem Gedenkabend für ihn zu seinem 50. Todestag. Und dazu begrüße ich in dieser Runde neben Alexandra Waser, der Biografin, jetzt auch Linda Pfeiffer, Schriftstellerin und eine enge Weggefährtin von Rolf-Dieter Brinkmann.
so wie auch Roberto Di Bella. Er ist Literaturwissenschaftler an der Universität Siegen und hat sich in dem Sonderforschungsprojekt Transformation des Populären ja schon, beschäftigen Sie sich schon länger mit dem Autor. Und Roberto Di Bella hat auch einen sehr interessanten Online-Blog geschrieben,
Rolf-Dieter Brinkmann minus wildgefleckt. Ist jedem zu empfehlen, der Interesse hat an diesem Auto. Da findet man Analysen, Interviews, Neuigkeiten über Rolf-Dieter Brinkmann.
Wir waren ja zum Schluss gerade dabei bei diesem typischen Brinkmann-Sound und zur Einstimmung jetzt nochmal ein Statement des Kölner Autors aus dem Jahr 1973, ein sehr berühmtes Statement von ihm. Ein gelbschmutziger Himmel, ein gelbschmutziger Himmel, ein gelbschmutziger Himmel über mir.
Ein gelbschmutziger Himmel, ein gelber schmutziger Himmel, ein mieser, gelber, dreckiger, schmutziger Kölner Himmel, ein mieser Himmel, ein verdammter Scheißdreck von Himmel, ein mieser, gelber, schmutziger, Kölner, verfluchter, elender Kackhimmel, ein von Lichtfetzen zerkackter Himmel, ein mieses Stück Köln.
Ein Kackhimmel, ein riesiges Scheißdreck von Himmel jetzt in diesem Augenblick. An dieser Bahnstelle, entlang der Bahn, zwischen diesen toten Bäumen, vor der Stadt, rings um Häuser, Kästen. Ein elendes Miststück von Himmel, ein mistig gefärbter Scheißdreck. Ein Scheißdreck, ein Scheißdreck.
Überall ein Scheißdreck, ein elender Mist. Ja, soweit die berühmte Wut-Tirade von Rolf-Dieter Brinkmann auf den angeblich schmutzig-gelben Himmel über Köln, den er 1974 für sein WDR-Hörspiel Die Wörter sind böse verwendet hat. Wir haben es gerade gehört, da wird Rolf-Dieter Brinkmann ja eigentlich diesem Image des Wüterichs ziemlich gerecht, oder Frau Pfeiffer?
Das kann man vielleicht jetzt nicht abstreiten, aber ich möchte doch mal sagen, ich finde, das ist schon ein Klischee. Und meiner Meinung nach sind das zwei verschiedene Motivationen. Also manchmal ist es Provokation, also auch literarische Provokation, je nachdem, welcher Text oder was es jetzt ist.
Andererseits ist das aber, weil ich das ja real im Leben auch da miterlebt habe mit Brinkmann, weil er war ja auch manchmal im privaten Umgang auch so, dass er sehr extrem werden konnte. Da fragt man sich vielleicht, warum macht er das? Oder warum steigert er sich so in gewisse Dinge hinein? Das ist, glaube ich, so...
Man will ja irgendwie etwas herausfinden als schreibender Mensch, dass man das eben wirklich bis zum Äußersten treibt. Und das können Sie jetzt nicht rein formal nur machen, sondern das müssen Sie wirklich durchleben. Man muss irgendwie in seinem Leben tatsächlich bis zum Äußersten gehen, um so eine Klarheit zu gewinnen. Herr Roberto Di Bella nickt dazu. Ja, ich würde da gerne ergänzen, was das Stichwort Himmel angeht.
Es gibt ein Pendant dazu und das steht in Rom Blicke. Es ist ja auch bekannt, dass Rolf-Dieter Brinkmann in der Villa Massimo 1973 sich aufhielt, aber was vielleicht weniger bekannt ist, dass er auch in einem Ort, so 70 Kilometer von Rom entfernt war, in Olevano Romano, wo die Villa Massimo eine Künstler-Dependanz hatte, ganz einfach gesagt.
Brinkmann musste sich sein Holz selber holen und den Ofen heizen und blickt in den Wolkenhimmel von Olewano und es gibt fantastische Beschreibungen dieses Wolkenhimmels in Olewano, die in Ruhm Blicke gegen Ende erscheinen, die wahre Farborgien sind. Vielleicht muss man das ein bisschen gewissermaßen, ja, den dreckigen Kölner Himmel, wo aber vielleicht was durchblitzt und den Olewano Himmel, den er quasi fast als berauschend empfindet.
Frau Waser, Sie haben sich geoutet, dass Sie im Grunde süchtig nach diesem Brinkmann-Schimpf-Sound sind, sage ich jetzt mal. Das hat ja auch so ein komisches Kippmoment, glaube ich, oder? Genau, also wir haben das eben gerade gemerkt. Wir haben alle oder einige von uns gelacht, gelächelt, denn das löst und entspannt. Und das ist zum Beispiel auch eine Strategie, die Wiederholung der Wiederholung der Wiederholung mit kleinen Verschiebungen. Und das macht und bewirkt einfach auch was beim Publikum.
Also außer Genervtheit im schlechten Fall und im guten, das löst, das erlöst. Also war es auch so eine Charaktereigenart von ihm, dass er dann wütend wurde oder wie erklärt sich diese enorme Wut, die er hatte?
Ja, der hat was gesucht. Also ich meine, er war auf irgendeinem Weg und hat sich dann nicht aufhalten lassen und wurde von einer Wut getrieben, weil er irgendwie sich in die Enge gedrängt fühlte, durch was auch immer. Und der ist dann ohne Rücksicht auf Verluste immer weitergegangen. Also das Stichwort der Suche, das würde ich absolut unterschreiben. Vielleicht insgesamt für sein Werk, aber speziell jetzt mit Blick auf diese letzten Jahre, wo er ja auch schon öfters über den Rückzug ging.
und die Isolation gesprochen wurde. Es gibt einen sehr schönen Satz von Walter Benjamin, ich weiß nicht, ob Brinkmann den gelesen hat, ein Text von 1931, der heißt Der destruktive Charakter. Und da heißt es von Benjamin, der destruktive Charakter sieht nichts Dauerndes, aber eben darum sieht er überall Wege. Das Bestehende legt er in Trümmer, nicht um der Trümmer, sondern um des Wegeswillen, der sich durch sie hindurchzieht.
Wenn man dann ein Buch oder ein Dichtband eben wie Westwärts 1 und 2 nimmt, wo eher schon im Titel gewissermaßen die Bewegung eingeschrieben ist und in sehr, sehr vielen Gedichten eben bringt man oder das lyrische Ich sich durch die Städte, durch die Zeiten, durch die Erinnerungen bewegt, dann ist das genau das, was passiert. Es ist eine Suche und in dieser Suche gibt es halt eben auch diese dialektischen Momente von Bedrückung, aber auch von
oder vielleicht sogar eben Erkenntnis. Frau Waser, Sie wollten auch noch was sagen. Hat man das gesehen? Ich hatte so einen Eindruck. Ja, also was mir dazu natürlich einfällt, ist, dass Benjamin der Flaneur schlechthin war.
Und auf seine ganz eigene Brinkmannsche Art war er das ja auch. Also Brinkmann hat all seine Orte erschritten, erlaufen und ja, dabei oft auch erschimpft, aber er hat sie eigener und doch ähnlicherweise wie Benjamin erlebt und wie Benjamin auch darüber geschrieben.
Ich hätte nochmal eine Nachfrage an Herrn Di Bella. Also es ist ja trotzdem merkwürdig, dass er Ende der 60er Jahre, wo er eigentlich als Autor erfolgreich ist, er hat zwei Bestseller auf der Bestsellerliste, er ist ein etablierter junger Autor, national bekannt. Und dann zieht er sich radikal zurück. Also wie haben Sie das denn wahrgenommen?
Da kommen auch, ich sage jetzt mal so ein bisschen kulturhistorisch, auch verschiedene Dinge zusammen. Also zum einen biografisch für ihn persönlich, zum anderen die Beziehung zu Ralf-Rainer Regula wurde erwähnt. Ralf-Rainer Regula ist nach Frankfurt umgezogen, er wurde dort Lektor im März Verlag. Für Brinkmann hat er damit sozusagen die Seite gewechselt, wo die beiden Freunde sozusagen stundenlang, nächtelang über eigene Projekte brüteten, war jetzt der...
Freund auf einmal zum Lektor geworden, der sagte, ja nee, das Projekt können wir aber nicht machen oder ja, du musst jetzt ein bisschen dich gedulden mit der und der Reaktion und dann hat sich Regula selbst zurückgezogen aus dem Literaturbetrieb und Brinkmann fehlte dieser Hallraum.
Es ist die Zeit nach der Revolte. Es gibt eine Ernüchterung, eine fast Depression macht sich breit unter vielen Leuten, die sich dann vielleicht auch zurückziehen und Brinkmann fehlt sozusagen dann auch das Netzwerk. Ja, da möchte ich auch kurz etwas zu sagen.
Man sollte sich ja eigentlich nicht so wundern, dass vielleicht auch mal Wege sich trennen. Denn diese intensive Popzeit, die ja auch sehr attraktiv, interessant, erfolgreich war und alle irgendwie toll fanden, ist ja auch nicht weiter schwierig. Ich meine, das wird man irgendwann auch mal ein bisschen leid. Man entwickelt sich ja weiter. Ich meine, es wurde ja eigentlich besser bei Brinkmann. Also was die Literatur angeht, finde ich...
weil es wurde sehr viel ernsthafter und sehr viel bedeutungsvoller, also für das Menschsein an sich. Also das war jetzt nicht nur irgendwie so eine oberflächliche, interessante, tolle Sache, wie das mit der Popliteratur war, das war ja sehr wichtig.
Es hat eine ganz andere Qualität, das was nachher entstanden ist. Absolut. Er hat sich ja sehr, sehr hart durchbeißen müssen. Also einmal natürlich durch seinen schwierigen Alltag. Übrigens ja nicht nur ein geistig behindertes, sondern auch ein körperlich behindertes Kind. Aber wie tragisch für einen Schriftsteller oder für jemanden, der alles für seine Literatur gibt.
zu erleben, dass das eigene Kind nicht sprechen kann, nur Laute von sich gibt. Das muss man sich ja alles mal vorstellen. Also es war im Grunde ein grauenvolles Schicksal, was er erlitten hat, dann auch durch diese existenzielle Not, also finanzieller Hinsicht.
war schon sehr viel, ein bisschen viel. Aber was Brinkmann eben dann tut, du sagst es eben richtig mit dem sich vertiefen, er beschäftigt sich eben auch sehr viel mit theoretischen Zusammenhängen, um zum Beispiel die Sprachbehinderung seines Sohnes zu verstehen. Also er setzt sich wirklich auch, sozusagen theoretisch, damit auseinander. Er stellt sich total dem ganzen Wahnsinn ab.
von dem er umgeben ist und vielleicht auch seinem eigenen Wahnsinn, der in ihm ist. Das macht auch, glaube ich, letztendlich die Bedeutung seiner Literatur aus, weshalb kommt vielleicht später noch die Frage, aber warum ist Brinkmann heute noch aktuell? Das hat da mit meiner Meinung nach zu tun, weil er sehr tief gegangen ist.
Das muss man erst mal schaffen. Also das kann man ja nicht durch eine Schreibschule oder jetzt mache ich mal hier eine tolle Story und wie baue ich das auf mit Höhepunkt und so weiter. Sondern das ist entweder, haben Sie das für sich selbst erarbeitet und irgendwie geschafft und ein Bewusstsein erreicht, dass Sie das machen können.
Ich würde trotzdem noch mal etwas zurückgehen jetzt. Also er steigt aus 1970, er zieht sich radikal aus dem Literaturbetrieb zurück, er sucht neue Wege, wie Sie gesagt haben.
Und dann kommt er ja oder verfolgt diesen Ansatz, also in der Literaturwissenschaft nennt man das ja auch Ästhetik der Präsenz, also diesen quasi dokumentarischen, radikal-subjektiven, autobiografischen Ansatz, den verfolgt er dann weiter. Wie aktuell ist dieses Schreibprojekt? Was würden Sie sagen, Frau Waser?
Also ich finde das nach wie vor sehr aktuell, denn was kann es Aktuelleres geben, als sich mit seiner direkten Gegenwart auseinanderzusetzen und vor allem, was bei Brinkmann ja reinspielt, ist das Wissen um die Wirksamkeit der Medien und das Einsetzen der Medien insgesamt.
Und da vollziehen sich ja zwei Momente, bringt man in seiner Popphase die Medien und zwar alle, auch das Werbemedium feiert, kann man fast sagen und zelebriert und sich dann beispielsweise in seinen römischen Tagebüchern, die der Verlag dann Rumblicke genannt hat, radikal davon abwendet und das ganz, ganz, ganz kritisch betrachtet.
Ja, und dann kommt die radikale Sprach-Skepsis. Genau, die mit einer Medien-Skepsis eigentlich verbunden ist. Herr Dibella, Sie wollten, glaube ich, auch was sagen? Ja, in dem Zusammenhang, wie aktuell er ist. Sie erwähnten ja meinen Blog und dort habe ich natürlich...
Das war so ein Nebenprodukt meiner Forschung. Und im Zuge dessen habe ich natürlich mit vielen Leuten auch gesprochen. Also mit Linda zum Beispiel, aber auch mit Henning John von Freyend, mit anderen Leuten aus der Zeit, Klaus Willbrand hier aus Köln, aus der Buchhändlerzeit. Und Adrian Kassner hat mal so den Satz gesagt, dass heute da bringt man
Vielleicht zu seiner Zeit erfolgreich war und dann im Laufe der Nachlasspublikationen zu einem Writers Writer wurde. Also dass gerade Schriftstellerinnen und Schriftsteller in seinen Texten, die oft so unfertig sind...
die losen Enden finden, an die sie selbst anknüpfen können. Das ist für einen Leser, der jetzt sozusagen ein Buch genießen möchte in dem Sinne, ohne selbst produktiv dann werden zu müssen, vielleicht unbefriedigend. Aber genau das macht seine Aktualität auch aus, dass so viel Material da ist, was in dem Sinne mit Bildern, mit Tönen, mit Schnitten arbeitet. Und das ist eine Aktualität,
Die hat vielleicht ein bisschen abgenommen, weil vielleicht vor allem die Autorinnen und Autoren der 70er, 80er, 90er Jahre an ihn angeschlossen haben. Aber das sozusagen Unfertige und radikal gegenwartsbezogene. Aber dieses radikal gegenwartsbezogene, also heutzutage gibt es ja diesen Trend zur autofiktionalen Literatur. Also ich sage mal Namen Karl-Uwe Knausgart, Annie Ernaux, Rachel Kass, solche Leute, die ja auch an ihrem eigenen Leben entlang schreiben.
Darf ich nochmal eine kurze Zwischenfrage stellen? Und zwar...
Rolf-Dieter Brinkmann, ist das auch ein Rückzug, ein enttäuschter Rückzug von dieser 68er-Revolte? Ich glaube nicht. Er war zwar hier in Köln natürlich auch, wie soll ich sagen, involviert in bestimmte Kreise. Ja, also ich glaube schon, dass Brinkmann auch ein wenig enttäuscht war und sich vielleicht nicht politisch, aber doch eigentlich irgendwie auch politisch, also gesellschaftlich mehr von 68 versprochen hatte. Und ich glaube auch, dass der Rückzug ein bisschen mit dieser Enttäuschung verbunden ist.
Und Brinkmann hat, glaube ich, gehofft, zumindest eine Zeit lang, dass es eine neue Art des gesellschaftlichen Zusammenlebens entstehen würde. Damit verbunden auch eine neue, andere Art der Kultur, des Miteinanderumgehens. Und es sah für ein kurzes Zeitfenster, und das schreibt er auch häufiger, für ihn so aus, als wäre das möglich. Und dann stellt er fest, nee.
ist doch nichts passiert. Wir sind eigentlich wieder genau da, wo wir vorher waren. Und das ist schon enttäuschend, wenn man sich in dieses Neue im Bereich der Literatur und Kultur so eingebracht hat. Aber das Vehikel war dann eben die Literatur und die Kunst und die Musik. Ja, klar.
Vielleicht noch eine Frage zu Ruhm Blicke. Also es ist sehr lästerlich, dieses Buch, sage ich mal. Es ist aber ja auch wieder frauenverächtlich. Also da werden Frauen oder die Prostituierten, die er da auf der Straße beschreibt, das sind, ja er sagt dann Dosen, das sind aber noch so oder dumme Nüsse, aber das sind noch so die netten Formulierungen, da kommen noch ganz andere Formulierungen.
Wie haben Sie das denn gelesen, Frau Waser oder Frau Pfeiffer? Ich habe Brinkmann nicht als frauenfeindlich empfunden. Stimmte in vielen Dingen gar nicht mit ihm überein oder fand manches auch schrecklich. Einerseits ist es eine Art der literarischen Provokation auch. Also diese pornografischen Sachen natürlich, aber es gibt sogar Leute, die...
Die sagen, die ihn gut kennen, dass er nicht nur nicht frauenfeindlich war, sondern ein großer Frauenverehrer und ein sehr charmanter Mann. Also gerade die Beschimpfung von Frauen mit diversen Attributen, die hat mich gar nicht so schockiert, denn in Rumblicke wettert er gegen alles. Und dass es für Frauen gerade sexuelle Attribute negativ behaftet so zahlreich gibt,
Dafür ist Brinkmann nicht verantwortlich. Er nutzt sie einfach nur. Was mich persönlich immer so ein bisschen meinen eigenen Wüterich in mir hervorruft, sind andere Beschreibungen. Etwa in Keiner weiß mehr oder auch in einigen seiner Briefe, wenn er sich zum Beispiel darüber aufregt, dass seine Frau es noch nicht geschafft hat, mit dem Kind rauszugehen und dass es spät wird.
Und da denke ich mir, du sitzt an deinem Schreibtisch. Dann macht es sich einfach. Du machst es dir einfach. Wie wäre es, wenn du die Schuhe anziehst? Und warum bist du nicht mit deinem Kind rausgegangen? Anstatt hier zehn Seiten lang darüber zu lamentieren, dass deine Frau es erst am Nachmittag schafft. Im Zweifelsfall macht er Literatur daraus, weil er sie beobachtet. Und das sind so Momente, wo ich denke, also wenn das mein Kerl wäre, dem hätte ich aber...
Damit habe ich Probleme. Die Schimpfworte sind, wie gesagt, weniger einfach.
weil alle beschimpft werden. Ja, also dem kann ich auch nur voll zustimmen. Da steckt er höchstwahrscheinlich tatsächlich noch so in dieser Art der Beziehung Männer-Frauen der damaligen Zeit drin. Wenn Sie jetzt diesen Film anschauen, bringt man Zorn. Da gibt es ja diese Szene, wo Marleen einen Kuchen backt und wo er sie interviewt und sagt, Marleen, was machst du denn jetzt da? Also das schmerzt mich förmlich, körperlich, dass
Das ist so schrecklich. Dann sagt Marlene, ja, ich rühre jetzt das Ei. Und dann sagt er, und was machst du noch? Ja, jetzt nehme ich noch etwas Vanillezucker oder so. Also das ist schon sehr schwer zu ertragen. Ich würde gerne noch auf den letzten Gedichtband kommen, Westvers 1 und 2. Das gilt ja so als ein Opus Magnum. Und es ist ja auch ein Gedichtband, glaube ich, wo er als Lyriker nochmal so ganz neue Wege beschritten hat.
Wer möchte etwas dazu sagen? Frau Vase hat genickt. Es ist sein Opus Magnum und da kommt einfach vieles zusammen. Und man kann, finde ich, so ein bisschen verfolgen, wie sich da ein Lyriker aus- und weitergebildet hat und ist da wirklich bei seiner ganz eigenen Sprache gelandet. Es ist einfach auch ein Gedichtband, der in dieser Form...
in der deutschsprachigen Literatur bisher nicht da war. Gleichzeitig ist er natürlich sehr geprägt, auch in vielen Zügen durch die amerikanischen Lyriker oder auch englische. Zum einen, was diese Langgedichte angeht, da gibt es Vorbilder bei Charles Olsen zum Beispiel, ja, The Projective Verse, wo das Langgedicht gewissermaßen auch eine andere Form ist als die in Europa vielleicht so verbreitete Kurzgeschichte.
Über das kurze und das lange Gedicht bringt man diese lange Form mit eingenommen. Diese Einfachheit, Gedichte zu schreiben, so einfach wie Songs, wie eine Tür zu öffnen. Und gleichzeitig ist dieser Gedichtband nicht denkbar, ohne das, was er gewissermaßen vorher durchschrieben, durchlebt, durchgesehen und so weiter erinnert hat. Ersterkundungen?
Dann Romblicke, dann Schnitte und dann Westwärts 1 und 2. Und das ist ein Kontinuum, das alles ineinander fließt und dann wäre vielleicht als nächstes, vielleicht, vielleicht auch nicht, dieser Roman entstanden. Aber Romblicke ist sozusagen ein Schritt dahin zu schon auf Westwärts 1 und 2. Und Westwärts 1 und 2 ist ein Gedichtband-
Ich frage mich, ob man es so lesen kann, also so wie so ein Bewusstseinsstrom, gerade diese langen Gedichte, wo eben auch diese verschiedenen Stimmen im Kopf, die wir ja alle auch kennen, die sich in der Zeit der Welt verhalten.
Das sind ja auch immer Fragmente, ist ja das zentrale Stilmittel, dass ja immer diese sprachliche Trümmerform eigentlich fehlt. Also man hat ja oft auch so diese Gedankenschnipsel und dann sind Erinnerungsschnipsel und dann hat man eine Beobachtung, dann kommt ein Songzitat, also dass das so ineinander verschachtelt ist oder, ja, wie würden Sie das sehen? Also ich finde, es sind Gedankenströme, es ist aber noch was anderes. Es ist eigentlich seine Biografie,
in verschiedensten Formen auf den Punkt gebracht. Denn er geht auch da wieder zurück nach Fechter. Er ist in der Gegenwart. Es sind Gedichte, die seine Zeit in Rom oder in Ulle Ivano thematisieren. Es sind seine Erlebnisse in Texas Austin, die mit rein spielen. Also ich finde, das ist eine Art der eigenen Geschichte.
autobiografischen oder autofiktionalen, lyrischen Darstellung. Und man muss diesen Gedichtband als Ganzes sehen. Es ist nicht nur eine Ansammlung meiner besten Gedichte der letzten vier Jahre, es ist ein Gesamtkonstrukt. Es hat so eine Dialektik, die besteht aus Öffnen und Schließen, Vergangenheit und Gegenwart, Destruktion und Konstruktion.
Und Bewegung und Ruhe, das ist sozusagen ein unheimlich starker Rhythmus in den Gedichten. Apropos Bewusstseinsstrom, ich meine, man muss vielleicht an dieser Stelle mal das Thema der Drogenerfahrung einbringen. Da muss man vielleicht zunächst einmal sagen, weil manche Leute denken immer, dieser Mann, der hat also fürchterlich viele Drogen genommen und war also vollkommen daneben, dem war also absolut gar nicht so...
Drogenerfahrungen sind ja hochinteressante Sachen, darüber wird ja kaum gesprochen, weil das ja auch immer noch so ein Thema ist, was irgendwie weggedrückt wird. Aber es tut natürlich etwas mit dem Bewusstsein. Sie kommen ja in ganz andere Bewusstseinssituationen und von daher denke ich, hat das auch damit etwas zu tun und hat Eingang genommen dann eben in seine Gedichte später auch, ja.
Dieser Titel Westwärts, der klingt ja eigentlich nach Aufbruch. Diese beiden Titelgedichte...
enden aber ja mit dieser Ernüchterung oder auf einem leeren Parkplatz. Also ist es eine lyrische Absage auch des Poppoeten an sein Traumland USA? Naja, ob es das Traumland war, weiß ich nicht, weil er ist ja 1974 überhaupt erst das erste Mal in die USA gereist. Bisher hatte das ja alles nur literarisch aufgegriffen und er kommt verändert auch aus diesem Land zurück.
Und da steckt eigentlich gewissermaßen die ganze Dialektik der deutschen Literaten in Bezug auf Amerika schon drin. Die ist eben ambivalent. Oder ist es eine lyrische Absage an die Popkultur zumindest? Ich glaube, es ist eher das, denn Brinkmanns Westwärtsbegriff ist eigentlich noch größer. Das ist die Absage an den Traum der USA, den er hatte, bis er dort war. Und ich glaube, sowas ist eigentlich überall. Und es ist auch egal, ob wir jetzt von ...
Bundesrepublik oder von der DDR sprechen. Alles ist westwärts. Die Mythologie der vier Himmelsrichtungen ist zusammengebrochen. Das ist ein Zitat aus Westfals. Insofern reist er nach Norden in die eigene Fechtervergangenheit. Er reist nach Italien. Er liest einen buddhistischen Lyriker und geht nach Osten und er verarbeitet seine amerikanischen Erfahrungen. Insofern ist westwärts in dem Sinne überall Utopie und wieder Ernüchterung.
Kann man sagen, er war im Grunde schon ein postmoderner Autor oder sind das nur so Begriffe? Wie würden Sie das einschätzen? Also er arbeitet ja intermedial, interdisziplinär. Das Gedicht ist eigentlich Versprosa oder sogar schon Prosa. Er sagt selber, ja, dieser letzte Gedichtband, ich weiß gar nicht, ist das ein Gedichtband? Ist das vielleicht ein Essay-Buch oder ist das ein Roman? Das kann ich gar nicht mehr sagen, sagt er zu seinem Lektor.
Es geht schon im Kern auch um ein Infragestellen von bestimmten Formen des Romans, vom Realismus bis in die Moderne, wo eben tatsächlich ja mit dem Bindestrichbegriff Post dann vielleicht etwas dagegen gesetzt werden sollte.
Ja, der 35-jährige Rolf-Dieter Brinkmann, das gehört ja zur großen Tragik seines Lebens. Er hat ja eigentlich nur um wenige Tage, er ist ja sozusagen auf der Schwelle zu seinem furiosen Literatur-Comeback, ist er gestorben. Dann am 23. April 1975, wenige Tage später, erschien dieser letzte Gedichtband, Westwärts 1 und 2 und ja, damit beendet.
War er eigentlich sofort wieder auf der großen Literaturbühne, bekam dann auch noch Posthum den Pretraka-Preis verliehen? Es gibt den Augenzeugenbericht von Jürgen Theobaldi, er war ja mit dabei in Cambridge, wo Brinkmann so begeistert war, wie er aufgenommen wurde. Da war eben Jürgen Theobaldi, die haben dort gelesen, er war ganz gelöst, beglückt und wollte, glaube ich, sogar irgendwie überlegen, ob er nach England geht.
Jürgen Diorbaldi war Augenzeuge auf der Westbourne Grove, eine sehr befahrene Straße. Und Reinhold Nemdimont hat ja im Keepmore & Witsch Verlag eine Einrichtung eingeführt, das war die Mittwochskonferenz. Und er hat mir eben berichtet, dass er sich noch sehr gut daran erinnerte, es war ein Mittwoch, an dem die Nachricht über Rolf-Dieter Brickmanns Tod in den Verlag kam. Und da habe ich ihn gefragt, wie hat er das da aufgenommen und er hat mir gesagt,
Wir konnten dann nicht mehr dem Alltagsgeschäft folgen, auch wenn Brinkmann nicht mehr unser Autor war, gab es eine intensive Verbindung und er hat dann diese Konferenz dann in dem Sinne abgebrochen. Frau Pfeiffer, können Sie sich noch daran erinnern, wie Sie diese Todesnachricht von Rolf-Dieter Brinkmann damals bekommen haben? Ja, natürlich. An sowas kann man sich ja immer erinnern. Also wir wussten ja, Rolf war in London, Henning war auch noch mit ihm zusammen am Tag, bevor er...
nach London geflogen ist. Und naja, man ist dann natürlich nicht in Verbindung, weil die Zeit war ja nicht danach. Aber er war also dabei, zurückzukommen. Also wir haben ihn zurückerwartet irgendwie in den nächsten Tagen. Und dann war ein Morgen ganz normal. Jeder machte irgendwie, was er tat. Also man trank Tee oder Kaffee und ging irgendwie rum und das Radio lief.
Und dann kamen die Nachrichten, ganz normale Nachrichten. Und da hieß es dann plötzlich, der Kölner Schriftsteller Rolf-Dieter Brinkmann ist gestern Abend in London tödlich verunglückt. Ja, also ich weiß nicht, ich...
Ich kann mich nicht so recht erinnern. Also man steht unter Schock. Aber Henning, der hatte gerade seine Teetasse oder Kaffeetasse in der Hand und der hat die an die Wand geschleudert mit dem Tee oder was. Ja, also es war wie so ein Fallbeil, was da gefallen ist, weil man wusste automatisch, dass dieser Brinkmann, über den ja heute Abend so viel gesprochen worden ist, der ist jetzt plötzlich weg. Ja.
Das ist schon merkwürdig. Also auch unser Leben, obwohl wir inzwischen ganz anders leben und immer weiter leben, hat sich ja total verändert. Und dennoch, es ist immer, bringt man dabei. Das geht nicht anders. Ich glaube, das ist dann das Schlusswort für die Runde. Vielen Dank.
Vielen Dank an Alexandra Waser. Sie ist die Autorin, Mitautorin der Biografie. Ich gehe in ein anderes Blau zusammen mit Michael Töteberg. Vielen Dank auch an Linda Pfeiffer, eine enge Weggefährtin von Rolf-Dieter Brinkmann. Und vielen Dank auch an den Literaturwissenschaftler Roberto Di Bella. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle eine lange Nacht über den Mythenforscher Joseph Campbell.
der aus Ursprungserzählungen, Märchen und Sagen der ganzen Welt das Schema einer Heldenreise destilliert hat. Und damit eine Vorlage geliefert hat, an der sich Kinoproduzenten in Hollywood ebenso wie Therapeuten und Coaches orientieren. Seien Sie gespannt. Sie können alle Lange Nächte der letzten Monate auch in der Deutschlandfunk-App nachhören. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche.